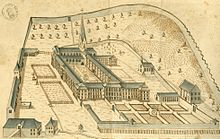Berthold II. Tutz
1358–1373 (Rücktritt)

In Adelsreute, einem Ortsteil von Taldorf, das heute zur Stadt Ravensburg gehört
wollte Ritter Guntram von Adelsreute seinen Besitz, der aus verschiedenen Dörfern und Weilern im
dicht besiedelten Linzgau am nördlichen Bodensee befand, 1123 in ein Zisterzienserkloster investieren.
1134 wandte er sich deshalb an den Abt von Kloster Lützel, das im äußersten Süden des Elsaß direkt an der Grenze zur Schweiz liegt.
Er bat Abt Christian (1131 ?- 1175 ?) einen Gründungskonvent in das von ihm geplante Kloster zu schicken.
Guntram hatte noch einen weiteren Besitzkomplex, der sich im Tal der Aach befand.
Darin lag der Ort Salmannsweiler, ein kleines Dorf mit einer Pfarrkirche, die der heiligen Verena und dem heiligen Cyriakus geweiht war, umgeben von einigen kleinen Weilern.
Dort sollte das neue Kloster entstehen.
Der Abt sandte den Salemer Cellerar Frowin mit 12 Mönchen nach Salmansweiler. Nach der Cistercienser Chronik Nr. 3 vom 1.Januar 1891, S. 2, war er Mönch in Bellevaux, der dem Mutterkloster von Lützel
geschickt wurde,und gehörte vielleicht dem Gründungskonvent an, der von dort nach Lützel geschickt wurde.
Das Kloster erhielt den Namen Salem. Im Alten Testament war das der Sitz des Königs Melchisedek-Im Mittelalter wurde das biblische Salem als der ältere Name von Jerusalem gedeutet.
Nach ihrer Ankunft begannen die Mönche sofort mit dem Kloster-und Kirchenbau.
Auch die rechtliche Absicherung wurde schnell vorangetrieben.
Papst Innozenz II. (1133-1143) bestätigte am 17. Januar 1140 die Schenkung Guntrams von Adelsreut und nahm Kloster Salem in seinen Schutz. (Codex Salamiticus 2, S 2).
und erklärte dessen Vogtfreiheit.
Im gleichen Jahr stimmte Herzog Friedrich II. von Schwaben (1105-1147) der Gründung des Klosters zu.
König Konrad III. (1138-1152) bestätigte am 19. März 1142 in Konstanz die Gründung des Zisterzienserklosters Salem durch Guntram und bestätigte seinen Besitz.
Außerdem sicherte er als dessen alleiniger Vogt gegen alle Eingriffe Dritter. Konrad III. – RI IV,1,2 n. 234
Die Staufer förderten die weitere Entwicklung von Kloster Salem tatkräftig und nutzten ihre Vogtei als Instrument ihrer Territorialpolitik.
Da auch das Mutterkloster Lützel den Staufern verbunden war, ergänzte sich das natürlich.
Am 20, Februar 1146 bestätigte Papst Eugen III. (1145-1153), der erste Zisterzienserpapst, die Schenkung Guntrams für Salem und nahm das Kloster in seinen Schutz. (Codex Salamiticus 4, S 7 ff).
Das junge Kloster erfreute sich sofort eines regen Zulaufes und schon 1147 konnte Kloster Salem seine erste Tochter gründen, nämlich in Raitenhaslach an der Salza, nahe bei Burghausen.
Die Besiedelung durch Salemer Mönche ist zwar nicht direkt dokumentiert, aber durch das stets unangefochtene Visitationsrecht ausreichend belegt.
(Zu Kloster Raitenhaslach, Tennenbach, Wettingen und den unter Abt Eberhard gegründeten Zisterzienserinnenklöstern sie he das jeweils betreffende Kloster in Mei Büchle)
Am 25. August 1152 nahm Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152-1190) nur knapp fünf Monate nach seiner Wahl zum deutschen König Kloster Salem in seinen Schutz und bestätigte seine Güter im einzelnen. Friedrich I. – RI IV,2,1 n. 130
Kurz nach seiner Kaiserkrönung nahm Friedrich Kloster Salem wieder in seinen Schutz und bestätigte die Güter des Klosters, die aus dem Erbe des Guntram von Adelsreute zuerst in die Hand des Abtes Christian von Lützel und später durch König Konrad
an Abt Frowin übergeben wurden. Friedrich I. – RI IV,2,1 n. 370
In der Cistercenserchronik Nr.3 , S 3ff wird berichtet, dass Abt Frowin Bernhard von Clairvaux (* um 1090-1153) auf dessen Reise 1146 durch Deutschland, auf der er für die Kreuzzüge warb, begleitete.
Ebenfalls mit dabei der Konstanzer Bischof Herrmann von Arbon (1138-1165), der Bernhard von Clairvaux nach Konstanz eingeladen hatte und ihn auf dessen Reise durch die Diözese Konstanz begleitete.
Es spricht schon einiges für diese Darstellung, denn Frowin war der Abt des bis dahin einzigen Zisterzienserklosters der Diözese Konstanz und dürfte Bernhard auch persönlich vom Besuch des Generalkapitels von 1146,
bei dem er wohl dabei war, gekannt haben.
Die Klosterkirche wurde zischen 1150 und 1160 fertiggestellt. Die Kirche hatte nach der Salamitaner Chronik 8 Altäre, von denen Bischof Herrmann 2 weihte.
Abt Frowin tritt noch ein mal als Schiedsrichter in einer Streitsache zwischen den Klöstern St. Blasien und Allerheiligen in Schaffhausen zusammen mit Abt Christian von Lützel und Abt Frowin (1143–1178,) am 14. Oktober 1164 auf (S. 7)
1160 stellt Friedrich eine weiter Schutzurkunde für Kloster Salem aus. Friedrich I. – RI IV,2,2 n. 844
Abt Frowin starb am 27. Dezember 11 65.
Der zweite Abt von Salem war Godefridus (1166–1168
Auf ihn folgte Abt Erimbertus (1168–1175 )
Am 4. Januar 1178 nahm Papst Alexander III.(1159-1183) Kloster Salem und seine Besitzungen in seinen Schutz, bestätigte diese und verlieh dem Kloster verschieden in der Urkunde genannten Begünstigungen. (Codex Salamiticus 21, S 34 ff).
Abt war nach der Biographia cisterciensis Christian (1175–1191)
1180 bestätigte der Einsiedler Abt Wernher II. von Toggenburg (1173 –1192 ) den Verkauf des Gütleins Maurach an das Kloster Salem (Codex 23, S. 37)
Das war ein wichtiger Ort für das Kloster, denn er lag direkt am Bodensee und sicherte so den Zugang zur Güterschiffahrt auf dem Bodensee. Zunächst war Maurach Getreidelager, Umschlagsplatz mit Schiffanlegestelle,Dann wurde dort die Sommerresidenz
der Äbte von Salem gebaut.
1180 unterstellte der Abt von Lützel Archenfried (1179-1181) das ihm unterstellte Kloster Tennenbach Abt Christian von Kloster Salem, das damit Tochterkloster von Salem wurde.
(tennenbacher Urkundenbuch S. 6)
Tennenbach war nicht von Salem gegründet worden, sondern von Frienisberg, war aber Lützel unterstellt, da Frienisberg ein Tochterkloster von Lützel war.
Am 20. Juni 1183 nahm Kaiser Friedrich Kloster Salem mit seinen näher bezeichneten Schutz und nahm es in seinen unmittelbaren und ausschließlichen Schutz. (Codex 26, S. 41 ff.)
Salem war nun Reichskloster.
Am 4. März 1184 beauftragte Papst Lucius III. (1181-1185) Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte, Prioren, Archidiakone, Dekane, Priester und Prälaten , das Privileg der Zisterzienser der Zehntbefreiung zu beachten, und dafür zu sorgen, dass niemand von dem Abt
und Brüdern von Salem Zehnt verlangt und das bei Zuwiderhandlung mit Exkommunikation zu bestrafen. (Codex 28, S. 45 ff.)
Am 4. März 1185 nahm Papst Lucius Abt Christian und seine Brüder von Kloster Salem in seinen Schutz und bestätigte seinen Besitz. (Codex 34, S 53 ff)
Damit hatte Abt Christian neben dem ausschließlichen Schutz des Kaisers auch die Zehntbefreiung bekommen und einen päpstlichen Schutzbrief erhalten.
Am 18. 11 1190 bestätigte Papst Clemens III. (1187-1191) Abt Christian den Zehnten von Maurach. (Codex 43, S 67 f.)
Christian regierte bis 1191.
Sein Nachfolger wurde Abt Eberhard I. von Rohrdorf (1191–1240), der bedeutendste Abt Salems im Mittelalter.
Der Vater von Eberhard war Graf Gottfried von Rohrdorf (+ 1191) Die Familie zählte zu einem der führenden Hochadelsgeschlechter im Bodenseeraum.
Sie hatten Besitz um Messkirch, in Oberschwaben,im Hegau und im Linzgau. Die erste Rheinbrücke in Konstanz soll von ihnen errichtet worden sein.
Eberhard wurde um 1160 geboren. Um 1180 trat er in das Kloster Salem ein.
Am 12. Juni 1191 wurde er zum Nachfolger des verstorbenen Abtes Christian gewählt. Über seine Klostertätigkeit vor seinem Abbatiat ist nichts bekannt.
Zu Beginn seiner Amtszeit konnte er Streitigkeiten wegen der Grangie Madach mit dem Reichsministerialen Ulrich von Bodman beenden. Der Konstanzer Bischof Diethelm von Krenkingen (1189 –1206 )
beurkundete dazu eine Sühne. (Coidex44, S. 68 ff.)
Am 7. Juni 1192 nahm Kaiser Heinrich VI. (1191-1197) auf Bitten Abt Eberhards Kloster Salem mit seinen Besitzungen in seinen Schutz. (Codex 45, S. 70 ff.)
Am 6. November 1194 bestätigte Papst Cölestin III. (1191-1198) dem Kloster Salem allen Besitz, den es vom Bistum Konstanz und vom Kloster Reichenau erworben hatte (Codex 51, S. 78 f.)
Auch setzte Cölestin in dieser Urkunde fest, dass wenn der jeweilige Bischof von Konstanz sich weigern sollte, dem Abt von Salem die Benediktion zu erteilen oder andere bischöfliche
Geschäfte auf Ersuchen nicht vornimmt, das Kloster berechtigt ist, einen anderen Bischof anzugehen. Codex 54, S. 81 ff)
Nach dem plötzlichen Tod Kaiser Heinrichs VI. am 26. September 1197 gab es 1198 zwei Königswahlen. Gewählt wurden Philipp von Schwaben (1198-1208), aus der Familie der Staufer und
Otto IV. von Braunschweig (1198-1218) aus dem Hause der Welfe. Beide beanspruchten den Thron für sich. Es kam zum “deutschen” Thronstreit.
Abt Eberhard stellte sich auf die Seite Philipps und war auch oft in seiner Umgebung.
Er nahm 1201 am Reichstag in Ulm teil, an dem er den Salzburger Erzbischof Eberhard II. von Regensberg (1200–1246 ) kennen lernte.
Eberhard unterstellte sein Kloster formell dem Erzbischof von Salzburg. Das starke Wachstum Salems hatte zu Konflikten mit dem umliegenden Adel und auch dem Bischof von Konstanz geführt.
Eine tatsächliche Abhängigkeit von Salzburg hatte die Unterstellung nicht geführt. Für Salem war es aber eine Absicherung. Sie war auch finanziell lukrativ, denn der Salzburger Erzbischof
schenkte Kloster Salem am 16. Dezember 1201 eine Salzgrube mit Salzpfanne in Wallbrunn bei Hallein verbunden mit dem Recht, das dazu nötige Holz in den Wäldern schlagen zu dürfen.
(Codex 61, S. 91)
Papst Innozenz III. bestätigte diese Schenkung am 15. März 1202 (Codex 62, S. 93)
König Philipp bestätigte diese Schenkung am 3. August 1207 ebenfalls und nah in dieser Urkunde auch Kloster Salem und seine Besitzungen in seinen Schutz. (Codex 67, S. 98 ff)
Geschickt abgerundet wurde dies durch Verhandlungen mit den Pfalzgrafen bei Rhein und den Herzögen von Bayern, die für die Salztransporte Zoll- und Mautfreiheiten einräumten,
so dass Salem dieses Salz lukrativ am Bodensee verkaufen konnte.
Der Salzhandel dauerte für Salem bis 1530, als es zusammen mit dem Erzstift Salzburg seine Saline für 888 Florentiner Gulden, das sind etwa 235.124,00 €. an den bayrischen Herzog Ludwig X. (1514 -1545) verkaufte.
(Franz Xaver Conrad Staiger Salem oder Salmannsweiler-ehemaliges Reichskloster, Salem 1862, S. 83) Salem besaß auch ein Haus in Salzburg, das es nach Staiger bedingt durch die Kriegsfolgen des 30-jährigen Krieges 1651
für 1200 fl., das sind ungefähr 953.207,00 €., an das Domkapitel Salzburg verkaufte.
1201 reiste Abt Eberhard zusammen mit Erzbischof Eberhard von Salzburg im Auftrag Philipps von Schwaben zu Papst Innozenz III. nach Rom, um diesen zur Anerkennung der Nachfolge Philipps auf dem deutschen Thron zu gewinnen,
was ihnen aber nicht gelang.
Am 3.07 1207 bestätigte König Philipp die Schenkung der Saline durch Bischof Eberhard von Salzburg und nahm dabei gleichzeitig Kloster Salem in seinen Schutz. (Codex 67, S. 98 ff.)
1207 vermittelte Abt Eberhard nochmals zwischen König Philipp und Papst Innozenz.
Vor 1208 gestattete König Philipp sowohl mit Kirchen als auch geistlichen und weltlichen Personen Güter zu tauschen.
Als Philipp am 21.06.1208 in Bamberg ermordet wurde, erkannten Abt Eberhard und der Salemer Konvent die Königsherrschaft Ottos IV. an.
Otto IV: stellte dem Kloster mehrere Urkunden aus. In einer undatierten Urkunde nahm er Kloster Salem in seinen Schutz. (Codex 71, S. 102 f.)
Am 14. Juli 2009 stellte er in Ulm eine weitere Schutzurkunde aus und gab in dieser Urkunde dem Abt auch das Recht, sich in den Geschäften des Klosters durch einen bevollmächtigten Bruder des Klosters
vertreten zu lassen. (Codex 73. S.103 f.)
Schon am 27. Januar 1209 hatte er dem Kloster ein Urkunde ausgestellt, in der er dem Kloster gestattete, von seinen Dienstmannen und anderen Personen, Geschenke anzunehmen. (Codex S. 72, S. 105 f.)
Trotz dieser Anerkennung des Königtums von Otto hielt Eberhard insgeheim weiter Kontakt zu Philipps Neffen Friedrich II., der ab 1198 König von Italien war.
Schon 1210 bestätigte Friedrich von Catania aus Kloster Salem alle seine Rechte und Besitzungen. (Codex 75, S. 107 ff). Sicher hat das Kloster dies nicht an die große Glocke gehängt.
Dass die Zeiten direkt nach dem Tod Philipps ein bisschen unsicher waren, zeigt auch eine Schutzurkunde von Papst Innozenz vom 7. November 1209, in der der Papst dem Erzbischof von Mainz, das war 1209
Siegfried II. von Eppstein (1200 –1230 ) und seinen Suffraganen sowie dem Basler Bischof Lüthold von Aarburg (1191- 1213) sowie Äbte und Prälaten beider Diözese befahl, Abt und Brüder des Klosters Salem
vor ihren Verfolgern zu schützen. (Codex 74, S.107)
Friedrich setzte sich ab 1212 zuerst in Süddeutschland und dann in Norddeutschland gegen Otto durch.
Am 5. Dezember 1212 wurde Friedrich in Frankfurt zum deutschen König gewählt und am 9. Dezember in Mainz von Erzbischof Siegfried II. gekrönt.
Die Beziehungen Eberhards zu Friedrich II. bleiben in der Folge immer eng, ebenso wie zu Friedrichs Sohn Heinrich VII. (1220-1235).
Schon am 31. März 1213 bestätigte er in Konstanz die 1210 in Catanis ausgestellte Urkunde. (Codex 84, S. 121 f)
Mit demselben Datum bestätigte er auch die von Erzbischof Eberhard von Salzburg getätigte Schenkung der Saline in Mühlbach. (Codex 85, S. 123 )
In dieser Zeit bestätigt Friedrich auch eine ganze Reihe von Besitzungen.
Vor 1220 befahl Friedrich allen Schultheissen in Schwaben, falls in den dortigen Städten für ihn Gelder erhoben werden, von den Häusern, welche Salem gehören,
nichts zu fordern. (Codex 109, S. 149 f)
Noch weiter ging die Urkunde von Heinrich VII. vom 9. August 1231, in der er den Reichsbeamten mitteilte, dass die Besitzungen von Kloster Salem
“im ganzen reich frei von ieder steuer und abgabe sein sollen.” Heinrich (VII). – RI V,1,2 n. 4215
Abt Eberhard baute die wirtschaftliche Grundlage seines Kloster gezielt aus. Das Stiftungsgut um Adelsreute war schon 1198 in eine Grangie umgewandelt worden.
Die ausgedehnte Grangienwirtschaft produzierte rasch Überschüsse konnten in den umliegenden Städten verkauft werden und verschafften ausreichende Mittel, die gezielt zum Grunderwerb genutzt werden konnten.
So entstand die Grangie Runstal bei Schwenningen durch eine gezielt von Eberhard verfolgte Besitzpolitik. Das gilt auch für die Grangie Altmannshausen bei Zwiefalten.
1250 besaß Kloster Salem 22 Grangien. Diese wurden von Konversen bewirtschaftet, die wiederum Lohnarbeiter beschäftigten.
In den Grangien wurde Getreide, Obst und Gemüse angebaut.Auch Viehzucht und Fischfang spielte eine Rolle,
Wichtigstes Produkt in Salem war der Wein. Zwischen Lindau und Stockach wurde am Bodensee in 28 Orten Wein angebaut.
Das Kloster besaß Stadthöfe in Ulm, Esslingen, Konstanz , Überlingen, Reutlingen und an 20 kleineren Orten.
Am 24. April 1222 beurkundete König Heinrich VII., dass sein Notar Marquard Pleban ein Haus mit Kapelle und Hof an Abt Eberhard und das Kloster Salem geschenkt hat. (Urkunde 27 Ulmer Urkundenbuch S. 39)
Es ist das älteste Steinhaus von Ulm. 1267 überließ es Abt Eberhard II. von Wollmatingen (1241–1276) dem Reichenauer Konvent und Abt Albrecht von Ramstein (1260–1294)
gegen ein Grundstück am Bodensee.
1309 erwarb Kloster Salem ein anderes Haus in Ulm.
Ab 1505 hatte Salem einen anderen Pfleghof in Ulm. 1794 wurde der Hof abgerissen und neu erbaut und war bis 1803 Pfleghof des Klosters Salem. Er befindet sich in der Frauenstraße 2 in Ulm.
In Konstanz hatte Kloster Salem einen Pfleghof am Seeufer. Schon 1217 hatte das Kloster das Recht, dort Gelände aufzuschütten und ein Haus zu errichten. Die ersten Gebäude sind ab 1238 nachweisbar. Das Hauptgebäude
wurde 1317 erbaut.Das Gut mMudach war über den See aus gut mit dem Schiff zu erreichen. Das Kloster konnte seine Güter als einfach nach Konstanz bringen, um dort Handel zu betreiben.
In Krisenzeiten konnten so auch Gegenstände und natürlich Personen in Sicherheit gebracht werden. Die sogenannte Herberge wurde 1866 abgerissen und befand sich in der Salmannsweilergasse in Konstanz.
Möglicherweise hatte der Salmannsweiler Hof schon einen Vorgänger, das sogenannte Hospitiium. Da war dann wohl auch Bernhard von Clairvaux auf seiner Kreuzzugspredigtreise 1146/7 zu Gast gewesen.
Während des Konstanzer Konzils hatte Kaiser sigismund (1411-1437) 1414 sein Quartier Ein Jahr später kam der Salzburger Erzbischof Eberhard III. von Neuhaus (1403–1427) zum Konzil und war ebenfalls im Salmannsweiler Hof untergebracht.
Er kam zu Schiff an. Seine 170 Pferde wie der Chronist des Konzils Richental berichtet waren aber in Kloster Salem und Umgebung untergebracht.
Neben den auf den Grangien erzeugten Gütern wurde das Salz aus der Salemer Saline bis nach Lindau gebracht, dort verladen und über den Bodensee nach Konstanz gebracht, im Salmannsweiler Hof gelagert und von dort verkauft.
Der Salmannsweiler Pfleghof in Überlingen wurde 1231 erstmals urkundlich erwähnt, Das Grundstück wurde aber wohl schon 1211 erworben. Der Hof in Überlingen besteht einem barocken Südflügel, das mit einem mittelalterlichen Torhaus mit spätgotischem Erker und Zinnen verbunden sind. Im Hof Dahinter befanden sich die Wirtschaftsgebäude des Pfleghofes. Nach der Säkularisation wurde der Hof als Brauerei und Gaststätte benutzt.
In Eslingen hatte Kloster Salem seit 1229 einen Pfleghof.(Codex 161, S.195) Die Zisterzienser waren in Esslingen gut vertreten, den die Kloster Bebenhausen, Kaisheim und Fürstenfeld hatten in Esslingen ebenfalls Pfleghöfe.
Alle 4 Klöster betrieben auch Weinbau in Esslingen.
Das Gebäude des Pfleghofs war möglicherweise schon vor sein er Nutzung als Pfleghof Teil der früheren Stauferburg, die um 1200 zu einer Pfalz der Staufer umgebaut wurde.
Unter den Äbten Johannes II. Scharpfer (1494–1510 ) und Jodocus II. Necker( 150-1529) wurden zwischen 1508 und 1515 zahlreiche bauliche Veränderungen vorgenommen.
Trotz der Reformation blieb der Pfleghof weiter im Besitz von Kloster Salem. Allerdings gab es jetzt oft erhebliche Reibereien.
Bis 1682 blieb der Pfleghof im Besitz von Kloster Salem. Dann wurde er an Württemberg verkauft.
1305 wurde erstmals der Pleghof von Salem in der Reichsstadt Reutlingen erwähnt.
1419 überließ Kloster Salem den Pfleghof der Bürgerschaft der Stadt.
Seit 1271 hatte Kloster Salem den Salemer Hof in Ehingen. Graf Ulrich III. (+1319) befreite diesen von allen Diensten und Steuern. Von hier ausverwaltete das Kloster die zahlreichen Güter des Klosters in der Umgebung der Stadt.
Dieser Hof diente also kaum als Handelshof des Klosters.
In Nürtingen erwarb Kloster Salem 1284 von Graf Berthold IV von Neuffen (+1292) dessen gesamten Nürtinger Besitz. Es war wohl die ehemalige Reichsdomäne, die Kaiser Heinrich III. (1039-1056)
am 07. September 1046 dem Domkapitel Speyer schenkte.(Heinrich III. – [RIplus] Regg. Heinrich III. n. 169 )
Diesen Besitz entwickelte das Kloster zu einem Pfleghof. 1482/83 baute das Kloster dort einen neuen repräsentativen Pfleghof.
Nürtingen war 1299 an Württemberg gekommen. Nach der Reformation in Württemberg hatte der katholische Pfleghof unter Repressalien seitens der württembergischen Grafen und Herzöge zu leiden: Der Salemer
Hof hatte u. a. dessen Jagdhunde zu halten und die großen gräflichen Jagdgesellschaften zu bewirten, was in gewaltigen Gelagen ausartete und zum (un-)wirtschaftlichen
Faktor wurde. Im Jahr 1645 erfolgte schließlich die unentgeltliche Übergabe an Württemberg. In dem Anwesen installierte Württemberg eine herzogliche „Kellerei“.
1307 kaufte Kloster Salem in Biberach ein Haus und errichtete auf diesem Grund den Salmannsweiler Hof. Der Hof hatte ein eigens Tor mit einer Brücke über den Stadtgraben.
Er hatte eine eigene Hauskapelle, die 1502 geweiht wurde. Am 4. August 1516 brach dort ein Feuer aus, das sich zum großen Stadtbrand entwickelte und dann über 106 Häuser abbrannten.
Der Wiederaufbau verwickelte das Kloster in einen langen Rechtsstreit mit der Stadt. 1739 verkaufte das Kloster den Hof und Fischrechte in der Riss für 4500 fl, das sind ungefähr 3.558.293,00 € an
den Biberacher Spital. (Beschreibung des Oberamtes Biberach, Stuttgart 1837,S..69)
Das Hoch-und Spätmittelalter erlebte eine regelrechte Stadtgründungswelle. Landesherren erhoben Ortschaften, die häufig aus kleineren Marktsiedlungen entstanden waren, zu Städten, indem sie ihnen Rechte verliehen. Mit Stadtgründungen erhofften sich die Herrscher, ihr Gebiet zu stärken und Einnahmen zu erzielen. Durch besondere Rechte unterschied sich die Stadt vom Umland. Viele Städte lagen verkehrsgünstig an Flussübergängen oder alten Römerstraßen.
Die Ansiedlung vieler Menschen auf kleiner Fläche bedeutete natürlich einen hohen Bedarf an Nahrung der Markt war also vorhanden.
Zwar sollten Klöster in erster Linie für den eigenen Bedarf produzieren. Da aber Mönche und Nonnen enthaltsam zu leben und sich nicht den Genüssen der Speisen hingeben sollten, blieb es nicht aus, dass sie Überschüsse erwirtschafteten.
Es ergab sich eine win win Situation für Städte und Klöster.Die Klöster sorgten für die Ernährung der Stadtbevölkerung und hatte einen Absatzmarkt für ihre Produkte.
Der französische Historiker Duby, Georges (1991) “Der heilige Bernhard und die Kunst der Zisterzienser “ Frankfurt am Main fasst die wirtschaftliche Tätigkeit der Zisterzienser so zusammen:
“Von all den Fellen, Häuten, Balken, Roheisenbarren, Schuhen, verwendeten sie nur einen winzigen Teil für sich. Den Rest verkauften sie. Die Regel des heiligen Benedikt untersagte das nicht. Die vom Generalkapitel des Ordens erlassenen Bestimmungen erlaubten den Ordensleuten, auf die Märkte zu gehen, um Salz und andere unentbehrliche Waren zu kaufen, vor allem aber, um dort den Überschuss an Erzeugnissen gegen Geld zu tauschen. Die Zisterzienserabteien konzentrierten sich mehr und mehr auf den Handel, ersuchten ab 1140 die Herren der Straßen, Flüsse und Brücken wiederholt um Befreiung vom Wegegeld und gründeten Lagerhäuser an den Umschlagplätzen”
Diese Lagerhäuser waren Höfe in Städten mit gut etablierten Märkten, wo die Klöster ihre Produkte anbieten konnten. Solche Klosterhöfe in den Städten besaßen in der Regel mehrere Gebäude: Neben einem Wohnhaus auch Speicherbauten. Bei diesen Höfen war jedoch vor allem wichtig, dass sie sich durch besondere Freiheiten von den sonstigen städtischen Wohnplätzen unterschieden. Von städtischen Abgaben und der städtischen Gerichtsbarkeit waren sie befreit. Auch von ständigen Pflichten wie einem Beitrag zur Wache auf den Mauern und an den Toren der Stadt waren diese Höfe befreit. Dafür musste aber an die Stadt oft ein pauschaler Beitrag geleistet werden. Für die Klöster der Zisterzienser waren Stadthöfe oft lebensnotwendig: »Sie dienten ihnen nicht wie die Stadthöfe mancher anderen kirchlichen Institutionen nur oder vorzugsweise als Absteigequartiere (für Bischof oder Abt), sondern sie waren vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht nahezu unentbehrlich. Angesichts der großen Zahl von Zisterzienserklöstern, die im 12. und 13. Jahrhundert gegründet wurden, bildete zu Beginn des 14. Jahrhunderts der zisterziensische Klosterhof einen üblichen Bestandteil einer großen bis mittelgroßen deutschen Stadt.«
Um die Höfe herum konnte weiteres wirtschaftliches Leben erblühen. Die Höfe konnten Schankrechte besitzen: Wein und Bier gab es hier. Weil die Klöster zwar Tiere für Transportleistungen und wegen ihrer Häute und Felle benötigten, andererseits aber durch die Gebote der Enthaltsamkeit kaum Fleisch verzehrt wurde, kamen vielfach auch Fleischerzeugnisse auf den Markt. In manchen Städten unterhielten Zisterzienser eigene Fleischbänke (so in Hannover und München), um Geschlachtetes auf dem Markt anbieten zu können.Abt Eberhard hat die meisten Pfleghöfe von Kloster Salem
anlegen lassen und auch das zeugt für seine wirtschaftliche Weitsicht.
Er ließ 1215 den Codex diplomaticus Salemetinaus anlegen, ,ein Kopialbuch (Chartular) mit Urkundenabschriften und einer Klostergeschichte von der Gründung der Mönchsgemeinschaft bis zum Jahr 1210 (Historia brevis monasterii Salemitani, auch De fundatione claustri Salemitani).
Salem hatte schon seit den 1160-er Jahren ein eigenes Skriptorium. Unter Abt Eberhard entwickelte dieses eine rege Tätigkeit.
Das Gros der in dieser Zeit entstandenen Handschriften ist auf die für den Zisterzienserorden festgelegte Liturgie abgestimmt Nach den Ordensstatuten waren folgende Bücher notwendig: Psalterium, Hymnar, Kollektar, Antiphonar, Graduale, Regel und Missale.
Die meisten dieser Bücher wurden in Salem geschrieben. Meist wurden Vorlagen kopiert oder imitiert. Oft wurden renommierte Schreibmeister und Miniatoren von anderen Orten hinzugeholt.
Im Skriptorium arbeitete auch der Mönch und Schreiber Johannes Gallus. Er verfasste die Gedichte Planctus und Titulus novi Banaye id est Ottonis qui duos occidit leones
(Denkmal für den neuen Banaias, d.h. Otto, der zwei Löwen getötet hat) Er verfasste zudem ein Gedicht auf den Konstanzer Bischof und Wohltäter Diethelm von Krenkingen (1189-1206), der in Salem starb, und über die Ermordung des staufischen Königs Philipp,.
So um 1240 waren wohl die meisten notwendigen Handschriften vorhanden. Das Skriptorium wurde daher eingestellt. Nur vereinzelt wurden Bücher ersetzt
Die Neuanschaffungen dieser Zeit wurden vor allem aus anderen Skriptorien bezogen,
Erst in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde das Skriptorium wieder tätig. Abt Ludwig  Oschwald
Oschwald
(1458/59-1471) ließ neue Gradualien anfertigen.
Schreibmeister Leonard Wagner (1453-1522) aus der Benediktinerabtei St. Afra in Augsburg Leonhard Wagner ist der bedeutendste Kalligraf der deutschen Spätrenaissance und Schöpfer der Deutschen Fraktur.
Auch Nikolaus Bertschi ( + 1541/42) war auch kurz in Salem. Er war kein Mönch und ist zwischen 1511 und 1541 in Augsburg belegt und war als Iluminator und Formenschneider tätig.
Leonhard Wagner unterrichte die Salemer Mönche auch im Notenschreiben und befähigte sie so, die Antiphonare eigenhändig fertig zu schreiben.
Ein weiterer Aspekt der Tätigkeit Eberhards muss erwähnt werden. Er war so etwas wie ein Pionier bei der Anerkennung der Zisterzienserinnen.
1132 wurde zwar schon 1132 in der heutigen französischen Gemeinde Tart-l’Abbaye in Burgund Kloster Tart als erstes Frauenkloster der Zisterzienser gegründet, aber die Männerklöster taten sich lange sehr schwer mit den Frauen.
Der Orden weigerte sich lange, Frauenklöster in den Klosterverband aufzunehmen. Erst 1228 ist die erste Aufnahme eines Frauenklosters in den Orden durch Quellen zu belegen.
Zwischen 1200 und 1270 entstanden über 800 Frauenkonvente in ganz Europa, mehr als es je Männerklöster gegeben hat, die sich im Sinne von Citeaux zusammenschlossen.
Viele hielten zwar zisterziensische Regeln und Konventionen bei, schlossen sich dem Orden aber nicht an. Der Grund lag vielleicht auch darin, dass die Frauenklöster beim Beitritt zum Orden ihre Unabhängigkeit verloren und sich dem Vaterabt eines Männerklosters unterordnen mussten.
Ware n sie aber in den Ordensverband aufgenommen, achtete der Vaterabt auf die Einhaltung der Gebräuche und regelte die wirtschaftlichen Belange. Gleichzeitig erhielten die Frauenkonvente Unterstützung durch Konversen des Ordens für ihre Güter und wurden durch Beichtväter seelsorgerlich betreut.
Im oberschwäbischen Raum gab es Reihe von Frauengemeinschaften, meist Beginen, die von Eberhard tatkräftig unterstützt wurden
Eberhard wurde sowohl vom Papst als auch von den Staufern hochgeschätzt und er nutzte seinen Einfluss auch bei der Unterstützung der Frauengemeinschaften.
Er begleitete die Frauengemeinschaften von ihrem Entstehen bis zur Aufnahme in den Ordensverband und half ihn meist schon beim Landerwerb.
So war er bei Kloster Wald schon in den Kauf mit eingebunden. Er genehmigte den Platz für die Klostergründung. Er erwirkte die päpstlichen Privilegien und er er übermittelte das Inkorporationsverlangen der Frauen an das Generalkapitel.
Kloster Wald wurde 1212 gegründet.
Der Grund für Kloster Rottenmünster hatte ursprünglich den Chorherren in Konstanz gehört. Dort lebte eine Schwesterngemeinschaft unter ihrer Meisterin Williburgis.
Diese Gemeinschaft gab den Grund nun an Eberhard weiter. Rottenmünster wurde dann 1221 gegründet
In Altheim bei Riedlingen gab es eine Schwesterngemeinschaft. Diese übersiedelte 1227 nach Wasserschapf. Diese Gemeinschaft sollte dem Zisterzienserorden zugeführt werden.
Abt Eberhard stand der Schwesterngemeinschaft bei. Er war behilflich beim Erwerb von Land in Wasserschapfen aus dem Besitz Konrads von Markdorf (1227) und beurkundete den Vorgang.
Dort entstand das nach einer Kreuzreliquie benannte Kloster Heiligkreuzthal. Schon 1231erhielt es das päpstliche Schutzprivileg („Privilegium Cisterciense“).
Nach der Aufnahme in den Orden war Eberhard als Aufseher und Vaterabt in Kloster Heiligkreuztal tätig und leistete seelsorgerische Dienste bei den Nonnen.
1227 gründete Abt Eberhard mit Kloster Wettingen in der Nordschweiz das zweite eigene Tochterkloster von Salem.
In Maselheim hatten zwei adlige Familien eine Beginenklause gegründet. Als “Heggbacher Geburtsurkunde” gilt die am 16. April 1231 in Salem ausgefertigte Urkunde. Sie wurde von dem Konstanzer Bischof Konrad von Tegerfelden (1231-1233) ausgestellt. Darin gewährt der Bischof den Schwestern die Wahl des Priesters der Pfarrkirche und auch die Einkünfte der Kirche, damit das Kloster mit notwendigsten ausgestattet werden kann.
Bereits 1233 oder 1234 wurde das Kloster dem Zisterienserorden inkorporiert.
In Gutenzell hatten um 1230 zwei Schwestern um 1230 ein Kloster gegründet.
Abt Eberhard setzte Mechthildis von Aichheim zur Äbtissin ein, die als 1. Äbtissin in der Abtsliste geführt wird. 1238 bestätigte Papst Gregor IX. (1227-1241) die Inkorporierung Gutenzells in den Zisterzienserorden. Gleichzeitig nahm er das Kloster in seinen Schutz.
Im Gegensatz zu den sonstigen oberschwäbischen Zisterzienserinnengründungen nahm Gutenzell nur Adlige auf.
In Seefelden am Bodensee lebte 1237 eine Frauengemeinschaft
unter geistlicher Aufsicht und Leitung von Eberhard von Rohrdorfe in klösterlicher Gemeinschaft
nach der Regel der Zisterzienser. Dann wurde das Kloster nach Boos bei Saulgau verlegt.
1231 hatten hier Mengener Beginen von dem Edelfreien Adelbert von Bittelschieß und seinen Söhnen für 48 Mark Silber, das sind ungefähr 30.339,00 €,
ein Gut mit Kirche gekauft. Wohl ebenfalls auf Abt Eberhards Betreiben bestätigte im Jahr 1236 Papst Gregor IX. (1227-1241) die Gründung der jungen Gemeinschaft als Zisterzienserkloster Boos und nahm sie unter seinen Schutz..Im selben Jahr erhalten die Äbte von Tennenbach Rudolf I. von Zähringen (1226–1256) und Wettingen Konrad (1227-1256) den Auftrag, das finanziell schlecht gestellte Kloster in Augenschein zu nehmen, es dem Orden anzugliedern und Salem zu unterstellen. Das
Votum der Äbte fiel allerdings nicht sehr günstig aus.
Dann erwarb der Reichsprokurator für Schwaben, Schenk Konrad von Winterstetten († wahrscheinlich 1242/43) von den Grafen Bertold und Konrad von Heiligenberg den Weiler Baindt mit dem Patronatsrecht der örtlichen Pfarrkirche als Platz für das wenige Jahre zuvor in Boos errichtete Zisterzienserinnenkloster. Auch hier war Abt -Eberhard vermittelnd tätig.
!240 wurde Baindt in den Zisterzienserorden aufgenommen.
Neben den oberschwäbischen Zisterzienserinnenklöster nahm Salem auch das Patronatsrecht für Kloster Feldbach beim thurgauischen Städtchen Steckborn wahr. Feldbach wurde 1253/54 von 20 nichtregulierten Konstanzer Schwestern besiedelt und 1260/61 in den Zisterzienserorden inkorporiert . Salem übte die Paternität aus.
Kloster Kalchrain in der thurgauischen Gemeinde Hüttwilen wurde zwischen 1324 und 1331 gegründet. Vaterabt war bis 1603 der Abt von Salem, dann der Abt von Wettingn. Das Kloster wurde 1848 aufgehoben.
Abt Eberhard trat 1240 wohl alters- und krankheitsbedingt zurück.
Nach der Klosterüberlieferung verstarb er am 10. Juni 1245. Da er nur kurze Zeit in Salem wirkte, prägte er die dortige Mönchsgemeinschaft kaum.Sein Nachfolger wurde
Auf ihn folgte Berthold von Urach. Er war der Sohn von Graf Eginos IV. von Urach (1180–1230), Bruder des Grafen Egino V. (1230–1236/37) und des Zisterzienserabts, Kardinalbischofs und Kardinallegaten Konrad von Urach (†1227). Konrad war ab 1217 Abt von Citeaux und damit Generalabt der Zisterzienser.
Seinen Bruder Berthold förderte er nach Kräften.
Dieser war von 1207 – 1221 Abt von Kloster Tennenbach
. Von 1221-1224 ist er als Abt von Lützel bezeugt. Dort trat er 1224 zurück.
1240-1241 war er dann Abt von Kloster Salem, Da er nur zwei Jahre in Salem wirkte, prägte er die dortige Mönchsgemeinschaft kaum.
Sein Nachfolger wurde Abt Eberhard II. von Wollmatingen (1241–1276).
Er erhielt am 6. Oktober 1241 , also schon kurz nach Regierungsantritt eine Urkunde vom letzten Stauferkönig Konrad IV. (1237-1254) in der er sich auf Satzungen seines Vaters Friedrich II. bezieht, dass
sie hörige Leute des Klosters Salem, die sich in den Städten finden möchten, auf Verlangen des Abts herausgeben und künftig nicht zu Bürgern aufnehmen sollen. (Generallandesarchiv Karlsruhe D Nr. 67)
Eine letzte Stauferurkunde stellt Konradin (Herzog von Schwaben 1254-168) Am 8. Juli 1264 schenkte dieser Kloster Salem Fischereien an angegebenen Orten bis zum Bodensee. (Generallandesarchiv Karlsruhe D Nr. 69)
Konradin wurde am † 29. Oktober 1268 in Neapel hingerichet.
Schon mit dem Tod Friedrichs II. 1250 und dem Tod Konrads IV.1254 fiel der Rückhalt der Staufer für Kloster Salem weg.
Dass die Zeiten für Kloster Salem rauer geworden waren, zeigt sich auch in einigen Papsturkunden.
So ermahnte Papst Innozenz IV. am 12. Mai 1250 den Bischof von Konstanz Eberhard II. von Waldburg (1248 –1274 ) , das Kloster Salem in dessen Privilegien und Freiheiten zu schützen. (Generallandesarchiv Karlsruhe E Nr. 131)
Am 18. Januar 1258 bestätigte Papst Alexander IV- (1254-1261) Kloster Salem die Privilegien und Indulgenzen, das ist der Nachlass zeitlicher Sündenstrafen und verwies auf “mancher demselben in letzter Zeit widerfahrenen Unbilden”.
(Generallandesarchiv Karlsruhe E Nr. 233)
Benachbarte Adlige nutzten im Interregnum die Gunst der Stunde und griffen das Kloster an. Das Kloster erlitt Verluste und musste sich verschulden.
Erst die Wahl Rudolfs von Habsburg am 1.Oktober 1273 zu deutschen König beendete das Interregnum. Geordnete Zustände und Rechtssicherheit kehrten zurück.
Die Reichsvogtei nahm nun die neugeschaffene Vogtei Schwaben war.
Rudolf stellte einige Urkunden für Salem aus. 1274 bestätigte er auf Bitten der Grafen von Heiligenberg die Schenkungen,, die ihr Vater dem Kloster Salem gemacht hatte. Rudolf – RI VI,1 n. 294
Am 4. November 1274 befahl er den Bürgern von Esslingen Kloster Salem von Abgaben zu bewahren, wie das schon vor der Absetzung von Friedrich II. gegolten hat. Rudolf – RI VI,1 n. 253
Rudolf von Habsburg unterstützte Kloster Salem, da die Reichsklöster eine wichtige Rolle in seinem Vorhaben spielten, das Herzogtum Schwaben wieder herzustellen.
Für Salem war die Verbindung zu den Habsburgern die Möglichkeit, das Überleben zu sichern, ja zu alter Größe zurück zu finden.
Abt Eberhard II. resignierte im Jahr 1276.
Er starb 1284 in Kloster Salem.
Auf ihn folgte Abt Ulrich I. Gräter (1276–1282 )
Im Oberbadischen Geschlechterbuch von Kindler von Knobloch, Heidelberg 1898, Bd. 1 wird Ulrich 1264 als Mönch in Kloster Salem genannt und ab 1277 als Abt.
Die Familie Gräter wird dort als altes Geschlecht in der Reichsstadt Biberach bezeichnet S. 464.Er regierte nur 6 Jahre. Er war ein guter Haushälter und konnte wieder 1200 Mark Silber, das sind etwa 258.448.—€
an Klosterschulden abtragen, de in der Zeit des Interregnums entstanden waren.
Unter Abt Eberhard II. und Ulrich I. gelangte Kloster Salem nicht nur weitgehend wieder in seinen alten Besitz.
Abt Ulrich erwarb auch wieder neuen Besitz und er erhielt das Patronatsrecht der Kirche von Herzogenweiler, heute der kleinste Ortsteil von Villingen-Schwenningen, die der Konstanzer Bischof Rudolf II. von Habsburg-Laufenburg (1274 ´-1293 )
Kloster Salem inkorporierte.
Abt Ulrich verstarb am 6. Juli 1282 an Wassersucht.
Sein Nachfolger wurde Abt Ulrich II. von Seelfingen (1282-1311).
Er war nach Eberhard der zweite bedeutende Abt von Salem. Er arrondierte den Klosterbesitz.
Der Konvent war unter ihm beträchtlich angewachsen mit Mönchen und Konversen zusammen lebten 310 Menschen im Kloster.
Abt Ulrich ließ deshalb die alte Klosterkirche abreissen. Das unter ihm begonnene Münster zählt zu den richtungsweisenden Bauten der Hochgotik im deutschen Südwesten und zeichnet sich durch seine neuartigen Raumbildungen, die qualitätvolle Bauskulptur und die innovativen Maßwerkfigurationen aus. Der Bau wurde überwiegend von eigenen Klosterangehörigen geschaffen. Es gab in Salem keine eigene Bauhütte.
Neben dem Münster wurden viele weitere Bauten in Angriff genommen. So wurde das gesamte Kloster von einer Mauer umgeben. Im Osten wurden ein hoher Wall und Schutzwerke errichtet.
Eine große Scheuer und Stallungen wurden errichtet, ein Speicher für den Ökonomiebedarf, ein Pferdestall und eine Mühle wurde gebaut.
Im Klosterbereich gab es besondere Wohn-und Arbeitshäuser für, Maler, Schneider und Kürschner sowie für Glaskünstler. Da Kranken-und Siechenhaus wurde vergrößert.
Ein Betsaal kam dazu und für den Küster wurde eine eigenes Mesnerhaus gebaut. In 18 Jahren wurde das alles fertiggestellt.
Aber auch der Kirchenschatz, die Bibliothek und die Kunstsammlung wurden vergrößert.
1302 stiftete König Albrecht I. (1298-1308) Kloster Königsbronn, heute im Landkreis Heidenheim, als eines der letzten Zisterzienserklöster im mittelalterlichen Deutschland.
Es wurde von Mönchen aus Salem besiedelt. 1552 wurde es von Truppen des Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach, Albrecht Alcibiades Abt Konrad von Ensingen (1311- niedergebrannt und völlig dem Erdboden gleichgemacht.
Im Bodensseraum und in Oberschwaben wurden viele Güter erworben.
Im Bodensee und am Rhein wurden für 193 Mark Silber, das sind etwa 41.567,00 €, erworben Fischereirechte erworben.
1307 war das Münster soweit fertiggestellt, dass es mit 11 Altären versehen zum Gottesdienst gebraucht werden konnte.
Der Bischof von Eichstätt Philipp von Rathsamhausen (1306 –1322), vorher Abt im Zisterzienserkloster in Pairis, nahm die Weihe vor.
Am 3. April 1282 bestätigte Papst Honorius IV. (1285-1287) Kloster Salem dessen Freiheiten, Immunitäten und Exemtionen. Generallandesarchiv Karlsruhe E Nr. 289
Am 18. April 1302 bestätigte Pfalzgraf bei Rhein Rudolf I. (1294-1317) Kloster Salem von seinen Vorfahren bewilligte Zollfreiheit an allen Mauten seines Landes für Salz, Wachs und Feile. Rudolf I. – RIplus Regg. Pfalzgrafen 1 n. 1475
Am 10. Juni 1309 billigte, erneuerte und bekräftigte König Heinrich VII. (1308-1312 König, dann bis zu seinem Tod 1313 Kaiser) verschiedene Privilegien, die Kloster Salem bis dahin erhalten hatte. Heinrich VII. – RI VI,4,1 n. 185
Am 12. Juli 1309 befreite König Heinrich VII. das Haus, das Kloster Salem in Ulm besaß, von allen Diensten und Abgaben. Heinrich VII. – RI VI,4,1 n. 217
Abt Ulrich II. verstarb am 20. Juni 1313.
Auf ihn folgte Abt Konrad von Ensingen (1311-1337) Er stammte aus dem Niederadel.
Er war ein Studienkollege des späteren Papstes Benedikt XII. (1334-1342) am Collège St. Bernard in Paris, wo er Theologie studierte.
1311 wurde er Abt von Kloster Salem. Er war sehr gastfreundlich und freigiebig, aber auch sehr ehrgeizig.
Von 1337 bis 1338 schrieb ein Salemer Mönch den “Traktat über den Zustand des Klosters Salem von 1134-1337” Das als “Chronik von Salmannsweiler bezeichnete Geschichtswerk ist ein Lobgesang auf die “gute alte Zeit”
und eine unbarmherzige Kritik an Abt Konrad von Enslingen. Seinem Lebensstil sei es zu zu schreiben, dass in Kloster Salem weltliches Denken und Verhalten Platz ergriff.
Er haben sich einen kostbaren Abtspalast errichten lassen, zum Schaden des Konvents seine adlige Verwandtschaft begünstigt und einen aufwendigen Reit-und Pferdeluxus betrieben.
Eklatante Regelvergessenheit habe den Salemer Konvent um seien Anziehungskraft gebracht und die Zahl der Mönche und Konversen sei deutlich geschrumpft.
Aber auch bei Franz Xaver Conrad Staiger Salem oder Salmannsweiler, Salem 1863 kommt Abt Konrad nicht besonders gut weg. Er war zu nachsichtig, zu gut. Er verstand es nicht die Zügel in der Hand zu halten.
Die Folge: Klosterordnung und Zucht lockerten sich.
Abt Konrad war aber auch Beichtvater von König Friedrich dem Schönen (1314-1330) und setzte ihn mehrfach als Gesandten ein. In Friedrichs Auftrag reiste er mehrmals an den päpstlichen Hof nach Avignon.
Seine Tätigkeit schlug sich auch in Urkunden nieder. Am 18. April 1315 bestätigte er nach dem Vorbild seiner Vorgänger Albrecht und Heinrich inserierte Privilegien. Friedrich der Schöne – [Regesta Habsburgica 3] n. 189
Nur 4 Tage später bestätigte er alle Privilegien Kloster Salems. Friedrich der Schöne – [Regesta Habsburgica 3] n. 192
In der Folgewoche verlieh er das dem Reich zustehende Patronatsrecht über die Kirche in Pfullingen. Friedrich der Schöne – [Regesta Habsburgica 3] n. 193. Dafür sollten Messen für seien Vorgänger Rudolf und Albrecht
sowie für seine Mutter Elisabeth von Görz und Tirol (*um 1250-1313) gelesen werden.
Auch Ludwig IV. (1314-1328, dann Kaiser-1347), der seit 1314 zusammen mit Friedrich dem Schönen als König regierte, stellte Kloster Salem eine Urkunde aus. Er bestätigte am
2. Dezember 1322 die Maut-und Zollfreiheit von Kloster Salem in Bayern und nahm das Kloster in seinen Schutz. Ludwig – [RI VII] H. 2 n. 42
Nach der strittigen Königswahl von 1314 stand Kloster Salem fest auf der Seite Habsburgs. Während der Herrschaft Ludwigs IV. war Kloster Salem ganz auf Eigenschutz angewiesen.
Benachbarte Adlige boten Salem zwar immer wieder an, die Vogtei zu übernehmen. Das war aber immer mit Besitz-und Herrschaftsansprüchen verbunden. So lehnte das Kloster die
Vogteiangebote immer ab. Besonders hartnäckig waren die benachbarten Grafen von Heiligenberg,
Anfang 1337 reiste Abt Konrad nach Avignon, um dort Papst Benedikt zu treffen. Aber noch auf dem Gebiet der Konstanzer Diözese wurde er von Wegelagerern gefangengenommen und seiner Habe beraubt.
Auf dem Gebiet der Churer Diözese wurde er sechs Wochen in Kerkerhaft gehalten und erst nach erzwungenem Eid auf Straffreiheit freigelassen.
Papst Benedikt forderte nun den Konstanzer Bischof Nikolaus von Frauenfeld (1334 –1344 ) und den Bischof von Chur Ulrich V. von Lenzburg (1331–1355 ) zur Befreiung Konrads und zu Wiedergewinnung seines Gutes das
ihrige zu tun. Es ist nicht klar, ob Konrad nach Avignon weiter reiste oder nach Salem zurückkehrte.
Am 5. August 1337 starb der Bischof von Gurk Lorenz I. von Brunne (1334–1337) in Avignon. Das Bistum war dem Papst zur Wiederbesetzung reserviert. Er ernannte Abt Konrad zum Bischof von Gurk,
Abt Konrad reiste nun mit großem Gefolge nach Avignon, fiel aber zum zweiten Mal Wegelagerern zum Opfer. Er wurde verletzt und wieder ausgeraubt. In Martigny wurde er gefangen gehalten, konnte aber von dort entkommen.
Durch diese Umstände verzögerte sich die Weihe Konrads zum Bischof von Gurk, die Papst Benedikt am 28. April 1338 selbst vornahm
(Kassian Haid in Cistercienser-Chronik 1907, S. 353 ff. Die Reiseabenteuer des Abtes von Salem und nachherigen Bischofs von Gurk, Konrad von Enslingen)
Abt Konrad war in Salem 1337 zurückgetreten. Die Besetzung des Salemer Abtsstuhl stand nun dem Papst zu.
Aus der Zeit Konrads stammt das “Handbüchlein des Pfisters zu Salem” im Generallandesarchiv Karlsruhe mit dem Archivtitel “Handbüchlein des Pfisters 1341-42”
Diese Bezeichnung wurde ihm wohl erst im 19. Jahrhundert bei der Übersiedlung der Archivunterlagen nach Karlsruhe gegeben.
Aber 120 verfasste Stephan von Lexington, Abt von Kloster Savigny (1229–1243) und Clairvaux (1243–1256) eine Wirtschaftsordnung für Kloster Savigny um der Misswirtschaft zu begegnen.
Zu Beginn eines Jahres wurde festgelegt, wie viel Getreide jeweils zum Brotbacken und Bierbrauen gebraucht wurde.
Zweimal pro Jahr wurde der Gesamtvorrat des Hauses überprüft und zwar in Bezug auf Nahrungsmittel, Stoffe und Arbeitsgeräte.
Diese regelmäßige Kontrolle wurde auf allen von Mönchen geleitetet Klosterämtern durchgeführt. Genauso aber wurden die auf den Grangien arbeitenden Konversen überprüft. Diese mussten regelmäßig Rechnung erstellen.
Es sollten möglichst keine Verluste entstehen, sei es bei der Ablieferung von Naturalien, durch falsches Maß und Gewicht, sei es durch Diebstahl beim Transport von der Grangie zum Kloster oder zum Markt.
Einmal pro Jahr, meist im Herbst musste dem Abt eine Gesamtrechnung vorgelegt werden, bei der eine Kosten-Nutzenanalyse angestellt werden musste.
Das Generalkapitel legte fest, dass alle Zisterzienserklöster solche Wirtschaftsordnungen führen mussten
Das Handbuch des Pfisters scheint wahllos zusammengestellt zu sein, was möglicherweise daran liegt, dass bei der Neubindung viele Seiten verloren gegangen sein könnten.
Es kann auch sein, das das Handbuch eine Art Notizbuch für den im Amt befindlichen Pfister war und als eine Art Gebrauchsanweisung oder Arbeitsanleitung war.
Anzumerken bleibt zum Schluss noch,dass 1320 ein Mönch Otto Gräter, auch aus der Familie von Abt Ulrich I. Gräter stammend in Kloster Salem vermerkt ist, der 1388 Pfister in Salem war und 1318 ein Johannes Gräter aus der Biberacher Familie, der Großkeller und Pfister war. (Knobloch I, S.464)
Als Konrad von Enslingen Bischof von Gurk wurde, ernannte Papst Benedikt Ulrich III. von Werdenberg-Sargans (1337–1358 ) zum Abt von Salem.
Aber der Konvent hatte ihn auch schon zum Abt gewählt. Er war vermutlich ein unehelicher Sohn des Grafen Rudolf II. von Werdenberg-Sargans. Er hatte vielleicht 1313 in Bologna studiert . 1329 war er Domherr in Chur und schon am 7. März 1330 Advokat der Kurie Konstanz.
Am 16, Juni 1338 erscheint er als Prior von Kloster Salem.
Gleich zu seinem Regierungsantritt mühte er sich, die klösterliche Zucht wieder herzustellen.
Die politische Situation war schwierig. Zum einen hatte man sich nicht auf einen König verständigen können. Zwischen 1325-1327 einigte man sich auf eine Doppelherrschaft von Friedrich dem Schönen und Ludwig IV.
Zum andern gab es die Auseinandersetzung zwischen Papst Johannes XXII. (1316-1334) und Ludwig IV. Der Konflikt entzündete sich am Anspruch des Papstes, dass erst ein erst ein vom Papst anerkannter römischer König Herrschaftsrechte ausüben könne. Der Papst exkommunizierte
am 23. März 1324. Der König ließ sich nicht einschüchtern und hielt dagegen. Der Papst dürfe nicht über die Befugnisse des Königs urteilen, wenn schon, dann müsse das ein Konzil tun.
Ludwig brach im Januar1327 zum Zug nach Italien auf und ließ sich am 17. Januar 1328 ließ er sich ohne Mitwirkung des m Kaiser krönen. Am 18. April 1328 ließ der Kaiser den Papst absetzen.
Da Salem sowohl auf der Seite des Papstes als auch der Habsburger stand, bedeutete die Regentschaft Ludwigs für das Kloster neue Angriffe, Schäden und Schulden.
Nach Staiger tötete Graf Gottfried von Wartenstein salemische Gotteshausleute in Lausheim, heute ein Teilort von Ostrach und Schemmerberg und hauste dort mit “Feuer und Schwert” (S. 107)
1347 ging zudem die Pest um. Aber selbst nach dem Pestjahr hatte Kloster Salem immer noch 100 Mönche und 80 Konversen.
Karl IV. wurde am 11. Juli 1346 in Rhens von den drei Erzbischöfen von Mainz, Köln und Trier sowie mit der sächsischen und böhmischen Stimme gewählt und am 26. November „am falschen Ort“ – in der Bonner Münsterbasilika – zum König gekrönt.
Kaiser Ludwig starb am 11. Oktober 1347 in Puch bei München.
Die Lage besserte sich nun auch für Kloster Salem wieder. Nicht sofort, denn König König Karl IV. versuchte 1347 sogar das Kloster vollständig den Heiligenbergern zu überschreiben. Am 2. Dezember 1347 übertrug er die Vogteiüber Kloster Salem
an den Grafen Albrecht von Heiligenberg ( + um 1365) Karl IV. – RI VIII n. 6490 musste diesen Schritt jedoch nach Protest aus Salem im folgenden Jahr rückgängig machen.
Am 30. Januar widerrief er diese Urkunde in Ulm “weil er erfahren, daß dies sowohl dem Reiche als auch dem Kloster schädlich ist. Er setzt daher fest , dass die darüber gegebenen Urkunden . ungültig sein sollen und kraft dieser Urkunde. widerrufen werden.
Karl IV. – RIplus URH 6 n. 29 Am 1.Februar stellte er eine weitere Urkunde aus, in der er erklärte, dass Kloster Salem keinen anderen Schutzherren habe als den König. Karl IV. Nachträge. – RI VIII n. 5991
Karl IV. nahm sogar nicht nur diese Überschreibung an das Haus Heiligenberg zurück, sondern garantierte Salem noch weitere Privilegien: Zunächst eine Urkunde, die sich direkt gegen die Grafen von Heiligenberg richtete Karl IV. – RI VIII n. 6737.
Darin heißt es, dass “dass die grafen von Heiligenberg das Kloster Salem verderben und beschädigen”
Eine Urkunde von 1354 verpflichtete die umliegenden Städte und den Adel zum Schutz des Klosters und gewährte diesem die niedere Gerichtsbarkeit über seine Bürger, womit sein Status als Reichsstift abgesichert blieb.
Abt Ulrich III. verstarb am 10. Februar 1358.
Als in Kloster Wettingen Abt Sitti (1343–1351) am 17. Januar 1352 verstorben war, hatte der Konvent dort Johann Murer zu dessen Nachfolger gewählt.
Papst Innozenz VI. (1352-1362) setzte aber den Salemer Mönch Berthold Tutz als Abt in Wettingen ein, wobei die Gründe dafür nicht klar sind.
Nach Will (Chronist von Kloster Wettingen)hatte sich Berthold Tutz sich Berchtold Tutz das Ernennungsdekret vom päpstlichen Stuhl erschlichen. Der Konvent hatte aber nach dem Tod Abt Heinrichs den Konventualen Johann Murer gewählt und diesen
auch vom Mutterabt Ulrich III. von Werdenberg-Sargans (1337–1358 ) von Kloster Salem bestätigen lassen. Allerdings fühlte sich Abt Berthold in Wettingen nicht glücklich und er war dort auch nicht sonderlich erfolgreich.
Als Abt Ulrich in Salem verstarb, nutzte Papst Urban VI( 1378–1389) die Gelegenheit und ernannte den in Wettingen umstrittenen Berthold II. Tutz (1358–1373 (Rücktritt) in Salem eine ruhige und unangefochtene Stellung zu verschaffen.
Die Salemer Mönche hatten ihn auch schon als Abt gewählt.
Abt Berthold hatte Theologie studiert und war vor seiner Wettinger Zeit als Abt Professor. In Salem regierte er glücklicher. Er er warb einiges an Gütern.
1369 wurde die Kapelle Beata Mariae Virginis, die keiner Pfarrkirche unterstand, von Papst Urban V. (1362–1370 ) Kloster Salem inkorporiert.
Am 5. April 1373 resignierte Abt Berthold Tuz
Sein Nachfolger wurde Abt Wilhelm Schrailk (1373-1395) Er wurde aus Kloster Raitenhaslach berufen, wo er von 1367-1373 als Nachfolger von Andreas Pfarrkircher (1364–1367) war.
Dort hat er allerdings keine Spuren hinterlassen. Es gibt keine Urkunden aus seinem Raitenhaslacher Abbatiat.
Papst Gregor . (1370-1378) bestätigte ihn am 11. Mai 1373. Er entband ihn von der Reise an die Kurie und beauftragte Die Bischöfe von Konstanz Heinrich III. von Brandis (1357 –1383 ) und Chur
Friedrich II. von Erdingen (1368–1376 ), ihm den Treueid abzunehmen. Auch in der Folge hatte der Konvent durchgesetzt, dass die von ihm gewählten Äbte vom Papst providiert wurden.
Am 19.Juli 1378 inkorporierte Papst Gregor XI. die Pfarrei Schemmerberg mit Ihren Einkünfte dem Kloster Salem. (Staiger S. 111)
Am 16.10. bestätigte König Wenzel (1376-1400) die von seinem Vater Karl erteilten Privilegien für Salem Wenzel – [RIplus] Regg. Wenzel [n. 760] und nach Staiger auch alle Rechte, Freiheiten und Privilegien des Klosters (S.111)
Am 30. Januar 1384 erteilte Papst Urban VI. (1378-1389) Abt Wilhelm und seinen Nachfolgern das Recht, die Pontifikalien zu tragen, also Inful, Ring und Stab.
1390 kaufte er von Ulrich von Hörningen (um 1400) und seiner Frau, der Schenkin von Ittendorf das Dorf Bermatingen für 7000 Pfund Heller, das sind etwa721000 €, mit Leuten,Gut,Gericht, Bann, Vogtrecht und allem was dazu gehört.
samt der Kirche mit Patronatsrecht. Mit Genehmigung von Papst Bonifaz IX. (1389-1404) inkorporierte sie der Konstanzer Bischof Burkard I. von Hewen (1387 –1398 ) 1391 dem Kloster Salem.
Abt Wilhelm verstarb am 21. Mai 1395.
Auf ihn folgte Abt Jodok I. Senner (1395–1417 (Rücktritt) . Er stammte aus einem alten Ravensburger Bürgergeschlecht.
In Salem war er Großkeller.
Am 15. Juni 1395 wurde er einstimmig zum Abt gewählt.Der Konvent zählte 100 Konventuale und etwa 80 Konversen.
Am 15. August 1401 bestätigte König Ruprecht I. 1400-1410) Kloster Salem seine Privilegien und Freiheiten. Pfalzgraf Ruprecht III. – [Regg. Pfalzgrafen 2] n. 1479.
Am 21. Juni 1403 befahl König Ruprecht den Reichsstädten Konstanz, Ulm, Esslingen, Reutlingen, Überlingen, Ravensburg, Rottweil, Biberach und Pfullendorf den Abt und Konvent des Klosters Salmansweiler von Reichs wegen zu schirmen und zu handhaben vor unrechter Gewalt.
Pfalzgraf Ruprecht III. – [Regg. Pfalzgrafen 2] n. 3014
14 11 bestieg Sigmund (1411-1419 König, dann Kaiser bis 1437) den deutschen Thron. Am 22. August 1413 bestätigte er die Urkunden Karls IV. und Wenzels für Salem. Sigmund – RI XI,1 n. 648
Abt Jodok setzte den Bau des Münsters fast bis zur Vollendung fort.
Auf Betreiben König Sigmunds wurde das Konzil in Konstanz einberufen, dass am 5. November 1414 begann.
Abt Jodok nutzte die Anwesenheit des Salzburger Erzbischofs Eberhard III, (1406-1427) auf dem Konstanzer Konzil diesen einzuladen die Weihe vorzunehmen. Sa sein Amtsvorgänger Eberhard II.Kloster Salem rund 200 Jahre vorher
in Schutz genommen hatte, sahen das wohl beide Seiten als guten Anlass an.
Die Kirchweihe fand am 23. Dezember 1414 statt. Es gilt als wahrscheinlich, dass auch König Sigmund daran teilgenommen hat, den dieser übernachtete am Vorabend in Überlingen und traf am 24. Dezember auf dem Konzil ein.
Mit Salem als Vorreiter hat die gotische Baukunst ihren Weg von Straßburg an den Bodensee gefunden. Fast gleichzeitig ließ das Bistum Konstanz das dortige Münster in gotischem Stil modernisieren.
Abt Jodok resignierte am 12. Mai 1417. Die Gründe sind nicht bekannt. Er starb am 16. Januar 1420.
Auf ihn folgte Abt Petrus I. Ochsner (1417–1441 ) Er stammte aus der Familie der Ochsner in Ravensburg
Er verwaltete das Amt des Großkellers in Salem.
Er wurde am 12. Mai 1217 einstimmig zum Abt gewählt.
Dem Konstanzer Konzil wohnte er bis zum Ende bei.
Er vollendete den Bau des Salemer Münsters und schmückte ihn aus.
Papst Martin V. (1417-1431) gestattete das Fest der Kirchweih in Salem, die ja direkt vor Weihnachten stattgefunden hatte, am Sonntag vor Mariä Geburt zu feiern.
Am 4. Dezember 1433 bestätigte Kaiser Sigmund alle Privilegien von Kloster Salem und nahm es in en Schutz des Reiches. Sigmund – RI XI,2 n. 9853
Am 26. Februar 1434 erlaubte Kaiser Sigmund Kloster Salem in seinem Dorf Unterelchingen Gericht über Erbschaftsstreitigkeiten, Geldschulden und Unzucht zu halten
und das Gericht zu besetzen. Sigmund – RI XI,2 n. 10093
Am 21. März 1434 befreite Kaiser Sigmund das Kloster von allen durch Reichsgesetz vorgeschriebenen Dienstleistungen, Steuern u. Einquartierungen. Sigmund – RI XI,2 n. 10171
Abt Peter vermehrte den Ruf von Kloster Salem und auch den Wohlstand.
Er starb plötzlich am ganz plötzlich am 19. Mai 1441.
Zu seinem Nachfolger wurde Abt Georg I. Münch (1441–1458 (Rücktritt) aus Konstanz unter dem Vorsitz von Abt Conrad Holzacker (Holziker) (1409–1443Von Kloster Lützel gewählt.
gewählt . Er entstammte einer reichen Konstanzer Bürgerfamilie.
Er befolgte die Klosterregeln streng weil er seinen Mönchen einfach Vorbild sein wollte
Er errichtete 1441 eine größere Orgel im Salemer Münster, deren größte Pfeife nach Staiger (S.117)28 Fuß, das entspricht 826 Zentimeter, lang gewesen sein soll.
Im Zusammenhang mit Abt Georg steht auch die Anekdote vom Salemer Fass. Auf seine Veranlassung soll das Fass errichtet worden sein
und eine Füllmenge von rund 40 Fuder (= 60.000 l) aufgewiesen haben soll. Stets mit den besten Weinen befüllt, schöpfte man nur an hohen Festtagen aus diesem Fass und der Kellermeister trug die Kellerschlüssel stets achtsam bei sich. Als er jedoch einmal fest eingeschlafen war, stibitzte ihm ein besonders trinklustiger Mönch den Schlüssel. Nach der Abendmesse schlich der Mönch sich oft in den Weinkeller und schöpfte aus dem Fass, bis eines Abends der Kellermeister den Zapfhahn ausgetauscht hatte. Also stellte der durstige Mönch eine Leiter auf, stieg auf das Fass und öffnete die Tür des riesigen Spundlochs. Er trank gierig so viel Wein, dass ihm schwindlig wurde, er in das Fass hineinfiel und dort ertrank. Als der Kellermeister mit einer Stange den Füllstand des Fasses prüfen wollte, stieß er auf den Körper des ertrunkenen Mönchs. Der Kellermeister erzählte nichts von seinem Fund, da er befürchtete, der Wein könnte durch den Leichnam bei seinen Mitbrüdern als verunreinigt gelten. Daher zog er den ersoffenen Trunkenbold aus dem Fass und begrub ihn heimlich bei Nacht. Erst kurz vor seinem Tod gestand der Kellermeister sein Vergehen, starb aber, ehe er das heimliche Grab verraten konnte.
Zurück zu den Fakten.
Am 19. Juli 1442 bestätigte König Friedrich III. (1440.1452 König, dann bis 1493 Kaiser) auf Bitten Abt Georgs die Rechte und Privilegien von Kloster Salem und nahm Kloster und Konvent in seinen besonderen Schutz. Friedrich III. – [RI XIII] H. 37 n. 54
Am 14. August n1442 erließ er in Frankfurt die Reformation Friedrichs III, das war ein Reichslandfriede und enthielt Bestimmungen zum Fehderecht, auch über den Schutz von Geistlichen, von Kirchen.
Für Kloster Salem war das auch interessant, denn es gab ihm mehr Sicherheit in seinen Rechten und Besitzungen.
Am 17, Februar 1448 schloss Friedrich III mit Papst Nikolaus V. (1447-1455) das sogenannte Wiener Konkordat .Friedrich III. – [RI XIII] H. 13 n. 60
Es regelte vor allem die Rechte des Papstes bei der Pfründenbesetzung. Für Bistümer und exemte Klöster forderte es die päpstliche Bestätigung von Wahlen. Ferner erlaubte es dem Papst, Koadjutoren zu bestellen und Postulationen vorzunehmen.
Am 10. März 1454 gestattete Papst Nikolaus Abt Georg und seinen Nachfolgern seinen jungen Priestern die vier niederen Weihen zu erteilen. In untergebenen Klöstern durfte er die Subdiakonatswürde erteilen.
Auch durfte er entweihte Kirchen, Friedhöfe und andere Orte wieder weihen.
Im November 1455 leitete er als Vaterabt die Wahl von Johann Wagner als Abt von Wettingen.
Abt Georg resignierte 1458 und starb am 21, Februar 1479
Sein Nachfolger wurde Abt Ludwig Oschwalt (1458–1471)
Er stammte aus Überlingen. Er hatte in Paris studiert und dort mit dem Doktor abgeschlossen.
1459 stifteten Berthold von Stein und Ulrich von Schynen in Ingerkingen im Kreis Biberach eine Kaplanei. Ingerkingen gehörte zur Pfarrei Schemmerberg. Abt Ludwig genehmigte die Stiftung, behielt sich aber das Patronat und die Administration der Kaplanei-Güter vor.
Albrecht( (1453-1463) Erzherzog von Österreich schenkte Kloster Salem 1461 die Hälfte des Kirchensatzes von Griesingen, heute Alb-Donau Kreis, mit der Verpflichtung eines Jahrtages für sich und sein Haus.
Einige adlige Salemer Mönche verließen ohne Erlaubnis des Abtes das Kloster, begaben sich irgendwo hin und “führten nicht das beste Leben” (Staiger S. 121). Um die klösterliche Zucht und Ordnung aufrecht zu halten, erteilte Papst Paul II. (1464-1471)
am 4. Februar 1467 die Erlaubnis, solche plichtvergessene Mönche gefangen zu nehmen, sie ins Kloster zurückzubringenund mit verdienten Bußen zu bestrafen.
In Kloster Heggbach führte Äbtissin Elisabeth Kröhl (1454-1480) 1467 eine Konventsreform durch und führte mit nachdrücklicher Hilfe des Vaterabtes Ludwig die Klausur wieder ein.
Abt Ulrich kaufte mit Zustimmung des Konvents 1469 für 3.800 fl., das sind etwa 1.040.571,00 € das Dorf Äpfingen im Kreis Biberach.
Abt Ludwig resignierte wegen Krankheit 1471 und starb im selben Jahr.
Auf ihn folgte Abt Johannes I. Stantenat (1471–1494 )
Er stammte aus dem elsässischen Uffholtz. Erstmals ist er in der Verwaltung des Zisterzienserinnenklosters Rheintal belegt. In Lützel war Johannes Prior.1466 wurde er zum Abt erwählt, wo er allerdings nur wenige Jahre wirkte.
Er schloss gleich nach Regierungsantritt schloss er mit der Stadt Biberach wegen Umgeld, Zoll und Bürgerrecht der salemischen Gütern in Äpfingen, Baltringen, Brunnen ,und Aigendorf (heute Attenweiler Landkreis Biberach). (Staiger S. 122)
Ende des 15. Jahrhunderts versuchte Kloster Salem die Rechtsstellung der Untertanen zu verschlechtern. Dies lehnten sich dagegen auf. Eine Schiedskommission legte die Streitigkeiten bei.
Die Wissenschaft bezeichnet diese Verträge als Agrarverfassungsverträge, die Beziehungen zwischen Grundherren, in dem Fall den Klöstern und den Untertanen regelte.
Sie regelten de dinglichen und personalen Rechte und Pflichten gegenüber dem Kloster fest. Solche Verträge gab es z. B.in Salem 1473, Ochsenhausen 1502, Steingaden, Rot an der Rot , Ottobeuren und Weingarten.
Für Ochsenhausen, Weingarten und Salem hatte das die Spätfolge, dass sie im Bauernkrieg von Plünderungen weitgehend verschont blieben und nicht in Flammen aufgingen.
Am 14. August schloss Graf Eberhard VÍ. (1480-1498) von Württemberg mit Koster Salem wegen der salemischen Gütern in Württemberg, also den Pflegen Nürtingen und Esslingen
auch der Zollbefreiung von Salem für Wein und Korn. Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 135 Bü 6, 7
Salem war immer wider Gastgeber für Kaiser und Könige. So am 20. August 1485. Da kam Kaiser Friedrich III. mit 400 Pferden (Staiger S. 123) nach Salem zu Besuch.
Am 5. Mai 1486 wurde in Kloster Wettingen unter Vorsitz von Abt Johannes Johann V. Müller (1486–1521) zum Wettinger Abt gewählt.
Die Besuche zahlten sich aus. Am 26. Mai 1487 bestätigt Friedrich III. dem Kloster in drei Urkunden den Status einer Reichsabtei. Friedrich III. – [RI XIII] H. 15 n. 400 , Friedrich III. – [RI XIII] H. 37 n. 675 und Friedrich III. – [RI XIII] H. 37 n. 676
Diese Freibriefe gestatteten dem Kloster von seinen Untertanen Steuern zu erheben und säumige Zahler selbst zu bestrafen. Zusätzlich durfte Salem nun seinen Schutzvogt selbst wählen und wieder absetzen. Damit hatte Salem die volle Reichsunmittelbarkeit mit den meisten Privilegien eines Reichsstands erlangt. Das Kloster hatte jetzt die größtmögliche Autonomie erreicht.
Eine Reihe von Papstbullen im 15. und 16. Jahrhundert nahmen das Kloster ganz aus der Gewalt und dem Territorium des Bischofs von Konstanz heraus. Es war in vollem Umfang exemt und eine gefreite Abtei geworden.
Nicht nur für die politische Stellung des Klosters leistete Abt Johannes Beachtliches.
1493/94 gab er das Salemer Abtbrevier für den persönlichen Gebrauch in Auftrag. Im Nachwort nennt sich ein Scheiber Amandus Schäffler. Er Er berichtet, dass er 1493 von einem Kloster aus einem Vorort Straßburgs nach Salem flüchtete und dieses Brevier mit eigener Hand unentgeltlich als Dank für sein Asyl geschrieben habe. Johannes Stantenat, der kunstsinnige Abt, habe das bei seinem Tod unfertige Brevier mit verschiedenen geheimnisvollen Figuren und Farben an den Rändern und Initialen illuminieren und sein Nachfolger Johannes Scharpfer habe es für 200 Rheinische Gulden,
das sind etwa 54.300,00 € vollenden lassen. Der Buchschmuck wurde von einem Nürnberger Buchmaler geschaffen.
Zum Sakramentshaus im Münster hat er ebenfalls Aufträge vergeben. Die Steinfiguren am Sakramentenhaus stammen aus der Werkstatt des Hans von Savoi,Mitglied einer verwandtschaftlich mit den Parlern verbundenen Steinmetzfamilie.
Die Holzfigurensind aus der Schnitzwerkstatt des Michael Erhards(1440-1523) aus Ulm. Auch den Tabernakel mit der übergroßen Hostie hat Abt Johannes in Auftrag gegeben.
Außerdem Ließ er er viele Wirtschaftsgebäude bauen.
Auch die Johanneskapelle in Mimmenhausen, einem Teilort von Salem, ließ er erbauen.
Am Juni 1494 bestätigte Maximilian der letzte Ritter (1486-1508 König, dann bis 1519 Kaiser) die Privilegien von Kloster Salem. Maximilian I. – RI XIV,1 n. 773
Abt Johannes starb am 5. Dezember 1494.
Auf ihn folgte Abt Johannes II. Scharpfer (1494–1510 )
Er wurde am 15. Dezember 1494 im Beisein von Abt Ludwig Jäger (1471–1495 ) aus Lützel zum 19. Salemer Abt gewählt.
Er stammte aus Mimmenhausen, heute ein Ortsteil von Salem.
Von den Edlen von Obersulmetingen kaufte er 1496 mit Einwilligung des Konvents den Burgstall Schemmerberg, die Mühle und weitere Gütern für 4000 fl, das sind etwa 1.084.586,00 €.
Damit besaß Kloster Salem das ganze Dorf.
Am 7. Februar gestattete König Maximilian ein Gericht für Erbschafts-,Eigentums-,Schuldsachen und Frevel einzurichten. (Staiger S. 124) 1742 erhielt Salem die hohe Gerichtsbarkeit für Schemmerberg.
Zwischen 1498 und 1515 nahmen die Äbte Johannes und Jodokus bauliche Veränderungen am Esslinger Pfleghof vor. Über den spätromanischen und frühgotischen Baukörpern wurden zwei weitere Geschosse errichtet. Zudem wurde ein Erker an die Westseite des Turms angebaut. Auf dem Erker selbst ist die Jahreszahl 1509 eingemeißelt. Unterhalb des Erkers befinden sich vier Wappenschilde. Diese Wappenschilde zeigen die Wappen des Abtes Johannes II., des Erzbischofs Eberhards II., des Gutram von Adelsreute, als Klosterstifter und das Wappen des heiligen Bernhard von Clairvaux.
Er ließ die Marienkapelle in Kloster Salem einrichten und stattete sie reich aus. Mit dem Meimminger Maler Bernhard Strigel (um 1460-1528), der damals Hofmaler von Maximilian war, schloss er einen Vertrag ab, nach dem der Maler bis zum 16.10. 1507
den Marienaltar zu liefern hatte. Als Bezahlung waren 150 Gulden, das sind ungefähr 122.016,00 € und außerdem 5-6 Wagenladungen mit insgesamt 10.000 Liter Wein.
Eine Bezahlung mit Wein war damals nicht ungewöhnlich.
Auf der rechten Tafel ist auch Maximilian verewigt al Einer der Weisen aus dem Morgenland, eine besondere Huldigung Salems, dem reichsunmittelbaren Kloster, das nur den Kaiser als weltlichen Herrn über sich anerkannte.
Auf die Kapelle ließ er die Bibliothek bauen.
Seit 1470 besuchten die Salemer Äbte den Reichstag regelmäßig.
Der Reichstag von Worms 1495 verabschiedete 4 Reformordnungen nämlich
- Ewiger bzw. unbefristeter Landfrieden
- Ordnung über das Reichskammergericht
- Exekutionsordnung (bekannt als ‚Handhabung Friedens und Rechts‘)
- Ordnung über die auf vier Jahre befristete Erhebung des ‚gemeinen Pfennigs‘
Diese “maximilaneische Reichsreform“ ebnete den Weg zum Reichsregiment, das 1500 auf dem Reichstag von Augsburg verabschiedet wurde.
Dieses setzte sich aus dem Kaiser und 20 Vertretern der Reichsstände zusammen.
!500 und 1521 wurde dazu auch der Abt von Salem berufen.
Die Äbte Johannes II. und Judokus II. waren im Reichsregiment vertreten.
Am 4. Oktober 1510 starb Abt Johannes II.
Sein Nachfolger wurde Jodok II. Necker (1510–1529) als 20. Abt von Salem.
Er stammte aus Überlingen, hatte in Pais studiert und dort seinen Baccalaureus in Naturwissenschaften und Theologie abgeschlossen.
1503 hatte er die Lizenz zur Abhaltung von Vorlesungen über die Heilige Schrift am Collège St. Bernard erhalten.
Kurz nach seinem Regierungsantritt bestätigte Kaiser Maximilian am 10. November 1510 die Rechte und Privilegien von Salem- (Staiger S. 126)
Papst Julius II. (1503-1513) ernannte ihn zusammen mit Abt Franz von Gaisberg (1504–1529) von St. Gallen zum Konservator, Beschützer und Schirmer der Rechte, Privilegien und
Besitzungen von Kloster St. Ulrich und Afra in Kreuzlingen, einem Augustinerchorherrenstift.
1517 erneuerte Papst Leo X. (1513-1521) das Recht von Kloster Salem, zur Benediktion seines Abtes sich einen Bischof zu wählen.
Am 31 Oktober 1517 schlug Martin Luther seine Thesen an der Schlosskirche von Wittenberg an, was wohl eher Legende ist, aber seine Stellung zum Ablasshandel.
Aber die Verbreitung seiner Thesen vor allem über Druck und die anschließenden Diskussionen bringen die Reformation in Gang.
Gegenüber der Reformation zeigte man in Kloster Salem keine Sympathien.
In Salem kam es zu keinem wirtschaftlichen und keinem disziplinarischen Niedergang.
Am 23. Mai 1521 bestätigte Karl V. (1520-2530 König, denn bis 1555 Kaiser) alle Privilegien und Freiheiten und nahm das Kloster in seinen Schutz.
Schon im 13.und 14. Jahrhundert gab es eine Reihe von bäuerlichen Aufständen und Widerstandsaktionen.
Die Standpunkte der Reformation ließen die dörflichen Bevölkerung die mit dem „Willen Gottes“ gerechtfertigten Ansprüche von Adel und Klerus zu hinterfragen. Für die eigene erbärmliche Lage „durch Erbteilung zerstückelte Höfe“ fanden sie keine biblische Begründung.
1524 brachen die Konflikte aus. Die erste Erhebung war im Wutachtal bei Stühlingen.
In der Reichsstadt Memmingen deren Bürgerschaft mit den Bauern sympathisierte, sammelten die drei oberschwäbischen Bauernhaufen. Im Februar/März wurden die 12 Artikel verfasst.
Das waren die Forderungen, die die Bauern gegenüber dem Schwäbischen Bund erhoben.
In Kempten wehrte sich 1523 die Untertanen gegen die Versuche des Abtes , sie weiter in die Leibeigenschaft zu drücken. Mitte Februar befand sich das ganze
Allgäu im Aufstand und bildete am 24. Februar den „Allgäuer Bund“.
Im nördlichen Oberschwaben berieten seit dem Dezember 1524 einige Bauern im Wirtshaus zu Baltringen, wie
sie ihre Beschwerden durchsetzen könnten. Anfang Februar begannen sie, um Zuzug zu werben, und Mitte des Monats war auch hier die ganze Landschaft südlich der Donau im Auf-
stand und schloß sich zum Baltringer Haufen zusammen.
Im Bodensee raum schlossen sich die Bauern zu den Seebauern zusammen Im Linzgau bildete sich ein eigener Abteilungshaufen, der Bermatinger Haufen.
Dort hatte er sein Standquartier und sein Hauptmann wurde der Oberteuringer Müller Eitelhans Ziegelmüller.
Anfang März hatten sich die Seebauern bereits mit den Allgäuern verbündet.
Die erste große Schlacht fand am 4. April 1525 bei Leipheim statt.
Am 17. April 1525 schlossen der Allgäuer Haufen und der Seehaufen unter ihrem Führer Eitelhans Ziegelmüller den Weingartner Vertrag mit Georg III. Truchsess von Waldburg (1488-1531) den Weingartner Vertrag.
Eitelhans Ziegelmüller ist zwischen 1485 und 1490 geboren . Sein Todestag steht fest, nämlich der 15. Dezember 1545.
Ziegelmüllers Aktionen richteten sich zunächst gegen Kloster Salem. Mit nur etwa 20 Personen kam der Hauptmann Ziegelmüller ins Kloster.
Alle Bediensteten mussten ihm huldigen und schwören,, das göttliche Recht zu beachten und nichts gegen den Haufen zu unternehmen.
Am 2. April 1525 forderte Ziegelmüller den Salemer Konvent auf, ihm zu huldigen Auf Rat von Abt Jodok, der sich nach Überlingen geflüchtet hatte, geschah das am 3. April.
Die Aufständischen waren auf Verpflegung aus Klostervorräten angewiesen.Die Führung hatte angeordnet, dass aus besetzten Schlössern und Klöstern nur Essen und Trinken genommen wird und nichts zerstört wird.
Im Bereich des Seehaufens ging kein Kloster in Flammen auf und keine Gebäudeschäden wurden gemeldet.
Kloster Salem erlitt im Vergleich zu den anderen Klöstern die geringsten Verluste. In Salem selbst hielten sich in Grenzen, wie er Abt selbst feststellte :”Nicht ein Heller Schaden ist uns geschehen als an Wein
und Brot° Nur im Klosterbesitz Schemmerberg überfiel der Balteinger Haufen am 26. März 1525 das Schloss und zerstörte es.
Dass Salem so glimpflich davon kam, lag zum einen an Abt Jodok, er verhielt sich taktisch klug. Er beteiligte sich nach den Aufständen auch nicht an den Verurteilungen der Bauern. Den Grund für die bäuerliche Erhebung sah er vor allem in der Reformation.
Das andere war sein Gegenspieler, Eitelhans Ziegelmüller. Er war schon vor den Aufständen Ammann des Gerichts der Landvogtei um Ailingen und behielt dieses Amt bis an sein Lebensende.
1529 und 1530 wählten ihn die Bauern im Linzgau zum Abgeordneten der „Landschaft“, der Untertanenvertretung der Landvogtei, zu österreichischen Landtagen in Innsbruck und Linz.
Gleich nach dem Bauernkrieg senkte Kloster Salem die Steuern, um weiteren Aufständen vorzubeugen. Es hatte bis dahin weit strengere Auflagen als in anderen süddeutschen Territorien .
Nach dem Bauernkrieg wirtschaftete Abt Jodokus sehr sparsam und konnte die erlittenen Schäden rasch ersetzen und auch neu Güter Erwerben.
1526 erwarb er von der –Reichsstadt Überlingen ein Haus mit Hofstatt und Stadel für 450 fl.,das sind ungefähr 372.924,00 €. Es handelte sich um angrenzende Gebäude an ein Haus wo Salem schon seit 1231 begütert war.
In den Jahren zwischen 1530 bis 1535 wurde der Hof in seiner heutigen Ansicht erbaut. Ob die alten Gebäude teilweise integriert oder abgerissen wurden, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen.
Einen Höhepunkt bedeutete sicher der Besuch von Kaiser Ferdinand (1558-1564), der dort 1563 übernachtete.
Abt Jodokus verstarb am
Auf ihn folgte Abt Amandus Schäffer (1529–1534 )
Er Stammte aus Straßburg Er war Mönch in Kloster Baumgarten und legte dort auch seine Profess ab. 1593 brannte das Koster ab und wurde völlig zerstört. Die Mönche begaben sich in benachbarte Klöster. Amandus ist wohl nach Salem gekommen.
Bei seiner Wahl war er schon alt Anwesend war der Abt von Lützel Theobald Hillweg (1495–1532), von Bebenhausen Johann von Fridingen (1493–1534 ) und Melchior Ruf von Königsbrunn (+ 1539)
Als das Erzstift Salzburg seine Salzpfannen in Hallein an an den bayrischen Herzog Ludwig X. verkaufte, verkaufte auch Abt Amandus seine Salzpfanne in Wallbrunn bei Hallein, die Salem von dem Salzburger Erzbischof Eberhard II. geschenkt bekommen hatte, an den
bayrischen Herzog.
Zwischen 1530 und 1535 ließ Abt Amandus den Salmannsweiler Hof in Überlingen neu und aus festem Stein erbauen.
Abt Amandus war ein vertrauter Freund des Ingolstädter Theologen und Professor Johannes Eck (!586- 1543) und Luthergegner.
Abt Amandus starb am 27. Juni 1534 im Salmannsweiler Hof in Überlingen. Er wurde in der Franziskanerkirche in Überlingen begraben.
Sein Nachfolger wurde Abt Johannes III. Fischer (1534–1543 )
Er stammte aus Mimmenhausen und wurde am 6. Juli 1534 zum 22. Salemer Abt gewählt.
Nach seiner Wahl ging er nach Überlingen zu den Barfüßern und hielt einen Jahrtag für seinen Vorgänger ab. Er ordnete an, dass der Salemer Hofmeister in Überlingen
immer am Jahrtag von Abt Amandus zwei Kerzen auf dessen Grab stellte.
Der Sommer 1540 war sehr heiß und bescherte einen vorzüglichen Wein. Aber die Hitze sorgte auch dafür, dass mancherorts die Pest ausbrach.
Abt Johannes III. errichtete zu deren Abwendung die Sebastiansbrüderschaft,.
In Dänemark war Johannes von Weeze 1522 nominierter Erzbischof von Lund und 1530 Bischof von Roskilde bzw. Seeland geworden. Da Dänemark
protestantisch war, musste er Dänemark verlassen. Er stand bei Kaiser Karl V. in hohem Ansehen
Bei den Friedensgesprächen von Großwardein 1538 wirkte er als persönlicher Gesandter der Kaisers Karls V
Der Friede wurde dann zwischen Ferdinand I. , Bruder Karls und damals Erzherzog von Österreich und Johann Zápolya (1526-1540) geschlossen und beendete den ungarischen Bürgerkrieg.
1538 wurde er Bischof von Konstanz und 1540 vom Papst bestätigt.
1540 übergab der Reichenauer Abt Markus von Köringen (1521-1540) Kloster Reichenau als Priorat an den Konstanzr Bischof. Dieser wurde der erste Reichenauer Kommendatarabt von Kloster Reichenau und nannte sich dann auch
Abt von Reichenau.
Der Amtskollege von Abt Johannes III Melchior von Königsbrunn informierte ihn über die möglichen Pläne von Bischof Johannes von Weeze, die Abtei Salem um ihre Selbstständigkeit zu bringen und sie zu Besitz des Bistums Konstanz zu machen.
Er wandte sich an Kaiser Karl V.. Dieser bestätigte am 1.Juli 1541 alle Privilegien und Verbriefungen von Salem.
Kloster Salem sollte bei all seinen Rechten und Herkommen verbleiben.
Außerdem wurde es vom kaiserlichen Hofgericht in Rottweil eximiert. Streitsachen sollten nur noch vom Reichskammergericht und vom Hofrat geschlichtet und entschieden werden. (Staiger S. 129 f.)
Damit konnte der Bischof das Stift nicht mehr zur Kommende machen. Er verfolgte dies auch nicht mehr weiter.
Das scheint ihn wohl viel Kraft gekostet zu haben. Er verstarb am 4. November 1543.
Auf ihn folgte Abt Johannes IV. Precht (1543–1553).
Er stammte aus Tübingen und wurde am 16. November 1543 zum 23. Abt von Salem gewählt.
Das Abbatiat wurde weniger durch die Aktivitäten des Abtes geprägt al durch Ereignisse im Reich.
Am 13. März 1545 eröffnete Papst Paul III. (1534-1549) das Konzil von Trient. Auch Abt Johannes war eingeladen.
Da er aber kränklich war schickte er einen Vertreter nach Trient.
!546 brach der Schmalkaldische Krieg aus, ein Krieg zwischen Kaiser Karl V. und dem Schmalkaldischen Bund, ein Bündnis protestantischer Landesfürsten und Städte unter der Führung von Kursachsen und Hessen.
Nach der Gefangennahme des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich (1532-1547) und des hessischen Landgrafen Philipp(1518-1567), der beiden Hauptleute des Schmalkaldischen Bundes, endete der Krieg für den Kaiser erfolgreich.
Die Reichsstadt Konstanz wurde von Karl V. erst 1548 erst im Oktober militärisch unterworfen. Karl bestrafte die Stadt mir dem Verlust der Reichsfreiheit.
Karl befand sich auf dem Höhepunkt seiner Macht und erließ auf dem Augsburger Reichstag von 18 das Augsburger Interim.
In Württemberg lie es sich einigermaßen durchsetzen. Dort wurden durch Herzog Ulrich im Zuge der Reformation auf gehobene Klöster wieder restituiert, zu Beispiel Maulbronn und Bebenhausen.
Dort wurden wieder Äbte eingesetzt. Der Passauer Vertrag vom 2. August 1552 hob das das Augsburger Interim wieder auf. Ulrichs Sohn Christoph von Württemberg (1550-1558) führte dann die Umsetzung der Reformation zielstrebig wieder fort.
Neue Novizen durften in den Klöstern nicht mehr aufgenommen werden.
Bei Neuwahlen verstand er es, Personen zu installieren, die der neuen Lehre anhingen und so seine Absichten unterstützten.
Nach dem Augsburger Religionsfrieden vom 8. August 1555 wandelte er die Klöster in evangelische Klosterschulen um. Von den Prälaten erfuhr er keinen nennenswerten Widerstand mehr.
Nach dem Augsburger Reichstag von 1548 hatten sich protestantische Fürsten insgeheim wieder zu einem Bündnis zusammengeschlossen.
Der französische König Heinrich II. (1547-1559) erklärte Kaiser Karl 151 den Krieg und stieß bis zum Rhein vor. Der sächsische Kurfürst Moritz (1541-1553) stellte sich an die Spitze der protestantischen Fürsten,
obwohl er noch 1548 im Auftrag des Kaisers Truppen nach Magdeburg geführt hatte, weil sich die Stadt dem Interim nicht beugen wollte.
Die vom französischen König finanziell unterstützten protestantischen Fürsten und ihre Truppen marschierten sehr schnell nah Süddeutschland.
1552 nahm Kurfürst Moritz sein Quartier in Salem.
1553 schloss Abt Johannes mit Johannes Schad von Mittelbiberach einen Vertrag wegen der Kaplanei von Langenschemmern. Sie war 1550 von der Gemeinde gestiftet worden und von der Herrschaft Warthausen
begabt worden. Sie gehörte zur Pfarrei Schemmerberg. Das Ernennungsrecht des Kaplans sollte der Herrschaft Warthausen zustehen, das Präsentationsrecht Kloster Salem.
Kurz vor seinem Tod schenkte Abt Johannes dem Weingartener Abt Gerwig Blarer (1520–1567) eine kostbare Inful, die mit Perlen und Edelsteinen besetzt war.
Abt Johannes IV. verstarb am 9. August 1553,
Auf ihn folgte Abt Johannes V. Michel (1553–1558)
Am 9. August 1553 wurde unter Leitung des Abtes Nikolaus Rosenberg (1542–1566) von Kloster Lützel im Beisein von Abt Sebastian Lutz (1541–1558) von Tennenbach und Bebenhausen Johannes V.
als 24. Abt von Salem gewählt. Vor seiner Wahl war er salemischer Pflger in Schemmerberg. Er stammte aus Neufra bei Riedlingen.
Er sandte den Konventualen Matthäus Rot und späteren Abt nach Rom zur Bestätigung seiner Wahl, wie das auch schon sein Vorgänger Johannes IV. gemacht hatte.
Er war ein Vertreter der Rechte seines Klosters,für die er auf Reichstagen und in sonstigen Verhandlungen eintrat. In seiner Regierungszeit wurde der Auhsburger Religionsfrieden
Am 25. September 1555 auf dem Reichstag in Augsburg beschlossen.
Kaiser Karl V. dankte am 25. Oktober 1555 ab und lebte in einem Landhaus, das das abgelegene Hieronymiten-Kloster von San Jerónimo de Yuste in der Extremadura angeschlossen war. Er trat aber nicht in den Orden ein.
Karl V. verstarb am 21. September 1558 an Malaria.
Abt Johannes V. starb nur ein paar Tage später am 25. Oktober 1558.
Sein Nachfolger wurde Abt Georg II. Kaisersberger (1558–1575)
Er Stammte aus Wemding in Bayern.
Er wurde am 11. November 1558 unter Vorsitz von Abt Nikolaus Rosenberg von Kloster Lützel einstimmig zum Abt gewählt.
Ferdinand I. (1558-1564) bestätigte Abt Georg II. am 3. Oktober 1559 alle Rechte und Freiheiten Salems. Er gestattete ihm außerdem den Handel und Wandel mit Juden zu verbieten.
Das war nach Staiger (S. 131) nämlich ein Problem für die Bevölkerung in Salem, weil die Leute oft ungünstige Verträge abschlossen, bewegliche und unbewegliche Güter gegen Verpfändung zu Geld machten
und wenn sie Fristen nicht einhielten, sehr oft vor Gericht landeten und auch Haus und Hof verloren.
Laut Staiger hatte diese Erlaubnis die Folge, dass viele Juden aus Salemer Gebiet wegzogen.
Am 19. April 1560 in Wittenberg,
Herzog Christoph von Württemberg zog die Zisterzienserklöster Herrenalb, Maulbronn, Bebenhausen und Königsbronn wieder ein, reformierte sie und gründete dort evangelische Schulen. Während des Interims waren sie
wieder mit katholischen Äbten besetzt worden.
1561 wurde Markus Sittikus von Hohenems (1561-1589)Bischof von Konstanz und auch zum Kardinal erhoben.
Wie schon Bischof Johann von Weeze versuchte Bischof Markus Kloster Salem als Kommende dem Bistum Konstanz einzuverleiben. Natürlich protestierte Abt Georg beim Kaiser dagegen und wie sein Vorgänger Johann gab er den Versuch auf.
Kaiser Maximilian II.(1564-1576) nahm am 27. März 1566 Kloster Salem in seinen Schutz und bestätigte seine Privilegien. Damit war auch der zweite Versuch Salem dem Bistum Konstanz einzuverleiben gescheitert.
1563 endete das Konzil von Trient.
1567 wurde in Konstanz eine Diözesansynode abgehalten. In Umsetzung der Beschlüsse wurde auch über die Errichtung eines Diözesanpriesterhauses beraten. Wegen Geldmangel wurde ein geistliches Seminar aber auf bessere Zeiten verschoben.
Im Tochterkloster Heggbach hatte
Äbtissin Lucia Hildebrand (1559-1590) das Kloster in eine wirtschaftliche Schieflage geführt. So musste Vaterabt Georg II. Kaisersberger den Haushalt überprüfen und in Ordnung bringen. Aber nur ein Jahr später lobte der Visitator Nikolaus I. Boucherat von Citeaux die vorbildliche Ordenszucht Heggbachs.
1571 hatte eine große Teuerung von Lebensmitteln eingesetzt. Die Preise erreichten eine ungeheure Höhe, Abt Georg öffnete die gutgefüllten Scheunen von Salem. Die Salemer Untertanen kamen so gegenüber anderen Herrschaften gut davon.
Abt Georg verstarb am 24. Februar 1575.
Auf ihn folgte Abt Matthäus Rot (1575–1583).
Er stammte wie Abt Johannes V. aus Neufra. und ist um 1520 geboren.Er genoss wohl auch das besonderes Vertrauen von Abt Johannes.
Für ihn reiste er nach Rom zur Bestätigung von dessen Wahl.Über seine Romreise hatte er 1554 ein Itinerar angefertigt, das erst später gebunden worden zu sein scheint.
1544 wurde er als Vikar und Kaplan von Abt Johanns bezeichnet. Noch zu Lebzeiten von Abt Johannes wurde ihm die Verwaltung der Salemer Pflege in Pfullendorf übertragen.
Er war auch Stellvertreter von Abt Georg, wenn dieser auf Visitationsreisen war.
Dieses Amt verwaltete er 18 Jahre lang bis zu seiner Wahl zum Abt.
Nach seiner Wahl versuchte er als erstes dass die hohen Bestätigungstaxen in Rom ermäßigt würden. Außerdem erbat er von Papst Gregor XIII. (1572-1585), dass er und seine Nachfolger nicht nur vom Konstanzer Bischof weihen lassen dürfe,
sondern von jedem katholischen Bischof.
Kaiser Rudolf II.(1576-1611) bestätigte Abt Matthäus auf dessen Bitte die Besitzungen, Rechte und Privilegien von Kloster Salem. Außerdem gestattete er, dass das Kloster in seinen Besitzungen in allen Reichs-und anderen Städten
geistliche oder weltliche Personen nach seinem Willen und Nutzen einsetzen dürfe. Damit konnte der Abt Pfleger, Amtsleute, Schaffner und Verwalter beliebig anstellen.
1581 ließ Abt Matthäus eine Urkundensammlung anlegen, in die alle Dokumente aufgenommen wurden, die für die Abtei wichtig waren. Sie bildete die Grundlage für die Summa Salemitana,
die zwischen 1761 und 1778 von den gelehrten Salemer Mönchen Mathias Bisenberger und Eugen Schneider angefertigt wurde.
1582 und 1583 führte er in seinem Gebiet den Gregorianischen Kalender ein.
Er war Direktor des Prälatenkollegs im Schwäbischen Kreis.
Er starb am 24. Mai 1583.
Auf ihn folgte Abt Vitus Nekher (1583–1587 )
Er Stammte aus Mimmenhausen und wurde am 5. Juni 1583 unter Vorsitz des Abtes Beat Bapst (1583–1597 ) von Kloster Lützel und im Beisein der Äbte von Weingarten Johannes IV. Raitner von Zellersberg (1575–1586)
und Weissenau Matthias Insenbach (1582–1595) zum 27. Abt von Salem gewählt. Er war sehr gebildet und hatte große Kenntnisse in Latein und Griechisch. Er achtete auf eine solide Ausbildung seiner Konventualen und schickte sie
auf seine Kosten zum Studium nach Dillingen.
Er bereicherte die Bibliothek mit wissenschaftlichen Werken.
Er starb aber nach nur 4 Regierungsjahren am 17. November 1587.
Auf ihn folgte Abt Johannes VI. Bücheler (1587–1588 ) Er stammte aus Neufra.
Er berechtigte zu großen Hoffnungen. Er war sehr klug.
Er verstarb aber schon nach einem halben Jahr an einem Schlaganfall.
Sein Nachfolger wurde Abt Christian II. Fürst (1588–1593 Rücktritt)
Er stammte aus Herbertingen.
Er verbesserte den äußeren Zustand des Kloster. Er ließ ein neues Chorgestühl in der Kirche aufstellen.
In Salem und dem ihn unterstellten Frauenklöster wollte er er eine neue verbesserte Zucht und Ordnung einführen.
Nach Staiger hatte er aber nicht die nötige Ausdauer, Geduld und Klugheit für dieses Vorhaben, Nach fünfjähriger Regierung trat er 1593.
Generalabt Edmond I. de la Croix (1584–1604 ) stimmte dem Rücktritt zu. Er erhielt eine Pension und begab sich auf Schloss Kirchberg.
Dort lebte er nach Staiger nicht sehr erbaulich, so dass viele Klagen über ihn eingingen. Erst als ihm mit Entzug der Pension gedroht wurde, ging er in sich. Er bat darum, wieder in
Kloster Salem aufgenommen zu werden, was ihm gestattet wurde. Er lebte nun mustergültig bis zu seinem Tod 1605.
Das erste Provinzkapitel fand am 15. November 1593 in Salem statt. Die anwesenden Äbte wählten den Salemer Abt
Christian Fürst zum »abbas provincialis«.
Das erste Provinzkapitel fand am 15. November 1593 in Salem statt. Die anwesenden Äbte wählten den Salemer Abt
Christian Fürst (1588-1593)zum »abbas provincialis«.
Am 10. November 1593 wurde Petrus Müller unter Vorsitz von Abt Beat Bapst von Kloster Lützel zum 30. Salemer Abt gewählt.
Die Bestätigung aus Rom verzögerte sich, weil das Bestätigungsgesuch und die Bittgesuche um Befürwortung an die Kardinäle Madruzzo, Paravicini und Rusticucci und den Ordensprokurator auf dem Weg nach Rom verloren gingen und erst nach langer Verzögerung beschädigt dort eintrafen. Daher wurde die Bestätigung erst am 8. August 1594 erteilt; die päpstliche Bulle trat schließlich im Februar 1595 in Salem ein
Er stammte aus dem Dorf Schellenberg, heute Ortsteil von Waldsee.
Er gehörte schon 1583 bei der Wahl von Abt Vitus Nekher dem Konvent von Salem an.
Er begann sofort das Vorhaben, die Ordenszucht zu heben, an dem sein Vorgänger gescheitert war, jetzt erfolgreich fortzusetzen.
Er war standhaft und gab, wenn nötig nicht nach. Das führte zum Erfolg.
Auf Ordensebene gab es zwei große Arbeitsfelder.
Die Reformation in Deutschland hatte auf den Zisterzienserorden gravierende Auswirkungen, Eine Reihe von Klöstern war im Zuge der Reformation aufgelöst worden.
Salem zum Beispiel verlor sein Filialkloster Königsbronn.
Das bedeutete aber auch, dass die Filiationsketten, das verbindende Element des Ordens dadurch in vielen Fällen unterbrochen worden waren. Auch die direkte Kommunikation mit Citeaux war oft durch kriegerische Ereignisse gestört oder sehr erschwert.
In unruhigen Zeiten wurde der jährliche Besuch des Generalkapitels und die jährliche Visitation durch die Vateräbte mehr und mehr unmöglich. In Spanien, Portugal und Italien entstanden mit Billigung des Apostolischen Stuhles regionale Kongregationen, die meist mit dem Orden verbunden blieben.
Im deutschen Raum sah man sich auch neuen Verhältnissen gegenüber, die eine neue Ordnung erforderten. Auch in Deutschland wurde nun über Congregationen nach gedacht. Die Initiative scheint von Rom und Citeaux ziemlich gleichzeitig ausgegangen zu sein.
Das zweite waren die Auswirkungen des Konzils von Trient, das zwischen 1545 und 1563 stattfand.
In der letzten Sitzungsperiode des Konzils stand die Reform der Orden auf der Tagesordnung.
In der letzten Sitzungsperiode von 1562 bis 1563 wurde das Dekret über die Reform der Orden beschlossen.
Es wurden . Normen für die Aufnahme neuer Mitglieder festgelegt. Das Dekret enthielt Bestimmungen über die Wiederherstellung des Gemeinschaftslebens, das Noviziat, die Abschaffung des Privateigentums, die Klausur der Nonnen und die ordnungsgemäße Wahl der Ordensoberen.
Generalabt Edmond I. de la Croix hatte zwischen 1593 und 1595 eine große Visitationsreise durch Deutschland übernommen.
Für den 14.-20. September 1595 lud er zu einer großen Äbteversammlung ins Kloster Fürstenfeld ein. Gleich zu beginn wurde der neue Fürstenfelder Abt Johann(es) IV. Puel (1595-1610) gewählt, was nichts mit der Versammlung zu tun hatte. Es hatte sich einfach aus Zeitgründen so ergeben.
Bei der Versammlung waren 17 Äbte aus dem oberdeutschen Raum anwesend.
Dort wurden die Fürstenfelder Statuten sowie ein gemeinsames oberdeutsches Generalvikariat beschlossen. Dieses bestand aus den vier Provinzen Schweiz-Schwaben-Elsaß, Franken, Baiern und die Kaisheim unterstehenden Klöster sowie Tirol. Dem oberdeutschen
Generalvikariat gehörten insgesamt 19 Männerklöster mit den ihnen unterstehenden Frauenklöster an. Zum Generalvikar wurde Abt Petrus Müller von Salem ernannt.
Generalabt Edmund gab Abt Petru 1596 die Vollmacht Äbte zu weihen.
Im Oktober 1596 visitierte Edmund Kloster Salem und verfügte, dass bei künftigen Abtswahlen die Anwesenheit des Kaisheimer Abtes genüge.
1609 visitierte Abt Petrus Kloster Neubourg. Nach der Visite trat Abt Hans Faber (1592 – 1597), der das Kloster sehr schlecht verwaltet hatte, zurück
Abt Petrus ersetzte ihn durch den Salemer Konventualen Alexander Metzger (1599-1621) Er schichte noch drei weitere Konventuale aus Salem nach Neubourg.
Luc Keller wurde Prior, Joachim List stellvertretender Prior und Sebastian Pfeiffer Novizenmeister.
Abt Petrus machte einige Neuerwerbungen für Salem.
1594 kaufte er von der Witwe des Eitel Pilgers vom Stain vom Klingenstain zu Waldsberg das Dorf Mainwangen im Hegau mit allen Rechten, Diensten und Abgaben sowie der niederen Gerichtsbarkeit für 22.000 fl., das sind ungefähr 18.787.412,00 €.
1603 kaufte er vom Konstanzer Bischof Johann Georg von Hallwyl (1601- 1604 ), das Dorf Einhart, heute Ortsteil der Gemeinde Ostrach, das Salem nach dem Kauf seinem Amt Ostrach zuteilte.
Für das Dorf samt Patronatsrecht, Niedergerichtsbarkeit , Vogtei und Zehnten wurden 25.000 fl., das sind 21.349.332,00 €, fällig.
Bei der Wahl des Konstanzer Bischofs Jakob Fugger (1604 –) war Abt Petrus als Stimmzähler anwesend.1626
1611 erwarb er vom Grafen Ernst Georg V. zu Sigmaringen (1585-1625) für ein Darlehen von 14.000 fl., das sind ungefähr 11.955.626,00 €, als Zins die Regalien, die hohe Gerichtsbarkeit, Zoll und Wegegeld für Ostrach, die Sigmaringen als Lehen von Österreich besaß.
Das war für das Kloster durchaus interessant, denn es begann jetzt wieder Truppendurchzüge, die dem Kloster hohe Kosten verursachten.
Das waren durchaus Erfolge, aber Abt Petrus schaffte es nicht, die Finanzlage Salems wieder zur früheren Blüte zu bringen, obwohl er mit hohen Vögelin einen tüchtigen Beamten hatte, der in Salem Oberamtmann war.
Bei den Truppendurchzügen kamen 1610 die Ansbacher und Braunschweiger mit 14.000 Mann. Die Truppen lagerten bei Salem ein paar Tage und zogen dann weiter.
Als Reaktion legten die Herrschaften ihren Untertanen Wehr und Waffen auf.
Das Salemer Volk war 1500 Mann stark und war gut bewaffnet und geschult. Sie hatten ein Übungsgelände.
1618 wurden die Truppendurchzüge immer häufiger und auch die Zahl der Einquartierungen nahm zu. Man wollte aber keine Volksbewaffnung und nahm den Leuten die Waffen wieder weg.
Wegen seines hohen Alters betrieb Abt Petrus die Wahl eines Koadjutors. Er verstarb jedoch kurz vorher am 29.Dezember 1614.
Sein Nachfolger wurde Abt Thomas Wunn (1615–1647 )
Er ist 1580 oder 1581 in Grasbeuren bei Salem geboren. Um 1599 trat er in den Zisterzienserorden ein. Er studierte in Dillingen und Salem Philosophie und Theologie.
1606 wurde er zum Priester geweiht.Vor seiner Abtsweihe war er Theologieprofessor und Oberbursar.
Er wurde am 18. Januar 1615 in Gegenwart der Äbte von Lützel Johannes Hanser (1605–1625 ), von Tennenbach Martin II. Schleher ( 1585–1627) und Wettingen Peter II. Schmid (1594 –1633)
Das 16. Jahrhundert war für das Kloster nicht gut. Es hatte Steuerausfälle und in den Kriegen Plünderungen zu verkraften.
Der Schmalkaldischen Krieg (1546–1547) hatte dem Kloster großen finanziellen Schaden zugefügt.
Trotz der angespannten Finanzlage entschloss sich Abt Thomas gleich nach seinem Amtsantritt zu ausgedehnten Neubauten.
Das war zu seiner Zeit eines der größten Bauprojekte der Bodenseeregion und orientierte sich in seiner äußeren Gestaltung an den feudalen Schlössern der umliegenden Grafschaften in im Spätrenaissance-frühbarocken Stil.
Abt Thomas ließ 1615–1627 die Abtei- und Konventgebäude als klar strukturierte, moderne Anlage neu errichten. Die alten Gebäude fielen dem Abbruch zum Opfer. Die Neubauten sind als dreigeschossige, einheitlich gestaltete Flügel um einen grossen und zwei kleinere Innenhöfe gruppiert. Der Abt ließ auch die Wirtschaftsbauten neu bauen. Aus mittelalterlichem Baubestand blieb nur das hochgotische Münster der Jahre 1285–1425 erhalten. Baumeister der Neubauten ist Balthasar Seuff aus Kempten. Er bekam für den Abriss des alten Baues 514 Gulden, das sind etwa 148.732,00 €.
Bis 1618 erhielt er insgesamt 2025 Gulden, das sind etwa 585.958,00 €. Das betraf dann die Bauleistungen.
Die 1615 bezeugte Anwesenheit des Jesuitenarchitekten Br. Stephan Huber in Salem, der im gleichen Jahr die grosse Klosteranlage in Ochsenhausen beginnt, weist mindestens auf eine aktive Mitplanung hin. Br Stephan Huber (1554–1619) war der große Jesuitenbaumeister
und hat sich als Planer der neuen Konventbauten in Ochsenhausen einen Namen gemacht. 1616 war er aber erschöpft und krank in Konstanz.
Er har in Salem wohl nur planerisch und als Ratgeber mitgewirkt.
Die neuen Klostergebäude in Salem konnten von den Mönchen nur wenige Jahre genutzt werden, denn 1634 müssen sie vor den herannahenden Schweden in schweizerische Zisterzienserklöster flüchten. Die Laienbrüder der Salemer Bauhütte wirkten im Exil als Altarbauer in St. Gallen, Neu St. Johann und Bischofszell.
1634 ließ er die von Abt Georg I. angeschafft, aber noch nicht fertig gestellt Orgel abreißen und durch eine größere neu aufsetzen.
Neben de Klosterbau kümmerte man sich in Salem intensiv um die Bildung der Mönche.
Die alten Bildungsstätten waren verloren, so dass man unfreiwillig Gast bei Jesuiten und bischöflichen Konvikten sein musste. In dieser Sache bestand akuter Handlungsbedarf.
Salem nahm eine Vorrangstellung innerhalb der Reihe der oberdeutschen Zisterzienserklöster ein. Einmal offenbar bedingt durch seine schiere Größe, aber vor allem auch wegen seiner mustergültigen monastischen Disziplin innerhalb der Klöster
des Ordens, was der Generalabt Nikolaus I. Boucherat (reg. 1571–1583) bereits 1573 in seinem Visitationsbericht hervorgehoben hatte: Salem sei ein celeberrimum et reformatissimum monasterium. Daher wurde 1593 beschlossen, das Studienseminar, das seminarium religiosorum, in Salem einzurichten, auch weil dort die baulichen Gegebenheiten dies möglich machten und im zuvor genannten Visitationsbericht Boucherats die umfassende Bildung vieler Salemer Religiosen bestätigt worden war. Jedes süddeutsche bzw. schweizerisch-elsässische Kloster sollte in Folge zwei Mönche zum Studium nach Salem schicken: Hintergrund war die schon angesprochene Bildungsmisere bei vielen Klerikern und Mönchen, die bereits vielerorts durch Außenstehende bemerkt und kritisiert wurde. Dieser Umstand war nicht neu.
Seit der Mitte bzw. im letzten Drittel des Reformationsjahrhunderts entstanden dann neben dem Klosterstudium durch Jesuiten gegründete Kollegien (wie Ingolstadt 1555, München 1559, Würzburg 1567 oder Luzern 1577 und Freiburg i. Üe. 1580/81), die sich an den lutherisch-reformierten Gymnasien, wie sie zum Beispiel im Herzogtum Württemberg entstanden waren, orientierten und in ihrer Vollausstattung die „studia inferiora“ umfassten. Diese Entwicklung mündete schließlich in Salem in die Ansiedelung eines Gymnasiums, an dem seit dem 18. Jahrhundert auch externe Schüler unterrichtet wurden. Zu den Unterrichtsfächern gehörten dort neben Theologie und den alten Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch
auch Geschichte, Geographie, Französisch, Englisch und Italienisch, Kalligraphie und Orthographie, aber auch Arithmetik und Algebra. Darüber hinaus wurde Unterricht im Singen, Geige- und Orgelspielen erteilt18. Für eine geregelte Ausbildung des eigenen Klosternachwuchses schon vor Etablierung des Zisterzienserseminars in Salem spricht weiterhin der Neubau eines Kollegiengebäudes im Zuge der Neuerrichtung des Konvents zu Beginn des 17. Jahrhunderts, wodurch ein älterer Bau ersetzt wurde, wie die Salemer Quellen berichten. Diese Baumaßnahmen liefen erstaunlich parallel mit den Verhandlungen zur Bildung einer oberdeutschen Kongregation und können als Vorgriff auf die späteren Statuten und die darin geforderte Errichtung eines Ordensstudiums gesehen werden. Durch die so geschaffenen Tatsachen antizipierte das Kloster die Entscheidung über den Ort eines solchen Studiums: Einzig Salem konnte das zentrale Kloster Ausbildungsstätte sein, weil die Infrastruktur bereits vorhanden war.
Zeitgleich betrieb Abt Thomas den Ausbau der oberdeutschen Zisterzienserkongregation. Nach den Fürstenfelder Statuten war das Projekt etwas ins Stocken geraten.
Zwischen 1606 und 1609 griff er päpstliche Nuniust in der Schweiz Fabrizio Verallo (1606-1608), die Idee einer Zisterzienserkongregation wieder auf, wobei er aber vor allem die Schweizer Zisterzienserklöster im Auge hatte
Unterstütz wurde er dabei vom Wettinger Abt Peter II. Schmid. Das blieb am Ende aber erfolglos.
Seit der Visitation des Generalabtes Nikolaus II. Boucherat (1604–1625) 1615 setzte sich auch die Ordensspitze für das Projekt ein.
In seiner Eigenschaft als Generalvikar der oberdeutschen Zisterzienserklöster organisierte Abt Thomas ein Treffen der Äbte von Wettingen, S. Urban mit Abt Ulrich Amstein (1588–1627 ) Tennenbach Martin II. Schleher (1585–1627), Neubourg mit Abt Alexander Metzger (1398-1621)
sowie Vertretern der Klöster Vertretern der Klöster Hauterive, Kaisheim und Stams. Es wurden Statuten entworfen. Ein Provinzkapitel bestätigte die Pläne für eine Kongregation und wählte Abt Thomas zum Präses
Ein Äbtetreffen im Dezember 1618 wurden die Stauten nochmals revidiert und vom Vertreter des Generalabtes Balduin Moreau approbiert. Der Generalabt bestätigte die Statuen 22. Januar 1619. Das Generalkapitel erkannte die Statuten am 15. Mai 1623 an.
Die noch sehr kleine Kongregation von nur 6 Klöstern war von Anfang an auf Vergrößerung angelegt. Papst Urban VIII.(1623–1644 ) anerkannte die Kongregation am 10. Juli 1624.
Die Äbte von Salem, Kaisheim Johann VII. Beck (1608–1626 ) und Aldersbach Michael Kirchberger (1612–1635) hatten wie beauftragt z einer Äbteversammlung am 2. und 3. September 1624 nach Salem eingeladen.
Das war Geburtsstunde der Oberdeutschen Kongregation, denn alle Klöster des oberdeutschen Generalvikariates waren von da an Mitglieder der Gemeinschaft. Präses (Vicarius generalis Germanieae Superioris) wurde der Salemer Abt
Am 2. Oktober 1624 wurde diese Kongregation vom Abt von Cîteaux und am 17.
17. Oktober 1624 vom Papst anerkannt.
Die weitere Entwicklung wurde aber zunächst ausgebremst durch den Dreißigjährigen Krieg.
Im Vorfeld des Krieges mussten Truppen einquartiert und verpflegt werden, wobei die durchziehenden Soldaten oft plünderten und stahlen.
1609 war Kloster Salem der Katholischen Liga, dem Bündnis der katholischen Reichsstände, beigetreten.
1623 sperrte es seine Beitragszahlungen. Ligatruppen hatten oft Kontributionen vom Kloster erpresst. Außerdem fürchtete man, dass bei das protestantische Württemberg bei einem Sieg mit einem Mitglied der Katholischen Liga kurzen Prozess machen würde.
Die Lage in Süddeutschland einigte sich aber gravierend nach der Landung des schwedischen König Gustav Adolfs (1611-1632) im Juli 1630 auf Usedom.
1632 drangen die Schweden bis Franken vor. Die Schwedenkriege erreichten nun Süddeutschland. Ganz Oberschwaben wurde von den Schweden besetzt. Nur die Belagerung der Reichsstadt Überlingen und ein Angriff auf Konstanz scheiterten.
Der Überfall schwedischer Truppen auf Kloster Salem verlief glimpflicher als erwartet. Schwerer trafen Kloster Salem Salem die kaiserlichen Regimenter. In den Jahren 1632–1647 wurde Salem mehrfach geplündert und als Truppenunterkunft benutzt. Die durchziehenden Truppen erpressten Schutzgelder, drangsalierten oder ermordeten die Bevölkerung, plünderten ihre Häuser und steckten sie in Brand.
Im Frühjahr 1634 ließ der schwedische Feldmarschall Horn (1592-1657) das Kloster plündern; im August desselben Jahres zerstörten Soldaten Teile des Münsters und stahlen einige Kirchenglocken. Mehrfach musste der Abt mit den verbliebenen Patres nach Konstanz fliehen.
Die schwere Niederlage der Schweden am 5. September 1634 bei Nördlingen brachte die Schweden in die Defensive. Kaiserliche Heeresverbände befreiten Oberschwaben von den Schweden.
1635 war ein Jahr der Missernten. Daraus folgte Teuerung und Hungersnot. Auch die Pest forderte ihre Opfer.
1642 löste Abt Thomas den Konvent auf und verteilte ihn auf andere Klöster. Nur zwei Patres waren in Salem verblieben.
Nach dem Ulmer Waffenstillstand vom März 1647 zwischen Bayern, Schweden und Frankreich kehrten die Patres wieder nach Salem zurück.
Abt Thomas erlebte das Ende des Krieges nicht mehr. Er verstarb am 10. Mai 1647 nach 33 jähriger Regierung mit 66 Jahren.
Als Generalvikar hatte er mehrere Abtswahlen geleitet
Am 18. Juni 1647 wurde unter Vorsitz des Lützeler Abtes Laurent Lorillard (1625–1648 ) Thomas II. Schwab (1647–1664) zum Abt gewählt.
Er stammte aus Bechingen an der Donau.
Das Kloster hatte rund 190.000 Gulden Schulden, das sind etwa 54.508.353,00 € und Stand vor dem Ruin. Das zeigte sich auch daran,
dass Abt Thomas II erst 10 Jahre nach seiner Wahl vom Papst bestätigt wurde, weil Salem die geforderten Annaten nicht bezahlen konnte.
1648 wurde in Münster und Osnabrück endlich Frieden geschlossen.
Die schwäbischen Prälaten hatten Adam Adami (1610-1663), der Prior von St. Jakob bei Mainz und von Murrhard war, als ihren Gesandten zu den Friedensverhandlungen zum Westfälischen Frieden ach Münster geschickt. Er konnte allerdings nichts bewirken.
Dienach 1629 wiederbesiedelten Klöster mussten wieder geräumt werden.
Die Zahl der Klosteruntertanen hatte sich um ein Drittel vermindert,
Für die finanzielle Sanierung mussten Hofgüter, Zehntrechte und weiterer Besitz verkauft werden.
Abt Thomas II. verstarb am 7. September 1664.
Auf ihn folgte Abt Anselm I. Muotelsee (1664–1680 )
Er ist in Mimmenhausen getauft und stammte aus Tettnang. Er war vor seiner Zeit als Abt Verwalter in Schemmerberg und Prior in Kloster Salem.
Auch er war gezwungen, wegen der Kriegslasten und Klosterschulden weitere Güter zu verkaufen.
Er kam mit der Sanierung voran. Dann brach aber der Niederländisch-Französische Krieg aus (1672-1678)
Zwar war Salem nicht unmittelbar vom Krieg betroffen, aber als Reichsstand musste es sich an den Kriegskosten beteiligen,die für Salem monatlich 316 Reichstaler betrug, das sind 2844 Kölner Mark, das entspricht
etwa 639.152,00 €, eine enorme Summe für ein
ohnehin gebeuteltes Kloster. Abt Anselm erreichte es nicht die Beiträge zu reduzieren.
1678 wurde der Friede von Nimwegen geschlossen, der aber erst 1679 in Kraft trat.
Er starb am 5. März 1680 an einem schmerzhaften Fußleiden.
Zu seinem Nachfolger wurde unter Vorsitz des Abtes von Lützel Pierre Tanner (1677–1702 ) Emanuel Sulger (1680–1698 ) zum 34. Abt von Salem gewählt.
Er ist am 29.11. 1654 in Neufra bei Riedlingen geboren.
Er stammte aus der Beamtenfamilie des Obervogts Sulger in Neufra; trat schon als Knabe ins Kloster ein und studierte 1668/69 in Freiburg.
Der konvent hatte sich wieder erholt und zählte 1683 wieder 37 Mönche und 8 Laienbrüder.
Kurz nach seinem Regierungsantritt setzte der Reichstag in Regensburg die für die Reichsmatrikel zu zahlenden Gebühren von 316 Reichstalern auf 130 Reichstaler herab, das sind nur noch1170 statt 2844 Kölner Mark, was
etwa 262.942,00 € entspricht, also deutlich weniger als noch im Niederländisch-Französischen Krieg. Da die Kriege ja leider weitergingen, eine echte Erleichterung also.
1681 wurden die württembergischen Besitzungen Salems an den Herzog von Württemberg verkauft, das war vor allem die Pflege Esslingen sowie die Pfarrei Pfullingen verkauft.
Abt Emanuel mühte sich weiter, die Finanzen Salems in Ordnung zu bringen.
1688 brach der Pfälzer Erbfolgekrieg aus
Kloster Salem blieb von unmittelbaren Kriegsfolgen zwar verschont. Aber es musste Geld und Naturalien an die Armeen liefern.
Das bedeutete natürlich wieder neuen Geldbedarf statt Schuldentilgung.
m 10. März 1967 traf das Kloster ein besonderes Unglück.
Die Katastrophe begann frühmorgens gegen 3 Uhr, als im Ostflügel ein Feuer ausbrach. Der Auslöser war ein schadhafter Ofen in der Gesindestube. Durch einen Riss im Ofen griffen die Flammen auf die Holztäfelung der Zimmerdecke über und breiteten sich schnell über die oberen Stockwerke bis hin zum Dachstuhl aus. Zwei Wachleute, die in der Gesindestube schliefen, wurden vom Feuer überrascht und wären beinahe im Rauch erstickt. Ihnen gelang es jedoch, die beiden Nachtwächter zu finden, welche die Konventualen und weitere Klosterbedienstete alarmierten. Doch es war bereits zu spät. Durch Funkenflug, angefacht durch starken Ostwind, konnte das Feuer auf die weiteren Flügel der Abtei übergreifen. Löschversuche scheiterten aus unterschiedlichen Gründen: Fensterscheiben zerbarsten in der Hitze oder man schlug sogar Fenster ein, um durch die Fensteröffnungen Wasser in die Gebäude zu schütten. Durch die Luftzufuhr breiteten sich die Flammen jedoch umso schneller aus. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung gelangte niemand mehr ins Innere der betroffenen Gebäude. Zudem mangelte es offenbar an geeigneten Löschgeräten: Eine große Feuerspritze, die aus Überlingen geschickt wurde, traf zu spät ein und konnte nichts mehr viel bewirken.
Am Abend des 10. Märzes war die Bilanz des Brandes erschütternd: Das Feuer hatte große Teile der Abtei- und Konventsgebäude zerstört und viele Kunstwerke sowie Mobiliar gingen auf immer verloren. Vergeblich hatten die Mönche versucht, in wildem Durcheinander Bücher und Inventar aus den Gebäuden herauszutragen. Unschätzbar wertvolle Bücher der Abtsbibliothek und Akten des Konstanzer Konzils wurden Opfer der Flammen. Einige Rettungserfolge ließen sich aber dennoch verbuchen: So blieben die Bücher und Schriften, die in der eigentlichen Klosterbibliothek untergebracht waren, sowie einige Kunstobjekte, wie der spätgotische Altar von Bernhard Strigel aus der Marienkapelle, erhalten. Denn die Gebäude, in denen sie sich befunden hatten, verfügten über massive Backsteingewölbe, welche dem Feuer standhielten und so das Inventar schützten. Auch das Münster konnte gerettet werden. Die Flammen hatten zwar schon auf die Kirche übergegriffen und dort einigen Schaden angerichtet, aber gegen Mittag des 10. Märzes konnte dort die weitere Ausbreitung des Feuers gestoppt werden. Ein großer Verdienst für die Nachwelt: Denn sowohl der Marienaltar als auch das Münster stellen heute noch ein Highlight beim Besuch in Kloster und Schloss Salem dar!.
Die Zisterzienser waren in der Landwirtschaft,im Handwerk und im Bergbau Vorreiter.
In salem bewiesen sie, dass sie auch im Brandschutz ihrer Zeit voraus waren. Beim Neubau spielten vorbeugende Brandschutzmaßnahmen eine besondere Rolle, und baulicher Brandschutz wurde nun konsequent umgesetzt. Hierzu gehörten nicht nur massive Backsteingewölbe, Brandwände, die Verwendung von Steinplatten in den Gängen und die Befeuerung der Öfen von den Gängen aus, sondern auch der Ausbau des Wasserleitungsnetzes, um in der gesamten Klosteranlage, schnell ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Eine Besonderheit war aber, dass in der Prälatur eine „Feuerwache“ eingerichtet wurde. Hierfür wurden, neben kleineren tragbaren Löschgeräten, zwei große fahrbare Feuerspritzen angeschafft. Diese stehen heute wieder an ihrem angestammten Platz im Treppenhaus der Prälatur.
Auch die Brandschutzorganisation wurde verbessert. Aus der Zeit von Abt Anselm II. ( 1746 -1778) ist eine Feuerordnung erhalten, die den Einsatz und die Bedienung dreier großer Feuerspritzen im Kloster, den Umgang mit Leitern und Löschkübeln sowie die Bergung von Personen und Gegenständen durch namentlich benannte Mönche, Handwerker und Klosterbedienstete regelt.
Abt Emanuel soll auf die Katastrophe mit dem Ausspruch „Der Herr hat´s gegeben, der Herr hat´s genommen, gepriesen sei der Name des Herrn“ reagiert haben. Aber fasste sich schnell wieder.
Der Abt bezog die noch intakten Zimmer des Großkellers. Die Mönche wurden im langen Bau oder in Dörfern untergebracht.
Die Kirche wurde gereinigt, so dass sie nach acht Tagen schon wieder benutzt werden konnte. Für das Kloster entschied man sich statt einer Reparatur für einen Neubau, da die Kosten annähernd gleich waren.
Abt Emanuel schloss mit Franz Beer II. von Bleichten (1660–1726) einen Akkord. Beer hatte Kirche und Kloster Obermarchtal gebaut, was ihm den Auftrag im Benediktinerkloster Zwiefalten einbrachte.
Für Salem hatte er ein Holzmodell geliefert und das noch vorhanden ist. Dieses überzeugte und man schloss den Akkord. Danach sollte das Kloster in drei Jahren soweit fertig sein, dass man es beziehen konnte.
Der Klosterbrand scheint den Abt doch stark mitgenommen haben. Er verstarb am 9. Mai 1698.
Er war der Sohn von Johann Jakob Jung. Dieser war Zimmermann und salemitischer Untertan in Nussdorf. Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges wanderte dieser nach Koblenz aus.
Sein Sohn mit Taufnamen Christian wurde am 8. Februar 1664 in Koblenz geboren. Christian erhielt eine gute Ausbildung. Nach Schulen in Koblenz und Mainz studierte Christian von 1680-1683 in Wien..
In Überlingen lernte er den Kapuzinerpater Perfekt (Staiger S. 162)kennen, der schon zu Lebzeiten einen heiligmäßigen Ruf genoss. Dieser riet ihm nach Salem zu gehen.
Der Abt erkannte seien Fähigkeiten und nahm ihn auf.
1683 trat er in das Kloster Salem ein. Ein Jahr später legte er sein Gelübde ab.
1688 und 89 studierte er an der Jesuitenuniversität, die wegen der französischen Besatzung in Freiburg nach Konstanz verlegt worden war, Theologie.
1690 wurde er zum Priester geweiht.
Im Kloster stieg er rasch auf. Er wurde bald Küchenmeister, dann Subprior und schließlich Prior.
Am 16. Mai 1698 wurde Abt Stephan I. Jung in Anwesenheit des Abtes von St. Urban UlrichVI. Glutz-Ruchti, (1687–1701) zum 35. Abt von Salem gewählt.
Als er die Regierung antrat hatte das Kloster-ohne den Schaden des Klosterbrandes noch 47.000 Gulden, das sind etwa 13.455.385,00 €
Das benötigte sicher viel Gottvertrauen zumal der Klosterneubau auch im Gange war. Aber Abt Stephan hatte auch die nötige Tatkraft und sicher auch wirtschaftlichen Sachverstand.
Mit den Fürsten Meinrad Karl Anton von Hohenzollern (1673-1715) und Friedrich Wilhelm von Hohenzollern (1663-1735) wegen Streitigkeiten und Prozessen wegen des Lehens in Ostrach
die Streitigkeiten endgültig beigelegt.
Kaiser Leopold I.(1658-1705) genehmigte dies am 14. Juni 1700.
Abt Stephan konnte 1700 sogar noch den Junghof bei Pfullendorf bauen.
1705 verkaufte der Abt den Salmannsweiler Hof bei Markdorf an Kloster Weingarten.
1706 wurde das neue Klostergebäude fertiggestellt und bezogen.. Dafür waren 350.000 fl., das sind etwa 100.199.673,00 € aufzubringen.
1707 ließ der Abt die große Münsterorgel für 20.000 fl., das sind 5.725.696,00 € und eine weitere Orgel für 15.000. fl, das sind etwa 4.294.272,00 €. verbessern.
1708 gab Abt Stephan die Ausstattung des Kaisersaals in Auftrag. Franz Joseph Feuchtmayer ( 1660-1718) war für die Stuckarbeiten und Figuren zuständig.
16 überlebensgroße Kaiserstatuen verweisen auf den Schutz der höchsten Herrscher. Es beginnt mit Lothar, der zur Zeit der Klostergründung lebte.
Der Stauferkönig Konrad III. ist verewigt, d er Salem zur Reichsabtei erhoben hatte. Über den Fenster waren Büsten von Päpsten, die dem Kloster wichtige Privilegien verliehen hatten.
Die Mehrzahl der sieben Leinwandgemälde stammt von Franz Carl Stauder.(um 1660-17149) Von ihm stammt auch das Bild von Kaiser Karl VI., der Abt Stephan bei der Krönung in Frankfurt eine Audienz gewährt hat.
Stauder hat 1722 auch das Porträt von Abt Stephan , seinem Förderer, gemalt.
Die Bautätigkeit des Abtes wurde auch belastet durch den spanischen Erbfolgekrieg 1701-1714.
Nach dem Tod des spanischen Königs Karl II. (1661-1700), der am 1. November 1700 kinderlos verstarb, wurde der spanische Erbfolgekrieg ausgelöst.
1702 nahmen bayrische Truppen unter Kurfürst Maximilian II Emaniel von Bayern (1662-1726), der sich auf die Seite von König Ludwig XIV. von Frankreich gestellt hatte,
Ulm ein. In dieser Gegend hatte Salem große Besitzungen. Das Kloster war vor allem durch Lieferungen und Übernahme anderer Kosten betroffen. So musste es ein
ganzes kaiserliches-hannoveranisches Regiment unterhalten.
Zwar wurden Franzosen und Bayern 1704 in der Schlacht bei Höchstätt geschlagen.
1707 waren die Franzosen aber wieder in der Gegend von Konstanz. Der französische Marachall Villars (1652-1734) wollte Abt Stephan am Himmelfahrtsfest 1707 sogar als Geisel gefangen nehmen um ein hohes
Lösegeld zu erpressen. Staiger S. 164 f.) Die Reiter, die das bewerkstelligen sollten, kamen wegen Hochwassers aber nicht bis zum Kloster.
Abt Stephan konnte sich mit wertvollen Schätzen nach Überlingen in Sicherheit bringen.
Dann kamen die Franzosen ins Kloster, forderten Brandschatzung . Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, nahmen sie den Novizen meister P. Anselm Lang und den Registrator P. Raphael Kündig mit. Außerdem stahlen sie 17
der besten Pferde. Die Franzosen wurden aber bei Ravensburg von Nachbarn überfallen,und die Geiseln befreit. Die franzosen zogen sich ins Elsass zurück. Brandschatzung wurde nicht bezahlt
Der Abt kehrte nach Salem zurück.
Generalabt Nicolas III. Larcher ( 1692–4 1712 ) beauftragte Abt Stephan mit der Visitation der bayrischen Zisterzieserklöster als Generalvikar der Oberdeutschen Zisterzienserkongregation.
Er war deshalb 1700, 1701, 1705 und 1714 auf Visitationsreisen in Kurbayern unterwegs. Diese Visitationen dienten der Durchsetzung der Ordensdisziplin.
Für den bayrischen Kurfürsten Maximilian Emanuel war dies aber eine Provokation. Abt Stephan beharrte aber auf seinen Rechten.
Äbte von Fürstenzell Benedikt Arb (1694–1700,) und Raitenhaslach Candidus Wenzl, (1688–1700 ) bewegte er zur Resignation.
1701 kam es zum Eklat. Nach einer Audienz bei Kurfürst Maximilian Emanuel in Schleissheim reiste er weiter ins Hauskloster der Wittelsbacher Fürstenfeld.
Für den Abt und den Konvent von Fürstenfeld verfügte er mehr Distanz zum Münchner Hof.
Der Kurfürst verlangte, dass der Abt sofort abreiste und ert
eilte ihm Landesverbot für Bayern. Erst nach der Flucht Maximilian Emanuels 1705 und 1714 ins Ausland waren wieder Visitationen in Bayern möglich.
1710 erhielt das Kloster von Rom die Leiber der Heiligen Firminus, Homo-Deus und Valentina.Diese wurden köstlich gefasst und zur öffentlichen Verehrung ausgestellt.
Er sorgte für eine gründliche Ausbildung seiner Konventualen
In seinem Herrschaftsgebiet führte er den Jugendunterricht ein.
1717 bestätigte Kaiser Karl VII. Auf Bitten Abt Stephans dem Kloster verschiedene Privilegien über das Zunft-und Handwerkwesen.
1718 steuerte er zum Türkenkrieg 900 f., das sind etwa 256.415,00 €, bei.
1723 erreichte er eine Ermäßigung der Reichsmatrikel von 130 auf 76 Taler.
Er verstarb im 62. Lebensjahr am 15. April 1725.
Auf ihn folgte Abt Konstantin Miller (1725–1745)
Er ist 1681 in Konstanz geboren und trat 1700 in das Kloster Salem ein. 1705 wurde er zum Priester geweiht.
Einige Jahre verwaltete er danach die Pflege Pfullendorf, was auch seine wirtschaftliche Kompetenz erweiterte,
Am 25 April 1725 wurde er unter Vorsitz des Kaisheimer Abtes Roger Röls (1698–1723 ) zum Abt gewählt
Generalabt Edmond II. Perrot (1712–1727 )bestätigte die Wahl am 22. Mai 1725 ernannte ihn schon am selben Tag zum Generalvikar der Oberdeutschen Zisterzienserkongregation.
Papst Benedikt XIII. (1724-1730) bestätigte ihn am 19. Dezember 1725.
Die Benediktion erfolgte aber erst am 28. April 1727 von Bischof Johann Franz von Stauffenberg von Konstanz (1704 –1740) unter Assistenz der Äbte von Weingarten Sebastian Hyller (1697–1730)
und Ochsenhausen Cölestin Frener .(1664–1737)
Das neu erbaute Kloster stattete er im Innern mit Skulpturen und Verzierungen aus.
Abt Konstantin sorgte auch dafür,dass Joseph Anton Feuchtmayer (1696–1770), der Sohn von Franz Joseph Feuchtmayer, Salem zu seinem Lebens- und Arbeitsmittelpunkt machte.
Seinen ersten Auftrag erhielt er von Kloster Salem. Er fertigt er den Stuck und die Scagliola-Arbeiten im Westflügel des Kreuzganges. Er hatte schon einen Tisch mit Scagliola-Arbeit an Abt Stephan geliefert, um
seine Handwerkskunst zu belegen. Der Tisch steht heute noch in Salem. Abt Stephan empfand dies allerdings als zu modern. Die Aufträge kamen dann erst von Abt Konstantin.
Auch die Klosterkirche wurde mit goldenen Einfassungen, mit kostbaren, kunstvollen Leuchtern, Ornamenten, Statuen und Standbildern ausgestattet, z. B. Steinbilder der zwölf Apostel.
Ervergrößerte den Klostergarten und versah ihm mit verschiedenen Blumen,Zierpflanzen und Gesträuchen.
Erließ eine ziemliche Anzahl von Pfarrhöfen und Hofbauten im Herrschaftsbereich Salems renovieren oder neu bauen.
Er verbesserte das Justizwesen. Er verließ Verordnungen und Satzungen für das Gewerbe und im Eigentumsrecht.
In Bachhaupten bei Ostrach ließ er 1727/28 eine Dorfkirche von Johann Georg Wiedemann(1681−1743), der aus der Baumeistersippe Wiedemann aus Elchingen stammt, erbauen.
Stuck und Altar stammen von Joseph Anton Feuchtmayer.
1736 kaufte er für 3500 fl., das sind etwa 996.797,00 €, den Scherrichhof in Bihlafingen.
In diesem Jahr ließ er auch goldene Reliqienschreine für die Leiber der heiligen Faustina und des des Felix anfertigen und auf besondere Altäre versetzen. Als diese 1737 im Beisein vieler hohergeistlicher und weltlicher Würdenträger eingeweiht wurden,
kamen so viele Menschen, dass die Klosterkirche die Menge kaum fassen konnte.
Von 1736-1738 wurde der Pfleghof in Schemmerberg neu gebaut und ein Viehhaus und Fruchtkasten neu errichtet.,
1739 verkaufte er den durch Brand beschädigten Salmannsweiler Hof in Biberach und die Fischrechte in der Riß für 4500 fl, das sind ungefähr 3.558.293,00 € an
den Biberacher Spital. (Beschreibung des Oberamtes Biberach, Stuttgart 1837,S..69)
1743 erhielt er von Kaiserin Maria Theresia ((führte seit der Wahl ihres Gatten FranzI 1740 die Regierungsgeschäfte bis zu ihrem Tod 1780) die Hohe Gerichtsbarkeit und die Hoheitsrechte für Schemmmerberg für 27.000 Dukaten, das sind
etwa 7.689.579,00 €. Für 12.000 Dukaten, das sind etwa 3.417.591,00 €, erhielt er die Regalien als beständiges immerwährendes österreichisches Lehen.
In Schemmerberg ließ Abt Konstantin 1735 die Salemer Mühle neu erbauen . Dort befinden sich auch zwei Abtswappen, nämlich von Peter II. Müller, der die im Bauernkrieg zerstörte Mühle wieder errichtete und Abt Konstantin, der die Mühle jetzt
neu erbaute
Von 1736-1738 ließ Konstantin das neue Schloss an der Riss erbauen, das 1837 abgebrochen wurde.
Als Vaterabt von Kloster Wald machte er bei seiner dortigen Visitation genaue Vorschriften. Die Äbtissin durfte ohne seine Genehmigung keine Verträge abschließen oder Aufträge vergeben.
Als er die neugewählte Äbtissin Maria Dioskora von Thurn und Valsassina (1739-1772) benedizierte unterließ sie beim Eid den die Äbtissinen´ ablegen mussten,
unterließ sie die ausdrückliche Anerkennung der salemischen Obrigkeit in geistlichen und zeitlichen Dingen.
Kloster Salem hatte sich weitgehend wirtschaftlich erholt. Dann brach der österreichische Erbfolgekrieg(1740-1748) aus.
Ein französisches Heer unter König Ludwig XV. ((1715-1774 besetzte 1744 nach sechswöchiger Belagerung die vorderösterreichische Hauptstadt Freiburg im Breisgau, Stockach, Konstanz und Bregenz.
Zahlreiche Truppendurchzüge, Einquartierungen und Lieferungen trafen Kloster Salem schwer. Es hatte über 150.000 Dukaten , das sind etwa 42.719.886,00 €, an Kriegslasten zu tragen.
Abt Konstantin griff das so an, dass er erkrankte, Nach fast 20 Regierungsjahren verstarb er am 22. Februar 1745.
Auf ihn folgte Abt Stephan II. Enroth (1745–1746 )
Er wurde 1701 als Sohn der Eheleute Andreas und Anna Maria Enroth, geb. Graf geboren und auf den Namen Franz Joseph getauft.
Franz Joseph studierte in Dillingen und Freiburg Philosophie.
Er hatte einen jüngeren Bruder Dr. Johann Franz Enroth (3. Nov. 1706 – 6. März 1780) der von 1754 bis 1776 Stadtpfarrer und Stiftspropst in Überlingen war.
Franz Joseph trat 1721 in das Kloster Salem ein. Er nahm den Klosternamen Stephan an.
Abt Konstantin schickte ihn man das Collegium Germanicum in Rom. Dort studierte er weitere vier Jahre.
1725 wurde er zum Priester geweiht.
Er war zehn Jahre lang Hausprofessor für scholastische Theologie in Salem, danach einige Jahre Kaplan und Verwalter in Alt-Birnau
Dann war er Oberpfleger in der Pflege Schemmerberg.
Am 4. März 11745 wurde er unter Vorsitz des Kaisheimer Abtes Cölestin I. Mermos (1739–1771) zum 37, Salemer Abt gewählt.
Zeugen waren der Pfarre von Weildorf Benedikt Tiberius Stier (dort Pfarrer 1722-1758) und Dominikus Wicker, Pfarrer in Salem Leutkirch (1723-1753)
Er wurde am 3. Oktober 1745 von Fürstbischof Kasimir Anton von Sickingen (1743 -1750) im Beisein der Äbte Benedikt Denzel (1737–1767) von Ochsenhausen und
Anton I. Unold (1724–1765) von Weissenau benediziert.
In Rom hatte man sich wegen der Belastungen durch den österreichischen Erbfolgekrieg um eine Reduzierung der Wahltaxe bemüht, allerdings aber ohne Erfolg.
1745 bestätigte ihn Generalabt Andoche Pernot von Cîteaux (1727-1748), ernannte ihn aber nicht wie seinen Vorgänger zum Generalvikar der Oberdeutschen Kongregation.
Er war Kondirektor des Kollegiums der Reichsprälaten im Schwäbischen Reichskreis. In dieser Eigenschaft huldigte er am 17. Oktober 1745
Kaiser Franz I. Stephan und Königin Maria Theresia.Er stattete am 20. Oktober einen Antrittsbesuch beim Nuntius Carlo Francesco Durini ( 1740–1751 ) in Luzern ab.
Am 16. Dezember1745 führte er in Wettingen den Vorsitz bei der Wahl des Abtes Peter Kälin (1745–1762 ) Auch bei der Wahl der Äbtissin Äbtissin Antonia Jacobäa Dollinger († 4. Feb. 1785) in Feldbach führte er den Vorsitz.
In Salem legte er neue Brunnen für frisches Trinkwasser an.
In Mimmenhausen ließ er eine Reichspüosthalterei errichten.
Altbirnau gehörte spätestens seit 1241 dem Kloster Salem. Auf diesem Grundstück stand seit dieser Zeit auch eine Marienkapelle, die um 1317 schon ein Wallfahrtsort war.
Die Kirche gehörte Salem, das Gebiet um die Kirche der Reichsstadt Überlingen . 1746 ließ Abt Stephan das Gnaswnbild von Alt-Birnau trotz heftigen Protests aus Überlingen nach Salem bringen.
Er wollte die Kirche von ihrem bisherigen Standort auf Überlinger Gebiet auf ihren heutigen Standort oberhalb von Schloss Maurach verlegen.
Sowohl der Konstanzer Bischof als auch der Papst Benedikt XIV. (1740-1758) hatten ihre Einwilligung dazu gegeben.
Abt Stephan hatte auch schon Pläne zum Neubau der barocken Wallfahrtskirche skizziert wie das auch das Porträt von Göz zeigt . Den Bau musste
er aber seinem Nachfolger überlassen. Er ordnete den Abriss von Altbirnau an, Den Mittelpunkt der Wallfahrt ließ er aber vor dem Abbruch mitnehmen.
Der Rechtsstreit zwischen der Reichsstadt Überlingen und dem Kloster Salem, der nach der Entfernung des Bildes ausgetragen wurde, dauerte dann bis in die 1780-er Jahre.
Abt Srephan befand sich auf einer Visitationsreise in das Kloster Wald, wo er auf dem Weg dahin, als er am 28. Mai 1746 in Bachhaupten verstarb.
Sein Nachfolger wurde Abt Anselm II. Schwab (1746 – 1778. )
Er wurde am 9. Januar 1713 in Füssen geboren. Er ist das achte von elf Kindern des Kaufmanns und zeitweiligen Bürgermeisters Franz Benedikt Schwab.
Er wurde auf den Namen Franz Meinrad, getauft,. Er studieret in Salzburg. Mit 18 Jahren trat er in das Kloster Salem ein.
Am 30. September 1731 legte er seine Profess ab. Er nahm den Klosternamen Anselm an. In Salem studierte er 4 Jahre Theologie und wurde
1737 in Konstanz zum Priester geweiht.
Anselm wurde Novizenmeister
Er führte die Verhandlungen zur Verlegung der Birnauer Wallfahrt.
Am 6. Juni 1746 wurde er zum neuen Salemer Abt unter Leitung des Kaisheimer Abtes Cölestin I. Mermos gewählt.Nach der Bestätigung durch Papst Benedikt weihte ihn Fürstbischof Kasimir Anton von Sickingen .
Er ließ gleich den Bau der Wallfahrtskirche Birnau beginnen. Den Vertrag mit dem Vorarlberger Baumeister Peter Thumb (1861-1766) hatte schon Abt Stephan II. ausgehandelt.
Peter Thumb war damals 64. Abt Anselm, mit dem er nun neu verhandeln musste, war 33. Die Beziehungen zwischen beiden blieben während der gesamten Bauzeit angespannt.Anselm zerriss den alten Vertrag und verhandelte neu.
Er erreichte eine Pauschale von 6000 Gulden, das sind etwa 1.661.895,00 € für die Ausführung des Rohbaus und die Leitung der Ausbauarbeiten.
Der Bau der Kirche dauerte nur vier Jahre. Das ist kunstgeschichtlich sensationell, weil es so schnell ging. Vom ersten Federstrich bis zur Endausstattung dauert es normalerweise mehrere Perioden.
Im September 1750 wurde die Kirche eingeweiht mit einem großen Fest 20.000 Menschen sollen anwesend gewesen sein.
Er hatte sehr gute Beziehungen zum Wiener Hof.
1748 ernannte ihn Maria Theresia zum “Kaiserlichen und Königlichen Wirklichen Geheimen Rat”.
Abt Anselm war ein Machtbewusster Prälat . Er zeigte Führungsanspruch und einen energischen Willen zum Durchsetzen von Reformen.
Das führte allerdings bald zu Konlikten, zunächst mit den Äbtissinen, der ihm unterstellten Nonnenklöstern oder dem Konstanzer Fürstbischof Kardinal Franz Conrad von Rodt (1750 .1775) und auch seinem eigenen Konvent,
in dem sich eine Interne Opposition bildete.
Als Abt Konstantin am 9. April 1741 Äbtissin Maria Dioskora von Thurn und Valsassina von Kloster Wald in Salem benedizierte,hatte sie ja die ausdrückliche Anerkennung der salemischen Obrigkeit in geistlichen und zeitlichen Dingen unterlassen.
Als Abt Anselm Abt geworden war, pochte er auf die Paternität von Salem und zwang er Äbtissin Maria Dioskora 1750 zum vollständigen Wiederholen des Gehorsamseides. 1752 ließ er sie nach siebentägiger Visitation des Klosters
lateinische Schreiben an den Ordensgeneral in Cîteaux und an den päpstlichen Nuntius unterschreiben. Das war ihre vorbehaltlose Unterwerfung. Erst als sie eine Übersetzung aus Citeaux erhielt, wusste sie, was sie unterschrieben hatte. Sie setzte sich zur Wehr und mit
Hilfe ihres Bruders und des Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen erreicht sie in Cîteaux eine Untersuchung durch den Orden. Dieser stellte sich auf die Seite der Walder Äbtissin und und löste das Paternitätsverhältnis mit Salem auf. Als Reaktion legte Abt Anselm II. der Paternitätsrechte
aller Frauenklöster nieder. Nun nutzten aber auch die Reichsabteien Gutenzell unter Äbtissin Maria Barbara Dominica von Gall zu Waldhof (1707-1759) und Heggbach unter Äbtissin Maria Aleydis Zech (1742-1773) die Gelegenheit, um wie Kloster Wald unter die neue Paternität von Kaisheim zu gelangen.
Nur Heggbach kehrte auf persönliches Werben von Abt Anselm wieder unter die Paternität von Salem zurück.
Der Konstanzer Bischof hatte auch Reibereien mit Abt Anselm. Dieser pflegte in seiner Kutsche sechsspännig zu fahren.
Die sechsspännige Kutsche ist dem fürstlichen Rang des Salemer Abtes angemessen, wie Abt Anselm es empfand. Die Zahl der Pferde ist von protokollarischer Bedeutung, und sie ist bei den vielen Reisen des Abtes augenfällig. Der feindlich gesinnte und weniger begüterte Konstanzer Fürstbischof lässt dem Salemer Abt einmal auf Konstanzer Gebiet zwei Pferde ausspannen, vordergründig wegen der Rechtswahrung. Diese Symbolik der Zeremonien und der Auftritte wird selbst vom Volk verstanden.
1761 betrieb der Konstanzer Bischof zusammen mit einer klosterinternen Opposition aus reinem Eigeninteresse die Absetzung des ihm zu mächtigen Abt Abt Anselm.
Sie misslingt. Abt Anselm hatte zu gute Verbindungen an den kaiserlichen Hof. Dieser und der Papst setzten sich für Abt Anselm ein . Anklagen wegen Verschwendung der Klosterfinanzen und Nepotismus werden eingestellt
Nach einer Visitation des päpstlichen Sonderbotschafters ist er 1762 voll rehabitiliert und geht gestärkt aus der Auseinandersetzung mit dem Fürstbischof hervor.
Er machte einige Zugeständnisse in Bezug auf die Klosterdisziplin, die er schon 1749 zum Beispiel mit dem Gebot des Stillschweigens und strengster klösterlicher Zucht drastisch verschärft hatte.
Als erstem Salemer Abt gelingt es ihm 1768 zum Direktor des Schwäbischen Reichsprälaten-Kollegiums gewählt zu werden.
Die Finanzkraft des Klosters erlaubt ihm, die Abkehr vom Rokoko zu gestalten.
Er verpflichtete den Deutschordens-Baumeister Johann Caspar Bagnato(1696-1757) für einen Chorumbau des gotischen Münsters nach Salem. Anschließend, von 1753–1756, errichtet ihm Bagnato den grossen Vierungsturm, ein vielbewundertes Kunstwerk mit 16 Glocken. Abt Anselm II. baute diesen Turm als weithin sichtbares und repräsentatives Zeichen einer mächtigen Abtei.
1774 hatte der französische Architekt Pierre Michel d’Ixnard (1723-1795) Kloster Salem besucht.In Süddeutschland hatte er schon Schloss Königseggwald gebaut, das Konventsgebäude des Stifts Buchau und Fürstabt Martin Gerbert (1764-1793) von Kloster St. Blasien beauftragte ihn
mit der Planung des Klosterneubaus und der Errichtung einer neuen Kirche.
In Salem kam es nicht zur Zusammenarbeit.Stattdessen konnte er Schüler des Meisters, Johann Joachim Scholl, gewinnen.Diesem finanzierte er einen Studienaufenthalt in Rom an der dortigen französischen Akademie. Scholl wurde dann Leiter des Kirchenumbaus im
neuen goût grecque, den Abt Anselm II. 1773 begannt
1758 versuchte Abt Anselm Salemer Wein am kaiserlichen Hof einzuführen, allerdings erfolglos.Der Seewein war den kaiserlichen Majestäten zu sauer.
Er wandte sich an den Orgelbauer Karl Joseph Riepp.Dieser war einer der renommierteste Orgelbauer seiner Zeit. In Salem baute er er zwischen 1766 und 1774 baute er vier neue oder grundlegend erneuerte Orgeln auf den drei Emporen sowie im Chor. Sie waren alle aufeinander abgestimmt, sodass sie zusammen gespielt werden konnten.Das war damals die größte Orgel der Welt.
Aber Riepp war nicht nur Orgelbauer. Er war auch Weinhändler und besaß ein Weingut in Frankreich. Er lieferte dann auch Reben “mit Wurzeln aus Burgund, die bald guten Ertrag brachten und noch heute wächst bester Spätburgunder am Bodensee.
Die Qualitätsoffensive ist gelungen
1749 gründete Abt Anselm die „Ordentliche Waisenkassa“. Damals stand das Vermögen von Waisen den Vormündern zur uneingeschränkten Verfügung, was auch zum Missbrauch führen konnte. Er befahl, dass all Gelder für Waisen auf der Waisenkassa eingezahlt wurde, die unter klösterlicher Verwaltung stand. Später öffnete man die Kasse auch für Salemer Bürger und bal wurden auch Kredite vergeben. Die erste Sparkasse Deutschlands war entstanden.
Er sorgte für Schulunterricht im Herrschaftsbereich von Kloster Salem.
1765 wohnte er der Kaiserkrönung von Joseph II. (1765-1790) bei.
Abt Anselm verstarb am 23.Mai 1778.
Sein jüngerer Bruder Franz Anton Xaver Schlecht (* um 1730 – 1782) Er studierte an der Universität Salzburg Theologie und Rechtswissenschaften; später gab er letzteres zugunsten eines Musikstudiums auf.
Nach Abschluss seines Musikstudium wurde er Chorregent am Eichstätter Dom. Er lieferte auch Kompositionen fü Kloster Salem.
Sein Nachfolger wurde Robert Schlecht (1778–1802) als vorletzter regierender Abt von Kloster Salem.
Er wurde am 28. Juni 1740 in Wemding im Ries in der Diözese Eichstätt geboren. Er trat in das Kloster Salem ein und legte 1760 die Profess ab .
1766 wurde er zum Priester geweiht
1771 war er Kaplan auf dem Liebfrauenberg in Bodman, 1772 Novizenmeister, 1773 bis 1774 Hofkaplan und Verfasser des Klosterdiariums. Von 1774 bis 1777 war er Prior. Dann trat er von diesem Amt zurück und wurde Beichtvater im Zisterzienserinnenkloster Mariahof in Neudingen.
Seit 1591 war der Abt von Salem Vaterabt dieses Nonnenklosters.
Am 4. Juni 1778 unter dem Vorsitz des Kaisheimer Abtes und Generalvikars Cölestin Angelsbrugger ( 1771–1783) im zweiten Wahlgang zum Nachfolger des verstorbenen Abtes Anselm Schwab gewählt, wurde er von Generalabt François Trouvé(1748-1797)am 23. Juni 1778 und von Papst Pius VI.
(1775-1799) am 20. Juni. bestätigt
Er wurde am 8. November von Fürstbischof Maximilian Christoph von Rodt(1775-1799) benediziert. Assistent war Abt Sebastian Steinegger(1768-1807) von Wettingen, den Abt Robert schon eine Woche nach der Wahl aufgesucht und eingeladen hatte. Mit Datum 22. September 1779 ernannte ihn Generalabt Trouvé außerdem zum Generalvikar der Zisterzienserklöster in Schwaben und Tirol.
Eine der ersten Angelegenheiten waren die Streitigkeiten mit dem Hochstift und Differenzen mit der Reichsstadt Überlingen.
1780 schoss er eine Übereinkunft mit dem bischöflichen Ordinariat in Konstanz ab. Diese anerkannte die Exemption des Reichsstiftes Salem und der ihm untergebenen Frauenklöster nach Maßgabe ihrer Ordensprivilegien.
Im Gegenzug verzichtete Salem auf die Episcopaljurisdiktion für sich und die anderen Klöster.
Mit der Reichsstadt Überlingen einigte man sich auf Zahlungsmodalitäten, da Überlingen dem Kloster die niedere und hohe Gerichtsbarkeit für einen Hof überlassen hatte.
Als dort die Verhandlungen glücklich abgeschlossen waren, reiste Abt Robert persönlich nach Überlingen. Dort wurde er mit einem legendären Festmahl empfangen.
Nach Beseitigung der Misshelligkeiten war Abt Robert jetzt völliger Herr auf seinem Gebiet.
Abt Robert beendete nun den von Abt Anselm begonnen Umbau des Münsters. Anselm.
Johann Joachim Scholl Er fertigte einen Gesamtentwurf an und leitete dessen Durchführung.
Die Bildhauer und Stukkateure Johann Georg Dir (1723–1779)und Johann Georg Wieland (11742-1802)schufen die Skulpturen an den Altären und Monumenten.
Er ließ Gedenktafeln für die Stifter und eine Marmortafel mit den Namen und Sterbedaten der Salemer Äbze anfertigen.
Finanziert werden konnte die kostbare Ausstattung , weil das Haus Österreich ein Darlehen von 150.000 fl. das sind etwa 42.035.477,00 €, vorzeitig zurückgezahlt hatte.
Ab 1784 ließ der die Güter und Felder in seinem Herrschaftsgebiet durch den Geometer Franz Anton Engler vermessen und kartieren.Einige davon sind im Findbuch Dep. 30/15 T 1 des Staatsarchivs Sigmaringen erhalten.
In diesem Jahr gründete er auch das Armenhaus in Wespach, heute ein Ortsteil von Salem.
1785 führte er mit dem Erlass einer neuen Schulordnung die Volksschule im Herrschaftsgebiet ein Die Eltern mussten nun ihre Kinder von 6-14 Jahren in die Volksschule und die von 14-18 Jahren
in die Sonn-und Feiertagsschule schicken.schicken, Die Lehrer mussten sich die entsprechenden Kenntnisse aneignen und sich examinieren lassen.
Für den Erfolg der Schulen stiftete er einen Schulfond von 30.000 fl., das sind etwa 8.407.095,00 €.
Das Geld legte er verzinslich beim Steueramt an. Aus den Zinsen wurden die Lehrer und für arme Kinder die Schulbedürfnisse bezahlt
1791 ließ er ein Schulgebäude errichten.
Abt Robert war mit Nuntius Giuseppe Garampi befreundet, der seit 1776 päpstlicher Nuntius in Wien war und
als der bedeutendste Diplomat und beste Deutschlandkenner des Vatikans in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts gilt.
Er verschaffte ihm eine Audienz bei Papst Pius VI. im Benediktinerkloster St. Mang in Füssen. Dieser verlieh ihm das Altarprivileg.Er konnte dann zum Beispiel, wenn er eine Messe für Verstorbene las und dieser gedachte, ihnen einen vollkommenen Ablass zukommen lassen.
1790 verglich er sich mit der Reichsstadt Überlingen über die die Besteuerung der dortig salemitischen Güter, über Bau und Unterhaltung von Straßen und über das Pflaster und Wegegeld in Überlingen.
Abt Robert konnte auch noch namhafte Summen für die Bibliothek und das physikalische Kabinett ausgeben.ausgeben.
Er ließ ein Lehr-und Studentenhaus errichten, in dem 100 Studenten Platz fanden. Es kostete 90.000 fl, das sind etwa 25.221.286,00 €.
1789 begann mit dem Sturm auf die Bastille die französische Revolution. 1791 erließ die Nationalversammlung eine Verfassung. Sämtliche Kirchengüter wurden verstaatlicht und in Nationalgüter umgewandelt.
Die Klöster hatten damit ihre Existenzgrundlage verloren. Die Abtei Citeaux wurde an Spekulanten verkauft, aufgelöst und ausgeplündert.
Der letzte Generalabt von Citeaux François Trouvé hatte am 14. Januar 1791 die Rechte des Stammkloster an der Oberdeutschen Zisterzienserkongregation übertragen an diese übertragen.
Der Papst bestätigte dies am 15. Juli 1791.
1792 begannen die Koalitionskriege, die Kloster Salem schwer trafen.
1795 rückten französische Revolutionstruppen ins Bodenseegebiet ein.
Sie trugen die antiklerikalen Strömungen ins Land.
Abt und Konvent packten Dokumente, Archivalien,Bücher und Kirchenschätze in Kisten und flüchtetet diese ins Kloster St. Gallen.
Die Truppen hielten sich einige Tage in Salem auf, richteten aber keinen Schaden an.
Die umliegenden Klosterorte wurden aber stark mitgenommen.
1798 wurde das Klosrer durch hohe Kontributionsforderungen schwer bedrängt.
1799 kamen die Franzosen nochmals zurück und setzten ihre Erpressungen fort.
1799 suchte Abt Robert Zuflucht in Kloster Stams und 1800 in Laibach in der Krain.
Das zehrte an der Gesundheit des Abtes
Er verstarb a m 3. März 1802.
Kaspsr Oechsle
ist 24. Februar 1752 in Schömberg bei Rottweil geboren.
Er besuchte das Gymnasium der Zisterzienserabtei Salem. Er trat 1770 unter Abt Anselm Schwab in Kloster Salem ein.
1778 wurde er zum Priester geweiht.
Er unterrichtete am Klostergymnasium.
Als Bibliothekar erweiterte er die Bibliothek auf 50.000 Bände
Gelegentlich fungierte er als Organist..
Als Abt Robert krank wurde und als sein Sekretär war er sein Sekretär und seine helfende Hand.
Zu seinem Nachfolger wurde am 11. März 1802 unter dem Vorsitz des Kaisheimer Abtes Xaver Müller (1783–1802) Kaspar Oechsle zum letzten Abt von Salem gewählt.
Wegen einer Formulierung in den nach sechs Monaten eingetroffenen päpstlichen Bestätigungsurkunden verweigerte ihm der Konstanzer Bischof Karl Theodor von Dalberg
(1799 –1817 die Benediktion, die dann schließlich am 5. September der im Exil in Augsburg lebende Bischof von Valence, Gabriel Melchior de Messey( (2787-790), vornahm.
Dieser lebte nach der französischen Revolution in Augsburg im Exil
Am 15. September erhielt Abt Kaspar aus Rom die Vollmachten seines Vorgängers Robert Schlecht über die Oberdeutsche Kongregation, konnte sie aber nicht mehr ausüben, da die Kongregation mit der Säkularisation praktisch ausgelöscht wurde.
1797/1798 fand in Rastatt der Rastatter Kongress statt.Es ging um die Durchführung der Beschlüsse des Friedens von Campo Formio 17. Oktober 1797 , nämlich die Abtretung des linken Rheinufers
an Frankreich und wie die abtretenden Fürsten entschädigt werden sollten.
Im Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 wurden den deutschen Territorialherren, die linksrheinische Gebiete verloren hatten, als die kirchlichen Reichsstände und die meisten Reichsstädte zugeschlagen.
Im Reichsdeputationshauptschluss wurden dem Haus Baden die Reichsstifte Peterhausen und Salem als Entschädigung für den Verlust linksrheinische Gebiete zugesprochen.
Die Herrschaften Ostrach und Schemmerberg gingen an das Haus Thurn und Taxis.
Am 22. November 1802 übernahm das Haus Baden die Zivilverwaltung von Kloster Salem. Damit hatte das Kloster nach fast 700-jähriger Geschichte zu bestehen aufgehört.
Bei der Aufhebung des Klosters lebten 78 Mönche und 24 Laienbrüder im Kloster.
Die Mönche erhielten eine Pension von jährlich 600 fl., das sind etwa 177.946,00 €. , der Abt erhielt jährlich 8000 fl. das sind etwa 2.372.620,00 €
Salem war nicht gewaltsam zerschlagen worden. Alles war vertraglich geregelt und alle Konventsmitglieder erhielten ihre Pensionen.
Die meisten Konventsmitglieder verließen das Kloster. Viele ließen sich als Geistliche in den umliegenden Ortschaften nieder.
Bernhard Boll, der in der letzten Wahl Abt Kaspar unterlegen war, wurde zunächst Professor für Philosophie an der Universität Freiburg. 1810 wurde er dort Dekan.
Am 7. Juni 1827 wurde er zum ersten Erzbischof von Freiburg (bis 1836) bestellt, was Papst Leo XII. (1823-1829) am 27.Juni 1827 bestätigte.
Dem letzte Abt Kaspar überließen die Markgrafen von Baden das Schloss Kirchberg am Bodensee zur Wohnung.
Dort lebte er als wohltätiger Menschen freund und Vater der Armen.
Er verstarb am Kaspar am 21. Juni 1820 in Kirchberg .
Zum Zeitpunkt der Aufhebung hatte Salem enorme jährliche Einkünfte und besaß Vermögenswerte von rund drei Millionen Gulden, darunter 330 Quadratkilometer Land mit etwa 6000 Einwohnern. Dazu gehörten unter anderem die Oberämter Salem, Ostrach und Schemmerberg, die Obervogteiämter Stetten am kalten Markt und die Münchhöfe sowie die Pflegämter Ehingen und Unterelchingen.
Die Klosterbibliothek wurde größtenteils an die Universität Heidelberg verkauft.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und des Großherzogtums Baden verblieb Schloss Salem als Privatbesitz bei der Familie von Baden. 1919 richtete der entmachtete Reichskanzler Max von Baden(1867-1929) im Schloss seinen ständigen Wohnsitz ein. Das Schloss diente nun den Nachkommen der Großherzöge von Baden als „Exilwohnung“ im ehemals eigenen Land. Auch heute wird ein Teil des ehemaligen Abteigebäudes als Wohnraum genutzt.
Prinz Max lud 1920 den Pädagogen Kurt Hahn (1866-1974) zur Gründung einer Reformschule ein, die auch heute zu den renommiertesten Privatschulen des Landes zählt,
mit einer ganzen Reihe sehr bekannter Schüler z. B. Prince Philipp, Duke of Edinburg, den Gemahl von Königin Elisabeth, u nur einen zu nennen. . Dieser besuchte die Schule Salem ab 1933 für zwei Jahrgänge.
Am 3. November 2008 einigte er sich mit Ministerpräsident Günter Orttinger (2005-2010) dass das Land Baden-Württemberg das Schloss Salem und die dazugehörige Kunstsammlung für 57 Millionen Euro übernehmen werde. Davon entfallen 25 Millionen Euro auf Schloss Salem und 17 Millionen auf Kunstschätze des Hauses Baden. Weitere 15 Millionen Euro will das Land bezahlen, damit die Adelsfamilie auf ihre Besitzansprüche auf die umstrittene Zähringer Stiftung verzichtet. Am 6. April 2009 wurde der Verkauf besiegelt.