
Am 30. März 1895 wurde Josef Bürckel in Lingenfeld als Sohn des Bäckermeisters Michael Bürckel und dessen Ehefrau Magdalena geboren. Er war das jüngste von vier Kindern. In Lingenfeld
besuchte er die Volksschule. Danach ging er auf die Realschule in Karlsruhe. Von 1909 bis 1914 war er in Speyer an der Lehrerbildungsanstalt. Am 28. Juni 1914 wurde in Sarajevo der österreichische
Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau seine Frau Sophie Chotek ermordet. Das führte zur Julikrise und mündete in den 1. Weltkrieg, der am 28. Juli begann. In Deutschland befahl Kaiser Wilhelm am 1. August
die Mobilmachung. Am 3. August 1914 rief der Direktor der Lehrerbildungsanstalt in Speyer seine Schüler auf, freiwillig in die Truppe einzutreten. Die Schule würde dem keine Hindernisse
in den Weg legen, sondern die Anstalt würde sich als Ehre anrechnen, wenn auch ihre Schüler nicht hinter den Gymnasien und Hochschulen zurückstünden. Josef Bürckel war im wehrfähigen Alter und meldete
sich bereits am Mobilmachungstag beim 17b Infanterieregiment freiwillig. Am 3. November 1914 rückte er als Rekrut beim Feldartillerieregiment 12b ein. Eine erste Not-Abschlussprüfung konnte er wegen seines Heeresdienstes
nicht ablegen. Er legte sie gegen Ende des Jahres 1915 ab. Er bestand mit Erfolg. Wegen eines Herzleidens wurde er am 12. August 1915 in das Kriegslazarett in Péronne (Département Somme) eingeliefert.
Am 4. Dezember 1915 wurde er zum Unteroffizier befördert. Am 17. Mai 1916 wurde er für den Schuldienst zurückgestellt. Er begann seinen Praxisdienst als Schuldienstanwärter an der katholischen Volksschule in Lingenfeld.
Er wurde dann weiter nach Bellheim und dann nach Minfeld versetzt, wo er bis zum Ende des Schulanwärterdienst am 28. Juli 1919 blieb. Danach fand die Prüfung zur Lehreranstellung auf Lebenszeit statt.
Nach seiner Anstellung als Hilfslehrer unterrichtete er bis zum 31. Januar 1920 in Bobenheim – Roxheim. Dann wurde er nach Rodalben versetzt und dort am 1. April 1921 zum Lehrer auf Lebenszeit ernannt.
Er hatte schon am 11. Juni 1920 in Lingenfeld Hilde Spies geheiratet. Zum Zeitpunkt der Eheschließung war sie noch nicht 21. Am 21. August 1921 kam Josef Artur zur Welt. Josef Artur war während des Krieges Mitglied der Leibstandarde Adolf Hiltler.
Er fiel am 01. August 1944.
Durch Bürckels Anstellung auf Lebenszeit war die materielle Basis für die Familie des Lehrers gesichert. Am 10. März 1925 bekam die Familie nochmals Nachwuchs. Der zweite Sohn Hermann Jakob wurde geboren.
Über Bürckels Familienleben ist sonst nichts bekannt.
Auch zu seinen außerschulischen Aktivitäten, Kontakte zu Kollegen usw. gibt es kaum Informationen. Aber er war Chorleiter im Gesangverein in Rodalben und das lässt darauf schließen, dass er doch einiges Ansehen in Rodalben genoss.
Vermutlich schon 1921 trat er in die NSDAP ein. Es lässt sich nicht nachweisen, ob er in Rodalben schon parteipolitisch tätig war. Er hatte sich aber einseitig positioniert in seiner antiseparatistischen Tätigkeit und war sowohl von deutschen als
auch französischen Behörden verfolgt.
Die separatistische Bewegung setzte in der Pfalz unmittelbar nach Kriegsende ein. Am 11. November 1918 war das Waffenstillstandsabkommen von Compiègne abgeschlossen worden und ab dem 1. Dezember 1918 besetzte
die französische 8. Armee unter General Augustin Grégoire Arthur Gérard (1857-1926) die Pfalz. Bis zum Ende des Ruhrkampfs unter Reichskanzler Gustav Stresemann waren rund 60.000 Mann in der Pfalz stationiert.
In der Pfalz regten sich nun separatistische Bestrebungen. Sie gingen von bürgerlichen Kräften bis weit in die Zentrumspartei hinein aus. Man hatte Angst vor einer ungewissen Zukunft in einem womöglich bald sozialistischen
Deutschland. auch versprach man sich durch eine Anlehnung an die Sieger bei der Reparationsfrage glimpflicher davon zu kommen. 1919 war in München der bayrische und sozialistische Ministerpräsident ermordet worden.
Ab 1920 rückte Bayern nach rechts und entwickelte sich unter dem Ministerpräsidenten Gustav von Kahr zur nationalistischen “Ordnungszelle” Deutschlands. In München sammelten sich militante Rechtsradikale.
Der innenpolitische Kampf zwischen Bayern und dem Reich erfuhr in dieser Zeit eine scharfe Zuspitzung. Die Pfalz als Teil Bayerns wurde so in die Auseinandersetzung hineingezogen. Auch das ein Grund für die starke separatistische Bewegung.
Das Ende des Ruhrkampfes und die Einführung der Rentenmark und damit das Stoppen der Inflation entzogen der separatistischen Bewegung schließlich den Boden. Es gab noch zwei gewalttätige Aktionen. Am 5. November 1923 hatte Franz-Josef Heinz in Speyer die “Autonome Pfalz” ausgerufen und eine Regierung gebildet. Das war wenige Tage vor dem Hitlerputsch in München.Heinz und zwei seiner Mitarbeiter wurden am 9. Januar 1924 in Speyer erschossen. Die Kommandomitglieder stammten aus den rechtsradikalen Kampfbünden in München (Bund Wiking, Bund Oberland, SA). Das Attentat wurde mit Billigung und Geldern der bayrischen Staatsregierung ausgeführt.
Am 17. Oktober fand in Pirmasens der Sturm auf das bayrische Bezirksamt statt. Das Gebäude war in Brand gesteckt worden. 12 Separatisten, die sich in dem Gebäude befunden hatten, kamen ums Leben. Von den Angreifern starben 6 und es gab
zwölf Schwerverletzte. Bei diesem Sturm war Bürckel beteiligt. In Münchweiler und Rodalben war er so etwas wie der geistige Führer des Abwehrkampfes. Am 7. Januar 1924 musste er nach Heidelberg fliehen. Er ging dann weiter nach Niederbayern
Die Regierung von Niederbayern übertrug ihm am 24. März 1924 eine erledigte Hilfslehrerstellung. Mittlerweile war die Separatistenbewegung zusammen gebrochen und Bürckel kehrte am 9. Mai 1924 in die Pfalz zurück und nahm am nächsten Tag seinen Schuldienst in Rodalben wieder auf.
Im März und April war die selbständige Partei NSDAP der Pfalz wiedergegründet worden, nachdem die NSDAP im Juli 1923 von der interalliierten Rheinkommission (IARK) verboten worden war. Man hatte eine eigene Satzung und eigene Mitgliedskarten.
Diese Taktik der Distanzierung von München hatte Erfolg. Am 27. März 1925 erfolgte die Aufhebung des Parteienverbots für die pfälzische NSDAP durch die IARK. Am 13. März 1926 fand der erste Gautag des Jahres in Kaiserslautern statt. Unter der Leitung des Ortsgruppenleiters Richard Mann wurde Bürckel in “demokratischer Versammlung” zum Gauleiter gewählt. Er hatte sich durch ”bahnbrechende Vorarbeit die Anwartschaft” verdient. (zitiert nach Josef Bürckel: Gauleiter Reichsstatthalter Krisenmanager Adolf Hitlers , von Lothar Wettstein S. 68) Am 26. März informierte Bürckel die Reichsleitung von seiner Wahl. Allerdings war Bürckel nicht in den amtlichen Parteiunterlagen als Mitglied geführt. Deshalb forderte die Parteileitung umgehend zur Anmeldung auf. Bürckel meldete sich am 9. April 1926 an und erhielt die Mitgliedsnummer 33979. In einem von der Parteikanzlei verfassten Lebenslauf Bürckels heißt es “Der Aktivist Josef Bürckel entschied sich bereits im Jahre 1921 für den “Aktivisten” Adolf Hitler” (Wettstein S. 69)
Ein publikumswirksames Ereignis hatte Bürckel für den September 1926 geplant. Es sollte der erste Gauparteitag mit Adolf Hitler als Hauptredner werden. Der bayrische Ministerpräsident Heinrich Held hatte dies aber wegen der zu erwartenden
Auseinandersetzungen verboten. Die Besorgnis war durchaus berechtigt. Bei einer Kundgebung mit Gregor Strasser am 7. September 1926 in Kaiserslautern verhinderte nur beherztes Einschreiten der Polizei ein Blutvergießen. Strasser war in dieser Zeit bis 1928
als Reichspropagandaleiter der NSDAP tätig. Die Auseinandersetzungen mit den politischen Gegner veranlassten Bürckel den Aufbau der pfälzischen SA-Formationen voranzutreiben. Er beauftragte Fritz Schwitzgebel damit, vor allem weil dieser absolut
loyal war. Er war 1926 in die NSDAP eingetreten und wie Bürckel auch Lehrer, allerdings an der Oberrealschule (in Zweibrücken).Das zahlte sich auch für ihn aus, 1929 war er bereits SA-Standardenführer, das entspricht einem Oberst. Ab 1935 war er Führer der SA-Brigade 51 Saar-Pfalz und wurde schließlich bis zum General befördert. Bürckel hatte in seiner gesamten Laufzeit alle Parteigenossen, die irgendwie Einfluss ausüben konnten, bewusst nach seinen eigenen Kriterien ausgewählt und so sich in seinem
Umfeld eine “Hausmacht” geschaffen.
1926 hatte Bürckel auch “Der Eisenhammer” gegründet und war dessen Herausgeber. Hauptschriftleiter war zunächst Fritz Hess. Es war eine nationalsozialistische Kampfzeitung, die wohl den Stürmer von Julius Streicher zum Vorbild hatte und diesem Pamphlet in nichts nachstand. Populistische Hetze, Verleumdungen und pauschale Diskriminierungen gehörten zum Instrumentarium des Blattes.Vom 5.5. 1926-30.11. 1932 war Heinrich Förster Schriftleiter. Sowohl Hess, als auch Bürckel und Förster hatten mehrere Verurteilungen sowohl von deutschen als auch französischen Militärgerichten, meist wegen Verleumdung oder übler Nachrede, Hess auch wegen Angriffen gegen separatistisch eingestellte Beamte und jüdische Richter. Allerdings bereiteten die Prozesse vor allem die von Förster Bürckel allmählich Probleme. Führende Mitglieder aus der pfälzischen NSDAP hatten Förster vorgeworfen, dass sein allzu rüder Ton in den Artikeln immer wieder zu Prozessen führten, die sehr wohl zu vermeiden gewesen wären
und meist verloren gingen. Das verursachte immer höhere Kosten. Der Angriff richtete sich auch direkt gegen Bürckel, da dieser Förster gewähren lasse und nicht einschreite, obwohl dieser seiner Aufgabe als Redakteur nicht gewachsen sei. Damit sei
Bürckel letztlich für das finanzielle Desaster verantwortlich. Nun erklärte Förster um den Monatswechsel Februar/März herum, dass er mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt als verantwortlicher Redakteur ausgeschieden sei. Bürckel ernannte Hess als
Stellvertreter in seinem Amt als Gauleiter und erklärte, er lege seinen Posten bis zur Klärung der Vorwürfe nieder. Das war aber kein Rücktritt sondern lediglich ein “Ruhenlassen”. Es blieb so ohne Wirkung. Bürckel fuhr unvermindert mit seiner populistischen
Parteiarbeit fort. In Pirmasens und Neustadt sollten am 20. April pompöse Feiern zu Hitlers Geburtstag stattfinden. Für den 30. April berief er den Gauparteitag nach Landau. Eingeladen waren Hans Dietrich, der für die Nationalsozialistische Freiheitspartei
den Wahlkreis 26 Franken vertrat. Die NSDAP war ja nach dem Hitlerputsch verboten worden war. Dietrich hatte 1928 auch am Eisenhammer mitgearbeitet. Dann Gottfried Feder, der sich ab 1927 zum Wortführer der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik gemacht hatte. Der dritte geladene Reichstagsabgeordnete war Georg Strasser. Er hatte den revolutionären Sozialismus geprägt, den ja auch Bürckel vertrat. Strasser vertrat allerdings demokratische Grundsätze, die Bürckel radikal ablehnte.
Auch drei bayrische Landtagsabgeordnete waren eingeladen. Auch Hitler sollte an diesem Gauparteitag teilnehmen. Ob das aber nur ein geschickter Werbetrick war, lässt sich nicht feststellen. Denn die ganze Veranstaltung fand gar nicht statt. Der Stadtrat von Landau lehnte es nämlich ab, den Großen Festhallensaal zur Verfügung zu stellen. Das Reichsbanner, die 1924 gegründete “überparteiliche Schutzorganisation der Republik und der Demokratie im Kampf gegen Hakenkreuz und Sowjetstern” wie der SPD-Politiker Otto Hörsing, der sie ins Leben gerufen hatte, sie 1931 charakterisierte kündigte für 1927 ebenfalls eine Maifeier in Landau an. Da waren Zusammenstöße zu erwarten. Bürckel hatte zwar persönlich beim Stadtrat vorgesprochen, hatte aber keinen Erfolg.
Diese Schlappe war aber wohl einkalkuliert. Er schlachtete das auch sofort aus. Vor allem jüdische Stadträte hatten sich gegen die Überlassung der Stadthalle aus. Natürlich setzte Bürckel seine antijüdischen Hasstiraden fort und im Eisenhammer orakelte
er “Auch für Landauer Juden wird kommen der Tag”.
Er forcierte nun die Parteiorganisation. Er Bezirksgruppen, zuerst in Zweibrücken, Neustadt und Kusel und Ludwigshafen, danach in Landau und Frankenthal. Unabhängige propagandistischen Eigeninitiativen wurden von der Gauleitung nicht mehr geduldet.
Jede geplante Aktion und Tätigkeit musste von ihm gebilligt werden. Natürlich führte er den wachsenden Erfolg auf seine straffe Parteiführung zurück
Im Jahr 1927 hatte die NSDAP in der Pfalz ein deutliches Wachstum und auch einen Machtzuwachs verzeichnet.
Am 1. Juli 1927 wurde die Gauleitung von Lambrecht nach Neustadt verlegt. Ein ehrenamtlicher Geschäftsführer wurde eingestellt, der Bürckel entlasten sollte. Ein Untersuchungs-und Schlichtungsausschuss wurde als Parteigericht eingesetzt.
Er ließ sich zwar beraten. Aber die letzte Entscheidung behielt sich Bürckel immer vor. In seinem Gau galt das Führerprinzip auf Gauebene uneingeschränkt. Gehorsam und Unterordnung waren für Bürckel wichtiger als Eigeninitiative.
Die Querelen mit Förster gingen aber auch 1927 weiter. Er hatte sich mit der französischen Besatzungsmacht angelegt. Er wurde mehrfach zu Freiheitsstrafen verurteilt , vor allem aber drohte die Interalliierte Rheinkommission ein
Verbot des Eisenhammer an. Nun musste Bürckel einschreiten. Er schränkte den redaktionellen Verantwortungsbereich Försters stark ein und nahm die propagandistische Leitung des Verlags selbst in die Hand. Als seinen Stellvertreter
setzte er Ernst Ludwig Leyser ein. Dieser hatte NSDAP-Ortsgruppe in Neustadt und der SA-Sturm-Ortsgruppe Neustadt gegründet. Leyser stand Bürckel, wie alle, die von ihm auf irgendwelche Posten gesetzt wurden, loyal zur Seite.
Das Jahr 1928 war ein wichtiges Jahr für die NSDAP in der Pfalz. Am 28. Mai 1928 fand die Reichstagswahl statt und bei dieser Wahl trat die pfälzische NSDAP erstmals mit einer eigenen Liste an.
Mit enormem Aufwand startete die Partei. Zahlreiche öffentliche Veranstaltungen, Flugblätter und Tausende von Plakaten brachten aber einen kaum nennenswerten Mitgliederzuwachs. Bürckel erkannte,dass es taktisch falsch
war, sich mit der Propaganda auf die städtische Mittelschicht zu konzentrieren, die ländliche Bevölkerung, auch als Wählerschicht, aber zu vernachlässigen. Das ländlichen Gebiete der Nordpfalz wurden nun in verstärkte Werbeaktionen einbezogen
und diese waren erfolgreich. Bürckel sah sich bestätigt. In den Städten hatte die Partei bereits Fuss gefasst. Sie war in allen Städten vertreten nur in der Kreishauptstadt Speyer noch nicht. Am 10. März 1928 veranstalte Bürckel eine große Veranstaltung in Speyer mit dem
Reichstagsabgeordneten Friedrich. Nur wenige Tage später wurde die Speyrer Ortsgruppe sowie ein SA-Sturm gegründet. Die Ortsgruppe hatte Rudolf Trampler gegründet, der von Joseph Goebbels später am 21. August 1933 zum Landeskulturwart
der Reichspropagandastelle Rheinpfalz ernannt wurde. In den letzten beiden Kriegsjahren bekleideter er das Amt des Oberbürgermeisters von Speyer.
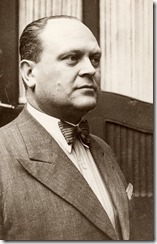
Am 28. Mai 1928 fand die Reichstagswahl statt. Für die NSDAP verlief sie enttäuschend. Sie hatte 2,6 % der Stimmen erzielt, 0,4 weniger als bei den letzten Wahlen. Sie verlor auch 2 Abgeordnete und hatte im Reichstag jetzt 12 Sitze.
Zugewonnen hatte dagegen die SPD mit 3,8 % Zuwachs und 22 Mandaten mehr. Auch die KPD verzeichnete Gewinne und zwar 1,7 % und 9 Mandate mehr. Noch etwas mehr konnte die Reichspartei des deutschen Mittelstandes dazu gewinnen,
nämlich 2,2% Stimmenzuwachs und 11 Mandate mehr. Es war eigentlich ein gefährliches Ergebnis, denn die bürgerlichen Parteien schlossen daraus, die NSDAP habe ihren Zenit bereits überschritten. Bürckel konnte aber mit “seinem”
Ergebnis mehr als zufrieden sein. Die NSDAP hatte in der Pfalz 5,7 % der Stimmen geholt, mehr als doppelt soviel wie auf Reichsebene und das Ergebnis der Wahlen von 1924 hatte er verdreifacht. 1924 entfielen auf die NSDAP 1,9 % der Stimmen.
Das machte natürlich Bürckel innerhalb der NSDAP stark. Bei Hitler stand er ohnehin in hohem Ansehen. Die NSDAP erhöhte ihre Werbeanstrengungen in den Bezirken Landau und Bergzabern. Das zahlte sich bereits ein Jahr später bei den Kommunalwahlen aus.
Zwei Monate nach den Wahlen fand auch der erste Gauparteitag in Pirmasens statt. Auch ein publikumswirksamer Marsch von 300 SA-Leuten durch Pirmasens wurde durchgeführt. Die bürgerliche Presse berichtete darüber nichts.
Sie hatte sich ohnehin für “Totschweigen” entschieden. Die weitere Entwicklung zeigt, dass da nicht unbedingt der richtige Weg war.
Bürckel schliff weiter an seiner Parteiorganisation. In seinem Führungskader sorgte er für rhetorisch besonders geschulte Parteiredner. Damit konnte er die Zahl seiner Veranstaltungen steigern. Der Zustrom potentieller Wähler nahm zu.
Er suchte die Auseinandersetzung mit den anderen Parteien auf seine Art. Öffentliche Kundgebungen ließ er oft -und zeitgleich mit Veranstaltungen der anderen Parteien abhalten. Er hoffte so, die Zuhörer für sich zu gewinnen.
Für das Jahr 1929 verlangte er von seinen Parteigenossen bedingungslosen und rücksichtslosen persönlichen Einsatz. Angst vor Straßenkämpfen oder Saalschlachten durfte es nicht geben. Nur dabei sein,
war nicht genug. Nur die KPD postulierte eine ähnliche Hingabe. Logische Folge war, dass die gewalttätigen Auseinandersetzungen hauptsächlich zwischen dem Roten Frontkämpferbund der KPD und der SA stattfanden.
1929 ließ er wieder prominente NS-Parteiführer auftreten. Goebbels sprach am 6. März 1929 erst in Zweibrücken und einige Stunden später in Pirmasens. Gottfried Feder trat drei Tage später in Speyer auf. Der Erfolg zeigte sich rasch.
In der Nordpfalz entstanden neue Ortsgruppen, in Frankenthal erhöhte sich die Mitgliederzahl um 40 %.
Nach den Kommunalwahlen war die Partei fast in allen Gemeinden vertreten. In Landau hatte die Partei erstmals kandidiert und hatte bei ihrer ersten Wahl sofort mit der SPD gleichgezogen.
1930 scheiterte die letzte parlamentarische Regierung der Weimarer Republik im März 1930. Hindenburg ernannte nun den Zentrumspolitiker Heinrich Brüning, der zunächst mit der Notverordnung zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen
regierte. Als auf Antrag der SPD diese gemäß Artikel 48 in der Weimarer Verfassung das Parlament von seinem Recht Gebrauch machte, die Notverordnung wieder aufzuheben, bat Brüning Hindenburg den Reichstag aufzulösen.
Die Neuwahlen wurden für den 14. September 1930 festgelegt. Bei der NSDAP gab es eine Premiere. Erstmals organisierte Joseph Goebbels den Wahlkampf der Nationalsozialisten zentral. Man verzichtete weitgehend auf antisemitistische Parolen.
Man prangerte den Verfall Deutschlands im “System Weimar” an, beschwor die Volksgemeinschaft. Wichtiges Thema war natürlich die Weltwirtschaftskrise, die als Komplott gegen Deutschland dargestellt wurde. Hitler engagierte sich in diesem Wahlkampf enorm. Zwischen dem 3. August und dem 13.September trat er in mehr als 20 Großveranstaltungen als Hauptredner auf. Für Bürckel war diese Wahl in doppelter Hinsicht bedeutsam. Erstens wollte er natürlich ein beeindruckendes Ergebnis erzielen. Vor allem aber kandidierte er erstmals in einer Listenverbindung mit dem Wahlkreis Franken erstmals als Abgeordneter für die pfälzische NSDAP, und das mit ausdrücklicher Billigung Hitlers. Hitler unterstützte Bürckel auch persönlich. Auf einer der Großveranstaltungen
trat er am 26. August 1930 in der Eberthalle in Ludwigshafen auf. Das war das erste offizielle Auftreten Hitlers in der Pfalz. Am 30. Juni 1930 war Frankreich aus Mainz und der Pfalz abgezogen, nachdem Deutschland am 21. August 1929 den Youngplan angenommen
hatte, der die deutschen Reparationsverpflichtungen neuregelte. Darin war auch der Abzug Frankreichs festgelegt worden.
Es war ein blutiger Wahlkampf mit Zusammenstößen, Straßenschlachten und auch mit Toten. Am 14. September wurde gewählt, mit einer Wahlbeteiligung von 82,0 %, man vergleiche das mal mit der Wahlbeteiligung von heute!
Die NSDAP erzielte erdrutschartige Erfolge. Sie bekam 18, 3 % der Stimmen, was gegenüber der letzten Wahl einen Zuwachs von 15,7 % der Stimmen bedeutete. Mandate erhielt sie 107, also 95 mehr als 1928 und war hinter der SPD zweitstärkste
Kraft. Die SPD hatte 10 Sitze verloren, war aber mit 143 Sitzen immer noch stärkste Kraft. Nur die KPD (+ 2,5 %) und die Christlich-Nationale Bauern-und Landvolkpartei (+ 1,3 %) konnten Zugewinne erzielen.
Die pfälzische NSDAP lag auch bei dieser Wahl mit 22, 8 % der Stimmen deutlich über dem Reichsschnitt und auch über Bayern, wo die Nationalsozialisten 17,9 % errangen. In der Pfalz hatte die NSDAP sogar die SPD mit 0,4 % hinter sich gelassen
und war die stärkste Kraft geworden. Sie hatte 2, die SPD dagegen nur 1 Mandat errungen. Das 4. Pfälzer Mandat erhielt die Bayrische Volkspartei, die mit 12,8 % knapp vor dem Zentrum (12,1 %)
Eine Sonderstellung nahm das Dorf Darstein ein. Es war die erste Gemeinde deutschlandweit mit 100 % Stimmen für die NSADAP. Das Dorf hatte bei 156 Einwohnern 106 Wähler. Natürlich bejubelte die nationalsozialistische Presse dieses Ergebnis.
Der Eisenhammer schrieb in seinem Artikel “Ein rein nationalsozialistisches Dorf” Darstein sei Vorbild für das ganze Reich. Als die Nazis an der Macht waren, wurde es zum Ehrendorf der NSDAP ernannt,. 1936 wurde in Köpenick sogar eine Straße nach Darstein benannt. Den “Darsteiner Weg” gibt es heute noch, er überdauerte sogar den Sozialismus. Darstein war übrigens protestantisch, die Konfessionsgrenzen waren damals sehr scharf. In katholischen Gemeinden waren meist halb so hoch wie in protestantischen Gemeinden. Auch die Gemeindegröße spielte eine Rolle. Je kleiner der Ort, desto größer die Chance für die Nationalsozialisten. So hatte sich die Strategie, in ländlichen Gegenden zu agitieren, als richtig erwiesen.
Neben Bürckel kam Wilhelm Frick für die Pfalz in den Reichstag. Er war 1930 Innenminister in Thüringen und damit der erste nationalsozialistische Minister überhaupt in Deutschland. Er hatte am Hitlerputsch teilgenommen und Hitler
schätzte ihn als “durchgekochten Nationalsozialisten”.
Für Bürckel war die Wahl voll aufgegangen. Seine parteiinternen Gegner verstummten. Nun war er plötzlich über seinen Gau hinaus bekannt geworden. Er wurde öffentlich wahrgenommen.
Ab 1930 hatte Bürckel außer dem Eisenhammer auch die NSZ-Rheinfront herausgegeben. Sehr schnell wandelte er diese in eine GmbH um, die finanziellen Schwierigkeiten des Eisenhammers, die er ja erlebt hatte, hatten ihn zu diesem Schritt gebracht.
Mit Billigung Hitlers hatte er diese Mitte der 30-iger Jahre in die “Josef-Bürckel-Stiftung “ eingebracht. Sie umfasste ein großes Verlagssystem. Seine Pfälzer Parteigenossen trieb er zur ständigen Abonnentenwerbung an. Außerdem erhielten alle Parteigenossen
die Anweisung, nur in der NSZ-Rheinfront zu inserieren. Außerdem wurden alle Parteigenossen mit Parteiausschluss bedroht, wenn sie eine nicht nationalsozialistische oder neben der NSZ-Rheinfront noch eine Nicht-NS-Zeitung abonniert hatten.
Außerdem war es ihnen verboten, in anderen Zeitungen zu inserieren. Gegen die anderen Pfälzer Presseorgane wurde recht hemdsärmelig vorgegangen. Amtliche Bekanntmachungen oder Anzeigen wurden ohne Rücksicht auf bestehende
Verträge entzogen.Dann wurden oft polemisch-verleumderische Vorwürfe gegen Redakteure und Verlagsleitungen erhoben. Man machte den Zeitungen also das Leben schwer, wo es nur ging. Bald war die NSZ-Rheinfront das auflagenstärkste
Presseorgan der Pfalz. Erstaunlich aber ist, dass sich Bürckel mit seinem Verlag, dessen Reichweite sich weit über die Pfalz hinaus erstreckte, über Metz, Nancy,Riga, Kiew, Athen bis nach Tromsoe, der Zentralisierung der regionalen Parteizeitungen
durch die Parteileitung widersetzen konnte. Max Amann war seit 1933 Präsident der Reichspressekammer, einer Unterabteilung der von Goebbels geleiteten Reichskulturkammer. Er kontrollierte praktisch die gesamte deutsche Presse. In diesem Dreigestirn
um die Macht im Pressewesen war noch Dr. Otto Dietrich, der am 30.April 1933 zum Vorsitzenden des Reichsverbandes der Deutschen Presse gewählt wurde. Goebbels setzte sich erst Ende März 1945, kurz vor seinem Selbstmord endgültig durch.
Bürckel hatte aber die Stellung seines Presseimperiums wahren können.
1927 hatte sich in Berliner Großbetrieben so etwas wie eine nationalsozialistische Arbeitnehmervertretung gebildet, die sich an der betriebsbezogenen Organisationstruktur der Revolutionären Gewerkschafts-Opposition der KPD orientierte.
1928 wurde daraus die NSBO, die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation. Die sich verschärfende Weltwirtschaftskrise hatte auch die NSBO mehr und mehr in ein sozialistisches Fahrwasser gleiten lassen. Die Reichsleitung der NSDAP
konnte sich daher mit der NSBO zunächst nicht anfreunden. Die Reichstagswahlen vom September 1930 hatten aber gezeigt, dass die NSDAP auch bei Arbeitern immer mehr Anklang fand. Bürckel, der ja ohnehin für die sozialistische Ausrichtung
seiner Partei ähnlich wie Georg Strasser stand, erkannte sofort die Chancen, die sich daraus ergaben. Und wie er einige Jahre zuvor dafür gesorgt hatte, dass sich die NSDAP mit ihrer Werbung auf ländliche Bereiche konzentriert hatte, nahm er nun
die Arbeiterschaft ins Visier.
Ende Januar wurde in Kaiserslautern die “NSBO-Pfaff” gegründet. Pfaff war damals die zweitgrößte Nähmaschinenfabrik in Europa.Die Arbeit übernahm für ihn vor allem Claus Selzer. Er war seit 1930 in Ludwigshafen und dort Ortsgruppen und Kreisleiter
der NSDAP. Ab 1932 war er Reichstagsabgeordneter und 1934 war er Stellvertretender Leiter der NSBO. Seine Karriere beendete er als Generalkommissar von Dnjepropetrowsk, wo er 1944 angeblich an einer Fischvergiftung starb.
Bis Mitte 1931 hatte Selzer bereits 11 NSBO gegründet und mit großem Tempo ging es weiter. Im September gab es bereits 31 Betriebszellen, unter anderem in Ludwigshafen bei der IG Farben, der heutigen BASF.
Organisatorisch vereinfacht wurde die Arbeit durch die Umsiedlung de Gaubetriebszelle nach Neustadt in die Räume der Gauleitung, mit Erfolg wie die Zahlen belegen. Zum Jahresende gab es 48 Zellen mit über 1000 organisierten Mitgliedern.
Ein halbes Jahr später gab es 320 Zellen mit 6.698 organisierten Mitgliedern. Eine wichtige Etappe dahin waren die Betriebsratswahlen im März 1931. Diese wurden von der Gauleitung so konzentriert angegangen, als ob es sich um eine Reichstagswahl handelte.
Öffentliche Großveranstaltungen wurden abgehalten. Die Redner waren eigens für die Auseinandersetzung mit den gewerkschaftlichen Gegnern geschult worden. Die NSBO Kandidaten sollten über Kenntnisse verfügen, die es ihnen ermöglichte,
die Aufgabe eines Betriebsrates für alle Arbeitnehmer erfüllen zu können. Er selbst hielt sich bei diesen Veranstaltungen völlig zurück. Es gelang, der breiten Öffentlichkeit den Eindruck zu vermitteln, die NSBO sei eine von der NSDAP unabhängige
und nicht von ihr gesteuerte Organisation. Wieder hatte Bürckel sein politisches Gespür bewiesen, der Partei schon vor 1933 eine neue Zielgruppe zugeführt und sich selbst als fähigen Gauleiter gezeigt und sein persönliches Ansehen beim Führer gesteigert.
Die erste Amtszeit des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg endete am 25. April 1932. Brüning hatte vorher versucht, die Amtszeit Hindenburgs verlängern zu lassen. Das aber hätte eine Verfassungsänderung bedurft, zu der eine Zweidrittelmehrheit
notwendig war. Um diese Mehrheit zu bekommen, brauchte Brüning aber die Stimmen der Rechten. DNVP und NSDAP lehnten Brünings Vorschläge ab, obwohl er vor allem Hitler weitreichende Zugeständnisse gemacht hatte. Hitler schlachtete dies sofort aus
und spielte sogar den Hüter der Verfassung. Eine vom Gesetz vorgesehene Volkswahl musste also abgehalten werden. Ein “Hindenburgausschuss” wurde ins Leben gerufen, der den bisherigen Präsidenten zur erneuten Kandidatur bewegen sollte.
Schließlich erklärte sich Hindenburg bereit, noch einmal zur Wahl anzutreten. Die Harzburger Front war auseinander gebrochen. DNVP und Stahlhelm. Sie wollten Hitler nicht den Sprung ins Präsidentenamt ermöglichen. Sie stellten mit Theodor Duesterberg einen
eigenen Kandidaten auf. Hitler hatte seinen Hut schon in den Ring geworfen. Göring hatte das schon in einer Rede im Sportpalast angekündigt. Allerdings war Hitler zu der Zeit staatenlos, konnte also gar nicht kandidieren. Ein Kunstkniff machte es
möglich. Im Freistaat Braunschweig regierte eine NSDAP-DNVP-Koalition. Der Freistaat ernannte ihn zum Schein zum Gesandten bei der Landesvertretung in Berlin.Das war ein Staatsbeamter und damit war automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft
verbunden. Für die KPD stand Ernst Thälmann zur Wahl. Außerdem trat noch Gustav A.Winter für die Inflationsgeschädigten an.
Die Wahlbeteiligung war mit 86,2 % hoch. im ersten Wahlgang erreichte aber keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit, so dass ein zweiter Wahlgang erforderlich war.
Jetzt genügte die einfache Mehrheit. Hindenburg gewann mit 53,1 %. Hitler kam auf 36,7 % der Stimmen. Das war zwar ein deutlicher Zuwachs gegenüber der Reichstagswahl, 5 Millionen Stimmen mehr. Aber mit der eigenen Propaganda hatte man die Erwartungen so hoch geschraubt, dass das Ergebnis als Niederlage empfunden wurde. In der Pfalz hatte man gegenüber der Reichstagswahl 90.000 stimmen dazu gewonnen. Man war zwar enttäuscht aber doch stolz auf den Zugewinn. Bürckel erklärte seinen Anhängern “Die Schlacht ist aus, der Krieg geht weiter”
Hindenburg hatte seinen Sieg hauptsächlich den Sozialdemokraten und Katholiken zu verdanken, was er als Schmach empfand. Sein Groll richtete sich aber gegen Brüning, der sich im Wahlkampf wie kein anderer für ihn eingesetzt hatte.
Das Reparationsproblem stand kurz vor seiner endgültigen Lösung. In der vom 16. Juni bis 9. Juli tagenden Konferenz aller betroffenen Staaten hatte man sich auf völlige Streichung der Reparationsschuld Deutschlands geeinigt. Zuvor aber hatte sich Brüning
die Sympathie der Präsidentenberater verscherzt, vor allem, weil er sich nicht als Marionette benutzen lassen wollte. Das war einmal Otto Meissner, der sowohl Mitarbeiter von Friedrich Ebert als auch von Hindenburg war. Er war engster Mitarbeiter
der Präsidenten Ebert und Hindenburg und arbeitete als Staatssekretär im Büro des Reichspräsidenten. Er war aber auch Chef der Präsidialkanzlei des Führers und das von 1933-1945. Dann ist Hindenburgs Sohn Oskar der in dieser Zeit als Adjutant seines Vaters gearbeitet hat. Tucholsky sagt über ihn. Es sei der “in der Verfassung nicht vorgesehene Sohn des Reichspräsidenten”. Der Stuttgarter Historiker Wolfram Pyta schreibt in seiner umfassenden Hindenburgbiographie allerdings, dass Hindenburg sehr wohl gewusst habe, was er tue und nicht von “einer Kamarilla” gesteuert gewesen sei.
Brüning hatte auf Wunsch vieler Länder, auch Bayerns und Preussens beim Reichspräsidenten ein Verbot der SA und SS erwirkt, die er als Hauptursache der politischen Gewalt sah. Das war der Hauptgrund, der Brüning zu Fall brachte.
Brüning wollte den ostelbischen Gütern im Mai 1932 eine kräftige Finanzspritze zukommen lassen. Allerdings sollte der Staat nicht mehr sanierungsfähige Güter aufkaufen bzw. ersteigern und diese in Bauernstellen für Arbeitslose aufteilen.
Das wurde beim Präsidenten als “Agrarbolschewismus” denunziert. Der Entlassgrund war gefunden. Hindenburg entzog am 29. Mai dem Kanzler das Recht auf die Anwendung der Notverordnung (Artikel 48 der Weimarer Verfassung).
Brüning musste zurücktreten “hundert Meter vor dem Ziel”, wie er das selbst empfand. Im Vorfeld hatte es Geheimverhandlungen zwischen Schleicher und Hitler gegeben. Hitler hatte zugesagt, eine neue Regierung parlamentarisch zu tolerieren,
wenn das SA-Verbot aufgehoben würde und Neuwahlen durchgeführt wurden. Brüning wurde also entlassen. Am 31. Juli wurden die Wahlen zum 6. Reichstag festgelegt.
Die Zeit für den Wahlkampf war nun äußerst knapp.
Die NSDAP hatte schon gleich nach der Wahl des Reichspräsidenten ihre Taktik geändert. Sie hielt ihre Versammlungen oft in von Linken bevorzugte Kneipen und nahm bewusst gewalttätige Auseinandersetzungen in Kauf. Außerdem spulte sie ein enormes
Auftrittspensum in der Öffentlichkeit ab. Täglich wurden Kundgebungen, Aufmärsche und öffentliche Versammlungen abgehalten. Das vermittelte den Eindruck großer Tatkraft und man konnte daraus den Schluss ziehen, dass die NSDAP in der Lage sein
werde, die großen Probleme, die anstanden, zum Wohle aller lösen zu können. Auch Anlässe, die nicht mit den Wahlen zusammenhingen, wurden benutzt, Aufmerksamkeit zu erregen.
1932 jährte sich zum Beispiel das Hambacher Fest zum 100. Mal. Reichsinnenminister Dr. Josef Wirth plante zum Jubiläum eine große gesamtdeutsche Feier. Die pfälzische Presse organisierte das Fest und wollte es frei von parteipolitischen
Aspekten halten. Festredner war Theodor Heuss, Mitglied des Reichstages von 1924 bis 1928 und 1930-1933. Bürckel sprach von einem demokratischen Rummel. Er erklärte, es sei das Fest eines ersterbenden Systems. Die 1832 beteiligten
Juden, z.B. Ludwig Börne überschüttete er mit antisemitischen Hasstiraden. Verstärkt wurde das durch Berichte in der nationalsozialistischen Presse, die sich gegen die Demokratie überhaupt wandte. Gleichzeitig wurden die Veranstalter des Festes von 1832 zu
Vorkämpfern für ein Drittes Deutschen Reichs hochstilisiert.
Zu schaffen machte der NSDAP das SA und SS-Uniformverbot, das ja Brüning durchgesetzt hatte. Zwar hatte von Papen gemäß den zwischen Schleicher und Hitler abgemachte Aufhebung des Verbotes am 16. Juni 1932 aufgehoben. Nun setzte der Straßenterror wieder ein. Die bayrische Regierung hatte aber gestützt auf ihre Polizeihoheit das Verbot bis 30. September 1932 verlängert. Für die NSDAP wirkte sich das noch verschärfend aus, da die bayrische Regierung alle Aufmärsche und Versammlungen unter freiem
Himmel verboten hatte und bei Zuwiderhandlung mit Gefängnisstrafe gedroht hatte. Daraufhin erschienen die bayrischen nationalsozialistischen Abgeordneten in Uniform im Landtag. Trotz mehrfacher Aufforderung verließen sie den Saal nicht.
Daraufhin ließ der Landtagspräsident den Saal von der Polizei räumen. Von Papen war nun gezwungen, das Verbot aufzuheben. Bürckel wurde von der Aufhebung des Verbots noch vor der öffentlichen Verkündigung informiert und organisierte sofort
einen Demonstrationszug von mehr als 300 uniformierten SA und SS Männer.Da die Aufhebung noch nicht bekannt war, wurde in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, diese Männer seien bereit, für ihre politische Überzeugung auch ins Gefängnis
zu gehen. Punktsieg für Bürckel.
Am 31. Juli wurde schließlich gewählt. Die Wahlbeteiligung war mit 84,1 % wieder sehr hoch. Klarer Sieger war die NSDAP. Sie hatte 37,2 % der Stimmen errungen, gegenüber 1930 also nochmals ein Zuwachs von 19 % und auch die Zahl ihrer Abgeordneten
hatte sie mehr als verdoppelt. Statt 107 Sitze erhielt sie nun 230, also 123 Mandate mehr als 1930. In der Pfalz aber hatte die NSDAP ein geradezu triumphales Ergebnis erzielt. Sie erzielte 43, 7 % der Stimmen. Sie war stärkste Partei in der Pfalz, lag aber auch in ganz Süddeutschland an der Spitze. Nur Hessen-Nassau kam mit 43,6% ganz knapp an das Pfälzer Ergebnis. Württemberg erzielte 30,3 %, Baden 36,9 % Franken 39,9 %. Nur im Osten hatten einige Wahlkreise noch besser abgeschnitten. Reichsweit das beste Ergebnis für die NSDAP holte Schleswig-Holstein mit 51,0 %. Bürckel hatte mit diesem Resultat die Gunst Hitlers voll erworben und konnte sich nun ständig der Rückendeckung des Führers sicher sein.
Trotz dieses beeindruckenden Wahlergebnisses reichte es nicht zur Übernahme der Regierungsgewalt. Zur absoluten Mehrheit hatte es für die NSDAP nicht gereicht. Hitler beendete nun die Tolerierung von Papens. Von Schleicher bot Hitler eine Regierungsbeteiligung an. Das lehnte dieser aber ab und forderte eine Neubildung der Regierung unter seiner Führung. Aber nur mit BVP und Zentrum zusammen hätte Hitler genug Sitze für eine Regierungsbildung gehabt. Einen Reichstagspräsidenten
Hermann Göring trug das Zentrum mit, mehr aber nicht. Auf eine Regierung Hitler ließ sich Hindenburg nicht ein. Das hielt er für nicht verantwortbar. Also ernannte er nun Franz von Papen zum Reichskanzler. In der einzigen regulären Sitzung des Reichstags erlitt von Papen zwar eine schwere Niederlage, blieb aber zunächst im Amt. Der Reichstag wurde aufgelöst und Neuwahlen für den 6. November 1932 angesetzt.
In den vorausgegangenen Wahlkämpfen hatte sich die NSDAP völlig verausgabt und auch kräftemäßig war man bis an die Grenzen gegangen.
Für den nun folgenden Wahlkampf setzte die Pfälzer NSDAP eigens hergestellte Tonfilme über Auftritte von Hitler, Göring und Straßer und anderen Parteigrößen ein. Das war ein völlig neues Werbemittel.
Am 6. November 1932 wurde gewählt. Die Wahlbeteiligung lag mit 80,6 % deutlich niedriger als noch im Juli. Die Nationalsozialisten mussten Verluste hinnehmen. Sie verlor 4,2 und erhielt 33,1% was auch einen Verlust von 34 Sitzen gegenüber
den Juliwahlen bedeutete. In der Pfalz hatte es immerhin noch für 42,5 % gereicht. Sie lag also mit nur 1,2 % Verlust deutlich unter dem Reichsschnitt. Nur die KPD und die DNVP konnte Zugewinne erzielen. Bemerkenswert sind die Zugewinne der DNVP . Sie hatte nämlich die Regierung von Papen unterstützt. Man kann das also durchaus auch für eine Zustimmung der Regierung von Papen werten. Allerdings hatte die Wahl keine rechnerisch mehr mögliche Mehrheit von NSDAP, BVP und Zentrum mehr ermöglicht. Nur die klar antiparlamentarischen Parteien NSDAP, KPD und DNVP verfügten zusammen über eine Mehrheit.
Von Schleicher hoffte, den gemäßigten Flügel der NSDAP um Gregor Strasser für eine Regierungsbeteiligung zu gewinnen, was der NSDAP auch innerparteiliche Schwierigkeiten bereitet hätte, zumal da ja der Machtkampf zwischen Strasser und Hitler stattfand.
Auch glaubte er, die freien Gewerkschaften ins Boot holen zu können. So hätte er eine Regierung quer durch alle Lager mit parlamentarischer Mehrheit zustande gebracht. Das Konzept überzeugte von Hindenburg. Er entließ von Papen und beauftragte von
Schleicher mit der Regierungsbildung. Die Gewerkschaften zögerten aber. Von Schleicher hatte Strasser die Vizekanzlerschaft und den Posten des preussischen Ministerpräsidenten. Strasser aber fühlte sich Hitler immer noch verbunden und informierte ihn über
die Gespräche mit von Schleicher. Gleichzeitig beschwor er ihn, von der “Alles oder Nichts” Politik abzugehen und die Vizekanzlerschaft anzunehmen. Dazu fühlte sich aber Hitler zu stark und lehnte ab. Enttäuschte legte Strasser am 8. Dezember alle
Parteiämter nieder und reiste nach Italien ab. Hitler übernahm die meisten Ämter selbst, den Rest teilte er unter Goebbels, Darré und Hess auf. Er rief alle Reichstagsabgeordneten der NSDAP ins Palais des Reichspräsidenten und ließ sich dort ein “Gelöbnis
unwandelbarer Treue zum Führer und Schöpfer der Bewegung” geben. Auch die Gauleiter und Landesinspektoren gaben eine öffentliche Treueerklärung ab. Ein möglicher Putschversuch war so im Vorfeld abgeblockt. Von Schleichers Plan war der zweite wichtige Baustein weggefallen. Strasser zog sich nach dem 30. Januar 1933 ins Privatleben zurück und übernahm bei der Firma Schering Kahlbaum mit Hitlers Genehmigung eine Direktionsstelle in Berlin. Im Zuge des Röhmputsches wurde er aber am 30. Juni 1934
von der Gestapo verschleppt und ermordet.
Im gesamten Reich wurden insgesamt 18 Gautagungen durchgeführt, bei denen die Parteigenossen über die Ereignisse informiert wurden. Die Pfälzer Gautagung fand am 11. Dezember 1932 in Neustadt statt. Hauptredner war Dr. Robert Ley, der am
8. Dezember von Hitler zum Reichsorganisationsleiter der NSDAP ernannt worden war. Für die Pfälzer NSDAP sprachen Willy Schmelcher, der bis 1934 Fraktionsvorsitzender der NSDAP im Stadtrat von Neustadt war, dann Schwitzgebel, der ja schon mit dem Aufbau der SA-Formationen von Bürckel betraut worden war. Dann sprach natürlich auch Bürckel, der sich aber immer wieder auf die Gedanken von Gregor Strasser berief.
Nachdem von Schleicher mit seiner Kabinettsbildung nicht vorwärts kam, hatte von Papen sich zwei Mal mit Hitler getroffen und zwar am 4. und 10.Januar, ohne dass das von Schleicher wusste. Am 15. Januar war die NSDAP in Lippe bei der
Landtagswahl stärkste Kraft geworden. Am 18. Januar sprach von Papen nun mit einem größeren Kreis. Auch Himmler und Röhm waren dabei. Am 28. Januar trat von Schleicher zurück, da seine Verhandlungen zur Unterstützung seiner Regierung erfolglos geblieben waren.
Von Hindenburg aber lehnte von Schleichers Staatsnotstandplan ab. Am 29. Januar einigten sich von Papen und Hitler. Von Papen legte Hindenburg eine Kabinettsliste vor. Am 30. Januar ernannte der Reichspräsident Hitler zum Reichskanzler.

Die NSDAP und Hitler waren am Ziel. Zunächst waren nur zwei Nationalsozialisten im Kabinett. Wilhelm Frick war Innenminister und Hermann Göring war Minister ohne Geschäftsbereich. Am 10. Februar hielt Hitler seine erste große öffentliche
Rede, nachdem er zum Reichskanzler ernannt worden war.
“Deutsches Volk! Gib uns vier Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns vier Jahre, und ich schwöre dir: So wie wir, und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst wegen.“
Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler war der Reichstag am 1. Februar aufgelöst worden. Deshalb waren Neuwahlen notwendig geworden, die am 5. März 1933 abgehalten wurden.
Die veränderte Lage hatte auch die Parteikassen wieder prall gefüllt, vor allem die Industrie hatte jetzt finanziert. Bürckel setzte bei seinem jetzigen Wahlkampf auch den Rundfunk als neues wirksames Medium ein. Auch neu in der Gaugeschichte,
er band jetzt die Frauen der Parteigenossen aktiv in den Wahlkampf ein.
Vom 27. auf den 28. Februar brannte der Reichstag. Schon am 4. Februar war Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des Deutschen Volkes des Deutschen Volkes erlassen worden. Sie schränkte die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit
stark ein und wurde vor allem genutzt, den politischen Gegner der NSDAP zu bekämpfen. Am Tag nach dem Reichstagsbrand wurde die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat erlassen, fast gleichlautend wie die Verordnung
vom 4. Februar. Sie setzte die Bürgerrechte der Weimarer Republik weitgehend außer Kraft. Sie war auch als Reichstagsbrandverordnung bezeichnet worden. Die Strukturen der KPD wurden praktisch zerschlagen. Trotz des rigorosen Einetzens dieses Instrumentes
schaffte die NSDAP die absolute Mehrheit nicht. Die Wahlbeteiligung war mit 88,74 % enorm hoch. Die NSDAP legte nochmals enorm zu, kam aber “nur” auf 43,9 %. Die KPD hatte 4,6 % verloren und kam auf 12,3 %. Wenn man aber bedenkt, welch enormem Terror die KPD ausgesetzt war, ist das gerade unter diesen irregulären Bedingungen ein ganz starkes Ergebnis. In der Pfalz wählten 46,5 % die NSDAP. Einen Sitz gewann man wieder dazu und hatte damit wie bei der Wahl vom Juli 1932 wieder 4 Mandate.
Bürckel hatte wieder mehr Stimmen als im Reichsdurchschnitt eingefahren. In 11 pfälzischen Amtsbezirken war die absolute Mehrheit geschafft worden.Ein total aus dem Rahmen fallendes Ergebnis sei aber auch noch erwähnt. War Darstein bei der Wahl von 1930
“ein rein nationalsozialistisches Dorf” geworden, so wählte das nur wenige Kilometer entfernt gelegene Hauenstein im März 1993 mit 92,6 % aller Stimmen die gemeinsame Liste von BVP und Zentrum. Es war damit reichsweit das höchste Ergebnis einer nicht nationalsozialistischen Partei. Die NSDAP kam in Hauenstein nur auf 4,8 %.
In Ludwigshafen, der “marxistischen Hochburg” wurden 34,3 % erreicht. Das waren zwar gut 10 % unter dem Reichsdurchschnitt. Aber Bürckel ließ das natürlich von einem Fackelzug durch Ludwigshafen feiern. Dem aus Parteiorganisation bestehende
Demonstrationszug schlossen sich Beamtenorganisationen, Militärvereine und berittene Landespolizei an (Wettstein S. 141). Auch forderte er “die Auflösung des bayrischen Landtages und sämtlicher Selbstverwaltungskörper und unverzügliche Ausschreibung von
Neuwahlen” (Wettstein ebda). Schließlich entsprächen sie nicht mehr der Mehrheit des bayrischen Volkes. In Bayern ging das sehr schnell, wobei Bayern das letzte Land war, in dem die Landesregierung abgesetzt wurde.
Den Anfang machte Hamburg noch am Abend der Reichstagswahl. Am nächsten Tag folgten Lübeck Bremen und Hessen. Am 8. Mai waren Württemberg, Baden, Sachsen und Schaumburg-Lippe dran.Am 9. März 1933 übertrug Innenminister Frick die vollziehende Gewalt in Bayern auf Franz Ritter von Epp. Sein Freikorps war schon 1920 an der blutigen Niederschlagung der Münchner Räterepublik beteiligt. Noch am 9. Mai kamen Adolf Wagner, der Gauleiter von München, Ernst Röhm, Heinrich Himmler und Ritter von Epp den bayrischen Ministerpräsidenten Heinrich Held auf und erklärten ihn für abgesetzt. Am 10. März wurde Ritter von Epp zum Reichskommissar ernannt. Am 15. März legte Held sein Amt nieder und zog sich nach Regensburg ins Privatleben zurück.
Der legislative Teil der “Gleichschaltung der Länder” war mit den beiden Gesetzen vom 31. März und 7. April 1933 abgeschlossen. Nachdem die Länder praktisch ausgeschaltet waren begann die Nazifizierung. In Städten und Dörfern wurden Nationalsozialisten eingesetzt. Kaiserslautern setzte Bürckel persönlich den ständigen Stellvertreter des Vorstandes der Polizeidirektion Kaiserslautern Dr. Johannes Beck (Personalangabe nach Joachim Lilla: Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-)Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945) ab. Vermutlich wurde er kurzzeitig in Schutzhaft genommen. Was hatte Bürckel erzürnt? Dr. Beck hatte bei einer Wahlversammlung am 20. Februar den Gastredner und ehemaligen Reichskanzler Brüning eigenhändig in seinem Dienstwagen
zum Versammlungsort in Kaiserslautern gefahren, was Bürckel zu Rachedrohungen veranlasst hatte, die er nun nur ein paar Wochen später in die Tat umsetzen konnte. Am 10. März wurde auch schon das ein so genanntes Schutzhaft- und Arbeitslager in Neustadt in der ehemaligen Turennekaserne eingerichtet. Es war eines der ersten Lager dieser Art in Deutschland. In Neustadt wird am 10. März Dr. Forthuber seines Amtes als Oberbürgermeister enthoben und in Schutzhaft genommen. Er wurde durch RA Rudolf Hamann ersetzt. Dieser war seit 1927 niedergelassener Rechtsanwalt in Kaiserslautern. Am 1. 3. 1932 war er in die NSDAP eingetreten. Er war dann als Gauredner und Schulungsredner tätig. Von 1932-1935 war er SA-Rechtsberater bei der Brigade 151.
Mit Dr. Forthuber hatte sich Bürckel eine regelrechte Prozessfehde geliefert, die im Jahr 1926 anfing und die sich über Jahre erstreckte (s.o. den Streit um Förster, Redakteur des Eisenhammer.)
Am 17. März ordnete er Säuberungen an. Gleichzeitig forderte er alle jüdischen Bürgermeister und Stadträte auf, ihre Ämter niederzulegen.Und als Drohung schob er nach, dass wer sich weigere, in Schutzhaft und ins Arbeitslager Neustadt gebracht würde.
Natürlich gab es auch in der Pfalz Bücherverbrennungen, schon am 26. März in Kaiserslautern, dann am 10. Mai 1933 in Landau, am 13. Mai in Oppau, am 14. Mai in Neustadt.Gaukulturwart war Kurt Kölsch.Er hatte seine Lehrerausbildung an der Lehrerbildungsanstalt in Kaiserslautern gemacht. Er hatte Bürckel kennengelernt, war von diesem 1930 in die NSDAP –Rheinpfalz und in den Nationalsozialistischen Lehrerbund eingeführt worden. Schon im Dezember wurde er von Bürckel zum Leiter der Abteilung Rasse und Kultur ernannt. Dann war er Gaukulturwart der Westmark.
Am 21. März wurde das Parlament feierlich eröffnet. Der Tag ist als “Tag von Potsdam” in die Geschichte eingegangen. Die Abgeordneten mit Ausnahme der SPD und KPD nahmen an einem Festakt teil an dem auch der Reichspräsident anwesend war.
Hitler – in Cut und Zylinder !- verneigte sich vor von Hindenburg und gab ihm die Hand. “Der Gefreite und der Feldmarschall”. Goebbels hatte das alles sehr publikumswirksam inszeniert. Selbst das Datum war mit Bedacht gewählt worden.
Am 21. März 1871 hatte sich nämlich der erste deutsche Reichstag konstituiert. Auch der Ort war mit Potsdam sehr bewusst gewählt worden. Potsdam, die Residenzstadt Friedrichs des Großen. Man versuchte also eine Linie zu ziehen von Friedrich
über Bismarck und dann zu Hitler. Am nächsten Tag fand die konstituierende Sitzung des Reichstages in der Krolloper statt, die Ausweichquartier war, weil der Reichstag wegen des Brandes nicht benützt werden konnte.
Am 22. März wurde das erste Konzentrationslager in Dachau in Betrieb genommen. Der nächste Tag aber ebnete den Weg in die Diktatur. Am 23. März wurde nämlich über das “Ermächtigungsgesetz” abgestimmt,
das “Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich”. Hitler wurde ermächtigt, Gesetze zu erlassen ohne Mitwirkung der Legislative. Das galt auch für Verträge mit dem Ausland. Die so beschlossenen Gesetze konnten von der Verfassung
abweichen. Weder ein Reichstagsausschuss noch der Reichsrat konnten Kontrolle ausüben oder nachträglich die Aufhebung beantragen. Das Gesetz sollte 4 Jahre gelten. Die Abgeordneten der KPD waren bereits alle inhaftiert oder wie Innenminister Frick das süffisant kommentierte “durch nützliche Arbeiten in den Konzentrationslagern” am Erscheinen gehindert. Alle 81 Abgeordneten waren entweder inhaftiert, geflohen oder untergetaucht. Auch von den 120 SPD Abgeordneten konnten nur noch 94 an der Abstimmung teilnehmen. Von der SPD waren 26 Abgeordnete entweder in Haft oder geflohen. Während der Abstimmung waren illegal bewaffnete SA und SS Angehörige im Reichstag anwesend. Otto Wels, Reichstagsabgeordneter und SPD-Vorsitzender,
wandte sich in seiner Rede gegen die Annahme des Gesetzes. Es war praktisch die letzte freie Rede im Parlament. Wels stand dann auch im August 1993 prompt auf der ersten Ausbürgerungsliste des Deutschen Reiches und erhielt die deutsche Staatsangehörigkeit
aberkannt. Zentrum und BVP hatten für ihre Partei Fraktionszwang für die Abstimmung durchgesetzt und stimmte, wenn auch nach langen innerparteilichen Debatten dem Gesetz zu. Der Reichstag hatte sich damit selbst entmachtet.
Der Terror hatte schon seit dem 10. März in Bayern und der Pfalz eingesetzt. Bis zum 13. März waren schon 2000 Menschen in “Schutzhaft” genommen worden. Im April waren es 5000. (Zahlen nach Matthias Becker in Geschichte von unten.de)
Die Gewalt um den 10. März war auch Bürckel aus dem Ruder gelaufen, so stark dass sich der Münchner Gauleiter Adolf Wagner und bayrische Innenminister gezwungen sieht, einen Funkbefehl absenden zu lassen, der besagt “Eigentum und Freiheit der Person
gegen ungesetzliche Eingriffe durch Dritte zu schützen (bei Wettstein S. 145). Mit der Errichtung des KZ Dachau wurde Heinrich Himmler, der Reichsführer SS zum politischen Polizeikommissar in Bayern ernannt.Das beendete die willkürlichen Verhaftungen von
Regimegegner und solche, sie man dafür ansah nicht, sondern brachte sie lediglich in geordnete Bahnen. Bürckel ordnete nach Rundfunkansprachen von Hitler an, dass die gesamte SA und SS, soweit sie nicht in die Hilfspolizei eingegliedert sind, ihrer gewohnten Tätigkeit wieder nachzugehen hätten. auch sollten wachen vor Bezirksämtern eingezogen werden, Gewerkschaftshäusern wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zugeführt werden und Zeitungsgebäude geräumt werden.
Damit die geplanten Säuberungsmassnahmen im Sinne de Nazis laufen konnten, hatte Reichskommissar Ritter von Epp angeordnet, dass jedem der bayrischen Regierungspräsidenten ein Sonderkommissar der SA beigeordnet wurde. Die ernannte
SA-Chef Ernst Röhm. Für die Pfalz war das Fritz Schwitzgebel, ein wie oben schon gezeigt ein Bürckel loyal ergebener SA-Führer, der natürlich sein volles Vertrauen besass. Bürckel hatte es immer verstanden, alle wichtigen Schaltstellen mit seinen Gefolgsleuten zu
besetzen, was ihm half, seine Macht innerhalb des Apparates zu sichern. An ihm ging nichts vorbei und er behielt sich immer die letzte Entscheidung vor, obwohl laut Röhm der Sonderkommissar der “Herr in seinem Bezirk sein soll, dem sich alles unterordnen soll”
(nach Wettstein S. 150)
Ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Gleichschaltung war das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, das Wilhelm Frick gedeckt durch das Ermächtigungsgesetz am 7. April 1933 erließ. Das Gesetz legte fest, dass “Beamte nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen aus dem Amt entlassen werden (können), auch wenn die nach dem geltenden Recht hierfür erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen.” §1. § 3 sagte, “Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen. Nur Frontkämpfer aus den Jahren 1914-1918 waren davon ausgenommen. Dieses “Frontkämpferprivileg” hatte der Reichspräsident von Hindenburg von Hitler eingefordert. Zum Erstaunen er Nazis erfüllten diese Bedingung eine erstaunliche hohe Zahl
von Beamten so dass noch gut die Hälfte der rund 5000 jüdischen Beamten im Amt bleiben konnten. Erst die Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 schuf die Voraussetzung alle jüdischen Beamten zu entlassen, da sie den Beamtenstatus von
einer neugeschaffenen Reichsbürgerschaft knüpfte. Es gab nun eine gesetzliche Grundlage und bürgerliche Kreise begrüßten, dass die Judenfrage geregelt war, zumal es eine durchaus herrschende Meinung war, dass ein “übermächtiger Einfluss der jüdischen Fremdkultur” herrsche, und dass es durchaus in Ordnung war, wenn dieser beschnitten wird. Auf Druck der NSDAP wurde der “Arierparagraph” schnell auf nahezu alle Organisationen, berufsständische Vereinigungen und Verbände ausgedehnt.
Ebenfalls am 7. April wurde das Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erlassen, allerdings auch mit der Einschränkung des Frontkämpferprivilegs.
Das Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ vom 25. April 1933 begrenzte die Neuzulassung jüdischer Schüler entsprechend dem jüdischen Bevölkerungsanteil auf 1 1/2 % Im September wurde
die Reichskulturkammer gegründet, das bedeutete dass Juden aus der Presse sowie aus künstlerischen und freien Berufen ausgeschlossen wurden.
Am 29. September 1933 folgte das Erbhofgesetz. Der Besitz eines vererbbaren Hofes war nun an arische Abstammung gebunden. In einem Dreivierteljahr nach der Machtergreifung waren die Juden aus allen beruflichen und gesellschaftlichen Bereichen
per Gesetz verdrängt worden.
Beim Kampf gegen Warenhäuser in “jüdischem Besitz” war man in der Pfalz schneller als bei der Ausgrenzung der Juden per Gesetz aus dem öffentlichen Leben. Der reichsweite “Judenboykott” ab 1. April 1933 begann in Ludwigshafen schon am 13. März.
die 4 (jüdischen) Kaufhäuser Wronker, Rothschild, Brandt und Tietz mussten ihre Erfrischungsräume, also heute die Restaurants schließen. Der Ludwigshafener Oberbürgermeister Fritz Ecarius schildert das in einem Brief so
„Die Schließung der Erfrischungsräume der hiesigen Warenhäuser erfolgte nicht auf amtliche Anordnung. Es bestand die Gefahr, dass die Geschäfte dazu durch die erregten Volksmassen gezwungen worden wären. Die Geschäftsinhaber haben dann auf eigenen Antrieb die Erfrischungsräume geschlossen.“ (zitiert bei Matthias Becker in Geschichte von unten.de) Der Ludwigshafener OB war zwar kein Parteigenosse. Er galt als unpolitischer Technokrat und zeigte sich in der Öffentlichkeit immer als loyal gegenüber dem nationalsozialistischen Staat. er wurde erst 1937 in den Ruhestand versetzt, nachdem er sich mit Gauleiter Bürckel über die Einführung der Gasfernversorgung von Ludwigshafen überworfen hatte. Der Boykott wurde in Ludwigshafen nicht nur begonnen, er dauerte auch am längsten. Die Warenhäuser wurden schon 1934 “arisiert” und schon Ende März 1933 durften Hermann und Max Wronker die Geschäftsräume ihres Unternehmens nicht mehr betreten. Der Gründer der Kette wurde Ende 1942 zusammen mit seiner Frau in
Auschwitz ermordet, nachdem sie vom französischen Internierungslager in Gurs nach Auschwitz deportiert worden waren.
Natürlich gab es auch Reibereien mit der katholischen Kirche. Anders als sein Württemberger Kollege Gauleiter Murr (siehe diesen Blog) ging Bürckel den pfälzischen Klerus nicht so direkt an. Murr ließ den Rottenburger Bischof Johannes Baptista Sproll
und mehrere Pfarrer des Landes verweisen. Bürckel bestritt im Jahr 1933 das katholische Priester verhaftet worden seien. Auch Misshandlungen hätten nicht stattgefunden. “Wir greifen keine Religion und keine Priester an , sondern nur Parteimenschen in Uniform”
(zitiert bei Wettstein S. 167) In der Nacht vom 26 auf 27. Juli 1933 war in Rheingönnheim der katholische Priester Wilhelm Caroli überfallen und schwer verletzt worden. Caroli war von 1928-1933 Schriftleiter des „Katholischen Kirchenblattes“ in Ludwigshafen
und hatte schon seit 1930 sehr kritisch zum Nationalsozialismus Stellung bezogen. Er verstarb übrigens 1942 nach einer halbjährigen Lagerhaft im KZ Dachau. Geradezu zynisch hört es sich an, wenn nach dem Überfall die Gauleitung zur Ergreifung der
Täter eine Belohnung von 500 Reichsmark aussetzte. Als Täter wurden übrigens 3 SA-Männer ermittelt. Diese wurden dann parteiintern gemaßregelt. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen wurden aber nach der Verordnung vom 7. August 1933 eingestellt,
weil es sich um ein Vergehen zur Durchsetzung des NS-Staates aus politischer Überzeugung gehandelt habe. (zitiert bei Wettstein S. 167).
Die gespannten Beziehungen der katholischen Kirche hatten sich nach dem Ermächtigungsgesetz etwas entspannt. Zentrum und katholische Kirche waren eng verflochten. Nach dem Ermächtigungsgesetz gab Kardinal Adolf Bertram, der seit 1919 Vorsitzender
der Fuldaer Bischofskonferenz war, seelsorgerliche Anweisungen an die Mitglieder der Bischofskonferenz. Die ablehnende Haltung der kath. Kirche gegenüber der nationalsozialistischen Bewegung sollte nach der Erklärung Hitlers korrigiert werden. So hob die Kirche das Verbot von Katholiken in die NSDAP einzutreten stillschweigend auf. Auch der Ausschluss von den Sakramenten und das Uniformverbot bei Gottesdiensten wurde revidiert.
Im Gemeinsamen Hirtenbrief vom 8. Juni 1933 heißt es unter anderem :”daß kein Gemeinwesen ohne Obrigkeit gedeiht,und nur die willige Einfügung in das Volk und die gehorsame Unterordnung unter die rechtmäßige Volksleitung die Wiedererstarkung der
Volkskraft und Volksgröße gewährleisten.” (zitiert bei Hans Müller: Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Dokumente, S. 163)
Schon vorher hatte Adolf Hitler erklärt, wie seine “ nationale Regierung” die Rolle der Konfessionen sah. In seiner Regierungserklärung vom 23.03 1933 sagte er: “Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen wichtigste Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums. Sie wird die zwischen ihnen und den Ländern abgeschlossenen Verträge respektieren; ihre Rechte sollen nicht angetastet werden. Sie erwartet aber und hofft, daß die Arbeit an der nationalen und sittlichen Erhebung unseres Volkes, die sich die Regierung zur Aufgabe gestellt hat, umgekehrt die gleiche Würdigung erfährt. Sie wird allen anderen Konfessionen in objektiver Gerechtigkeit gegenübertreten. “ Etwas überraschend schloss der Vatikan dann am 22.Juli 1933 das Konkordat
mit der neuen Reichsregierung ab. Die katholische Kirche hoffte damit, die deutschen Bischöfe, ihre Bistümer und die Strukturen und die katholischen Verbände vor dem Zugriff des Regimes bewahren zu können. Der Schutz der Verbände schien dringend erforderlich, zumal der Straßenterror gegen die Verbände zunahm. So musste zum Beispiel der Gesellentag des Kolpingswerkes am 11. Juni 1933 in München nach tätlichen Übergriffen der SA abgebrochen werden.
Die Verhandlungen kamen auf Wunsch der Reichsregierung wieder in Gang. Franz von Papen betont, der in dieser Regierung Vizekanzler war, dass das vor allem seiner Initiative zu verdanken war. Hitler wollte vor allem den Klerus von parteipolitischer
Tätigkeit fernhalten. Am 22.6.1933 hatte Innenminister Frick die SPD mit der Begründung, sie sei “volks-und-staatsfeindlich”, aufgelöst. Am 4. Juli gaben die BVP und am 7. Juli das Zentrum auf Druck ihre Selbstauflösung bekannt. Nun musste der Heilige Stuhl
keine Rücksicht mehr auf den politischen Katholizismus nehmen.Am 8. Juli erfolgte die Paraphierung durch Regierungsvertreter und Vertreter der katholischen Kirche.

Das Konkordat umfasste 34 Artikel. Es regelte die wechselseitigen Rechte und Pflichten des Deutschen Reiches und der katholischen Kirche im Reichsgebiet und wird noch heute für die Bundesrepublik Deutschland als gültig betrachtet.
“Art. 1 Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion. Es anerkennt das Recht der katholischen Kirche, innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, ihre Angelegenheiten selbständig zu ordnen und zu verwalten und im Rahmen ihrer Zuständigkeit für ihre Mitglieder bindende Gesetze und Anordnungen zu erlassen.
Art. 5 Geistliche erhalten den gleichen Schutz des Staates wie Staatsbeamte
Art. 21 Der katholische Religionsunterricht in den Volksschulen, Berufsschulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten ist ordentliches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt. … “
(zit. nach: Das Zeitalter der Weltkriege und Revolutionen, herausgegeben von Martin Greschat und Hans-Walter Krumwiede (Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen; V), Neukirchen-Vluyn 1999, 75])
Damit waren für die Kirche wichtige Punkte festgeschrieben. Noch am selben Tag hob Adolf Hitler mit einer Verordnung Zwangsmaßnahmen gegen Geistliche und katholische Organisationen auf und bestätigte so die Hoffnungen, die die katholische
Kirche in den Vertrag gelegt hatte.
Nach der Reichstagswahl vom März hatte auf allen Feldern die “Nazifizierung” begonnen. Schnell richtete sich der Terror gegen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Am 13. März waren dem Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
aus über 20 Orten gewaltsame Übergriffe und Besetzungen von Gewerkschaftshäusern gemeldet worden. Im März waren noch Betriebswahlen angesetzt worden. Es zeichnete sich eine Niederlage der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation ab.
sie kam nur auf 11,7 % der Stimmen, die freigewerkschaftlichen Listen erzielten 73,4 %. so wurden die Wahlen einfach ausgesetzt.
Der 1. Mai war erstmals zum gesetzlichen Feiertag mit Lohnfortzahlung worden erklärt worden. Am 2. Mai begann die Zerschlagung der Gewerkschaften. Um zehn Uhr wurden reichsweit alle Häuser des ADGB und des Allgemeinen freien Angestelltenbundes AfA
und ihrer Mitgliedgewerkschaften besetzt. Führende Funktionäre wurden in Schutzhaft genommen. Das Vermögen der Gewerkschaften wurde eingezogen. Die Gewerkschaften waren zerschlagen.
Zurück zu Bürckel. Ludwig Siebert war am 12. April 1933 von Ritter von Epp zum bayrischen Ministerpräsidenten ernannt worden.Beide wollten die bayrischen Gauleiter, vor allem aber Bürckel in die Verwaltungshierarchie einbinden und so eine Einheit zwischen Regierung und Partei herstellen. Ludwig Osthelder hatte erst im September 1932 das Amt des Regierungspräsidenten übernommen. Nach Angriffen aus der NSDAP Bezirkstagsfraktion im Juli 1933 verzichtete er auf eine weitere Geschäftsführung und ließ
am 1. Oktober 1933 in den Einstweiligen Ruhestand versetzen. Siebert bot nach dem Verzicht Ostfelders Bürckel das Amt des Regierungspräsidenten an. Bürckel lehnte dies umgehend ab, hätte es doch für ihn bedeutet sich den beiden Gauleitern
Adolf Wagner, München zugleich bayrischer Innenminister und Hans Schemm, Oberfranken und zugleich bayrischer Kultusminister unterzuordnen und Weisungen entgegen zu nehmen. Das deckte sich nicht mit seinem Machtbewusstsein, gestärkt durch das
Ansehen, das er bei Hitler genoss. Obwohl ihn auch Ritter von Epp inständig bat, ein Regierungsamt in Bayern anzunehmen. Er konnte sich nur eine eigenverantwortliche Staatsführung im Regierungsbezirk Pfalz vorstellen und war nur bereit, sich dem
Führer unterzuordnen. Am 8. Februar 1934 fand in München eine Gauleitertagung statt, bei der alle Gauleiter aufgefordert wurden, ein Ministeramt zu übernehmen.Nach langen Verhandlungen kam am 10. April das Ergebnis zustande, dass alle Gauleiter
als Sonderbeauftragte der Staatsregierung ernannt wurden, ohne Beamtenstatus und ohne jegliche Verwaltungstätigkeit aber mit Sitz und Stimme. Dem stimmte auch Bürckel zu. Am 24. April 1934 wurden die Gauleiter vereidigt, was Bürckel zunächst nicht
wollte-er habe bereits dem Führer den Treueid geleistet- musste aber dann doch nachgeben. Am 1. Mai übernahm Bürckel dann sein Amt als Sonderbeauftragter in Speyer. Auch hier testete er die Grenzen seiner Macht voll aus. Er schlug dem bayrischen Ministerpräsidenten Siebert Richard Imbt, den Kreisleiter und Bürgermeister von Kaiserlautern als kommissarischen Regierungspräsidenten für die Pfalz vor und ernannte ihn kraft seiner Amtsvollmacht auch gleich. Als er Imbt dann auch zu seinem
Stellvertreter als Sonderbeauftragten ernannte, wurde es dem Innenminister Frick zu viel. Er wies Siebert an, Bürckel sofort Imbt von diesem Posten abzuberufen zu lassen. Und Frick forderte Bürckel ultimativ auf, entweder das Amt des Regierungspräsidenten anzunehmen
oder das des Sonderbeauftragten niederzulegen. Bürckel verzichtete. Er hatte aber doch gewonnen. Das Amt des Regierungspräsidenten wurde nicht mehr besetzt. Stellvertretender Leiter der Kreisregierung wurde Oberregierungsrat Wemmer im Innenministerium. Die Zeit der Interimsverwaltung nutzte er, die Kreisbehörde in eine Parteibehörde umzuwandeln und mit ihm ergebenen Mitarbeitern zu besetzen. Er war dort der unangefochtene Chef. Seinen Weisungen wurde bedingungslos Folge geleistet.
Am 14. Oktober folgte ein Paukenschlag Hitlers. Der Deutsche Reichsrundfunk meldete, dass die deutschen Vertreter die in Genf tagende Abrüstungskonferenz verlassen hatten. Delegationsleiter war Rudolf Nadolny.Deutschland war auch aus dem Völkerbund
ausgetreten. Am Tag zuvor hatte Hitler in einer Kabinettssitzung erklärt, das Kabinett aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben und diese mit einem Volksentscheid zu seiner Friedenspolitik zu verbinden.Wahlen ist eigentlich nicht richtig ausgedrückt, denn seit
dem 14. Juli 1933 gab es in Deutschland keine Parteien mehr außer der NSDAP. An diesem Tag wurde nämlich das “Gesetz gegen die Neubildung von Parteien” erlassen.
“§ 1. In Deutschland besteht als einzige politische Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.” war der erste Paragraph. (Quelle: Reichsgesetzblatt 1933 I S. 479)
Ein enormer Wahlfeldzug wurde trotzdem gestartet mit dem üblichen Szenario, Massenaufmärsche, Apelle, Plakatkrieg. Auch Intellektuelle warben für das “Ja”, so der Philosoph Martin Heidegger, der ohnehin nicht durch Distanz zum Nationalsozialismus aufgefallen ist, aber auch Gerhart Hauptmann, Ferdinand Sauerbruch. Auch die deutschen Bischöfe forderten zum Ja auf.Kardinal hatte in einer Wahlstellungnahme gesagt:”Reichskanzler Adolf Hitler hat das deutsche
Volk zu einer Abstimmung am 12. November aufgerufen,um vor der ganzen Welt den Friedenswillen des deutschen Volkes und seine Zustimmung zu den Friedensreden des Reichskanzlers
zu bekunden. Die deutschen Bischöfe, die von jeher in ihren Predigten und Hirtenbriefen für den Völkerfriedeneingetreten sind, begrüßen dieses öffentliche Bekenntnis zum
Frieden. Darum werden die Katholiken aus vaterländischem und christlichem Geist ihre Stimme für den Völkerfrieden, für die Ehre und Gleichberechtigung des deutschen Volkes erheben.
[…] Die Katholiken bekennen damit aufs neue ihre Treue zu Volk und Vaterland und ihren Dank für die weitschauenden und kraftvollen Bemühungen des Führers, dem deutschen
Volk die Schrecken eines Krieges und die Greuel des Bolschewismus
zu ersparen, die öffentliche Ordnung zu sichern und den Arbeitslosen Arbeit zu beschaffen.“ (in Entwurf III Faulhabers, 6.11.1933, in: Volk, Akten Faulhabers 1, S. 800.)
Bürckel forderte auf zur Abstimmung zu gehen und drohte, wer nicht zur Wahl ginge, würde als Separatist betrachtet. Auf den Einsatz einer großen Zahl von Rednern verzichtete er. Er setzte auf “private Gespräche”. Vor Ort
und in den Betrieben sollten die notwendigen Stimmen gesammelt werden. Auch setzte er auf die “Volksgemeinschaft”, diese beschwor er immer wieder. Am 8. November gab er eine Bekanntmachung heraus, die so nur im Gau Pfalz, nicht
aber in anderen Gauen zu finden war. “sämtlichen Bürgermeistern wird nach der Wahl eine Urkunde, unterzeichnet vom Kreiswahlleiter, ausgehändigt, aus welcher ersichtlich ist, wie die Bürger Gemeinde oder Stadt sich am 12. November zu
Deutschland und seinem Führer bekannten und wieviele sich dem Vaterland versagten” Außerdem hatte er ein Belohnungsangebot als Ansporn ausgearbeitet. “Die prozentuale Leistung am 12. November wird zur Grundlage genommen für die künftige
Nummerierung der Kreise, sodass der beste Kreis die Nummer 1 erhält, der zweitbeste die Nummer 2 usw. Die gleiche Nummerierung wird durchgeführt für die Ortsgruppen und Zellen innerhalb der Kreise.” (zitiert bei Wettstein S. 181)
Natürlich spornte das die Parteigenossen zu höchster Leistung an, den keiner wollte nach der Wahl als Versager gebrandmarkt werden. Damit hatte Bürckel auch über die Grenzen der Pfalz Aufsehen erregt.
Das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps unterhielt den ganzen Tag eine Fahrbereitschaft, um Alte, Gebrechliche und Kranke zur Wahl zu bringen. Außerdem wurde auf perfide Art ein Grund gegeben, auf jeden Fall zur Wahl zu gehen.
Es wurde die Anordnung erlassen, dass die Wähler gleich nach der Stimmabgabe ein Wahlabzeichen offen zu tragen hatte. Das wurde ihnen aber erst im Wahllokal zum sofortigen Anstecken ausgehändigt.
Das Ergebnis war dann auch sehr eindeutig. 95,1 % billigten die Außenpolitik mit ihrer Zustimmung und in der gleichzeitigen Reichstagswahl erreichte die allein zur Wahl stehende NSDAP 92,2 %. Bürckel konnte mit dem Ergebnis zufrieden sein.
Der Gau Pfalz hatte wieder die Spitzenposition eingenommen. In der Pfalz hatten 97,0 % bei der Volksabstimmung mit Ja gestimmt und 96,87 % bei der gleichzeitigen Reichstagswahl für die NSDAP. Neinstimmen wurden keine verzeichnet.
Natürlich war das Ergebnis auch für Adolf Hitler wichtig. Zeigte es doch dem In-und dem Ausland, dass Hitler die große Mehrheit des deutschen Volkes hinter sich wusste.
Ein gravierendes Problem stand aber an. Es war die Rolle, die die SA im Reich spielen sollte. 1921 hatte Adolf Hitler die Gründung eines Wehrverbandes der NSDAP angeordnet. Die Sturmabteilung war eine auf Hitler eingeschworene
Kampforganisation der Partei. 1922 hatte er Hermann Göring, der auch 1922 in die NSDAP eingetreten war, mit der Führung der im Aufbau befindlichen SA beauftragt. Sie beteiligte sich am gescheiterten Hitlerputsch.
Nach dem Putsch verbot der Chef der Reichswehr Hans von Seeckt die NSDAP aber auch rechtsextreme Wehrverbände. Als Auffangorganisation gründete Ernst Röhm den Frontbann im Mai 1924. schon im September soll er 30.000 Mitglieder
gehabt haben. Hitler wurde Ende 1924 aus der Haft entlassen. Im Februar 1925 wurde die NSDAP neugegründet. Auch die SA wurde wieder aufgestellt, diesmal in die Partei eingegliedert. Nach der Wiedergründung der Partei
war Hitler mit Röhm über die Rolle der SA in Streit geraten. Hitler vertrat jetzt die “Legalitätstaktik”. Da passte die Zusammenarbeit mit paramilitärischen Verbänden nicht mehr ins Konzept. Hitler brauchte keinen Wehrverband mehr,
sondern lediglich einen Saalschutz. Franz Pfeffer von Salomon übernahm auf Wunsch von Hitler den Posten des Obersten SA-Führers (OSAF). Er war Jurist und war am Ende des 1.Weltkrieg Hauptmann und Bataillonskommandeur. Er entwickelte die bis zum Ende des „Dritten Reichs“ gültige organisatorische und regionale Gliederung der SA und schuf mit vormilitärischer Ausbildung, einheitlichen Uniformen und militärischer Disziplin eine schlagkräftige Parteimiliz. Außerdem unterstanden ihm auch die HJ und der NS-Studentenbund. Provozierende Aufmärsche, zur Schau gestellte Stärke sollte die nationalsozialistische Geschlossenheit zeigen und waren auch ein Instrument der NS-Propaganda. Gewalttätige Übergriffe auf den politischen Gegner, also vor allem Mitglieder
der KPD und SPD zählten zu ihrem Repertoire, aber auch Juden und christliche Gruppen wurden Ziel von Angriffen. Eine weitere Krise zeichnete sich im Vorfeld der Reichstagswahlen von 1930 ab. Aus der SA war die Forderung laut geworden, führenden Mitgliedern einen sicheren Listenplatz bei der Wahl zu garantieren. Hitler lehnte das ab. Auch Pfeffer von Salomon bejahte die Trennung von SA-Führerschaft und Mandat. Die Berliner SA trat daraufhin in Streik. SA Männer besetzen am von 30. auf 31. August 1930 sogar die Gaugeschäftsstelle und die Redaktionsräume der Gauzeitung der Berliner NSDAP “Der Angriff” unter dem stellvertretenden OSAF Ost Walter Stennes. Es kam zu einer wilden Prügelei zwischen SA und SS-Männern, erst die herbeigerufenen Polizei konnte die Ordnung wieder herstellen. Pfeffer von Salomon trat zurück. Hitler eilte nach Berlin und übernahm selbst den Posten des OSAF .Zum Ausgleich wurde Pfeffer von Salomon bei der Septemberwahl 1932 als Reichstagskandidat aufgestellt. Für die tägliche Arbeit wurde der Posten des Stabschef neu eingerichtet. Hitler besetzt ihn mit seinem alten Kampfgefährten Ernst Röhm, der schon beim Putsch am 9. November 1923 dabei war. Röhm war nach Südamerika gegangen, hatte 1928 als Militärinstruktor in Bolivien gearbeitet.
Er war 1930 aus Südamerika zurückgekehrt und trat wieder in die NSDAP ein. Im Januar 1931 trat er den Posten des Staatschef der SA an. Der Konflikt zwischen Stennes und der SA-Führung war aber nicht ausgestanden. Zum einen lehnte er die unter Röhm gerade begonnene Umorganisation der SA ab. Hauptgrund der Ablehnung durch die NSDAP-Spitze war aber die aktionistische Ausrichtung von Stennes und seiner Leute. Mit der Notverordnung vom 28. März 1931 zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen ,
deutete die Regierung an, dass sie in Zukunft energischer gegen politische Gewalt vorgehen wolle. Das gefährdete die Erfolge, die die NSDAP mit der Reichstagswahl von 1930 errungen hatte. Der Umkreis um Stennes warf der “Hitler-Fraktion” vor, sich von den
alten Idealen des Nationalsozialismus abgewandt zu haben. Die SA weigere sich, sich “auf dem Altar der Legalität opfern” zu lassen. (Flugblatt »Pg., S.A.-Kameraden! Nationalsozialisten!«, 8.4.1931, BArch Bln, NS26) Hitler setzt Stennes schließlich ab, worauf es zum
zweiten “Stennes-Putsch” kam. Mehrere hundert SA-Leute besetzten das NSDAP Parteigebäude in der Berliner Hedemannstraße. Stennes wurde dann aus der Partei ausgeschlossen.


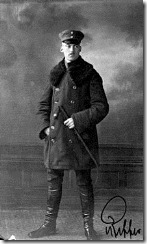
Er und seine Gefolgsleute bemühten sich die Nationalsozialistische Kampfbewegung Deutschlands (NSKD)auf zubauen. Aber schon im Dezember hatten Geldnot und schwindende Mitgliederzahlen für das aus der NSKD gesorgt.Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten kam Stennes im Mai 1933 zunächst in Haft. Aber Göring, der ihn noch aus gemeinsamen Kadettenzeiten in Berlin kannte,unterstützte ihn. Auf Rat Görings wurde Stennes in China als Mitglied einer deutschen Militärmission Berater Tschiang Kai-scheks . Er befehligte dort die Leibgarde des Nationalistenführers und schulte Polizeioffiziere. (zur weiteren Geschichte von Stennes siehe siehe Spiegel online Eines Tages SA-Führer Stennes Von Hitlers Haudrauf zu Stalins Spion).
Unabhängig von diesen inneren Auseinandersetzungen wuchs die SA beständig und rasch an. Weltwirtschaftskrise und Wahlerfolge der NSDAP trugen ihren Teil dazu bei. Der Straßenterror nahm zu und führte 1932 zu und führte 1932 zum SA und Uniformverbot.
(s.o.) Im Vorfeld der Reichstagswahl von 1932 kam es zu 300 Toten und über 1000 Verletzten. Bis Ende 1932 waren 92 SA-Leute bei Saal- und Straßenschlachten ums Leben gekommen. Am 14. Januar 1930 wurde Horst Wessel, ein SA-Führer, angeschossen.
Am 23. Februar starb er im Krankenhaus. Eigentlich war es um eine private Auseinandersetzung gegangen. Es ging um Streit mit Mietzahlungen in einer Wohnung wo Wessel zur Untermiete wohnte. Goebbels, damals Berliner Gauleiter, griff das unter anderen Vorzeichen auf und nutzte den Tod Wessels zur hemmungslosen Agitation. Er stilisierte ihn zum “Märtyrer” der Bewegung. Er nannte ihn einen “Christussozialisten”, einen, der durch Taten rufe: »Kommt her zu mir, ich will Euch erlösen “
Zitiert nach R. G. Reuth, Goebbels S. 162. Goebbels gestaltete ein pompöse Trauerfeier, bei der auch Göring, der SA-Führer von Pfeffer sowie Prinz August Wilhelm von Preußen anwesend waren. Nach der Machtübernahme gab es Horst Wessel Plätze.
Das Krankenhaus, in dem er gestorben war, wurde in “Horst Wessel Krankenhaus” umgetauft. Horst Wessel hatte irgendwann zwischen 1927 und 1929 einen Liedtext gedichtet, der zur offiziellen Parteihymne der NSDAP wurde. Nach der Machtübernahme
wurde es auf Anordnung von Innenminister Frick immer im Anschluss an die erste Strophe der Nationalhymne gesungen.
Nach der Machtübernahme war Göring Minister ohne Geschäftsbereich. Außerdem trat er am 30. Januar in die Kommissariatsregierung von Preussen als Innenminister ein. De jure regierte in Preussen zwar immer noch die Regierung Braun.
Von Papen hatte im Juli 1932 nach dem “Preussenschlag” die Regierung Braun abgesetzt. Doch das war vom Staatsgerichtshof für ungültig erklärt worden. Die Notverordnung „Zur Herstellung geordneter Regierungsverhältnisse in Preußen“ vom 6. Februar 1933
übertrug kurzerhand alle der Regierung Braun noch verbliebenen Befugnisse auf die Kommissariatsregierung von Papens. Es gab keine Neuwahlen. Das war ein zweiter Staatsstreich in Preussen. Per Erlass vom 23. Februar 1933 gründete
Göring die “Hilfspolizei”. Sie war 50.000 Mann stark und setzte sich überwiegend aus SA und SS- Einheiten zusammen. In Preussen galt ein Verteilerschlüssel, nach dem jeder 5. Hilfspolizist noch aus den Reihen des Stahlhelms kommen musste.
Die Gründung einer Hilfspolizei empfahl Göring auch für andere Länder. Das preussische Beispiel machte schnell Schule. Braunschweig richtete ihre HiPo schon am 1. März ein, Bayern stellte am 9./10. März eine HiPo auf, Württemberg am 10. März und Hamburg am 15. März. So wurde der Straßenterror gegen politisch Andersdenkende mit staatlichen Vollmachten durchgeführt. Hitler zog zweifachen nutzen aus der SA in der Zeit unmittelbar nach der Machtübernahme. Seine Gegner konnte er einschüchtern und terrorisieren.
Bei den Konservativen konnte er sich als die Person geben, die als einzige in der Lage war, die SA zu bändigen.Hitlers Macht war im Lauf des Jahres 1933 vor allem dank der SA gesichert. Der Konflikt zwischen SA und Parteiführung, der ja schon von 1930 bis 1932
ausgetragen wurde (s.o.), war ja durch die Machtübernahme nur aufgeschoben, nicht aber gelöst worden. Röhm hatte-wie schon 1925 einmal- eine andere Vorstellung von der Rolle der SA. Ihm schwebte ein “NS-Volksheer” vor. Die Einheiten der Reichswehr sollten
in denen der SA aufgehen und so das NS-Volksheer bilden. Hitler aber brauchte die Reichswehr für seine zukünftigen Kriegspläne. Röhm hatte aber auch innerparteiliche Rivalen, nämlich Göring und Himmler. Es wurde nun der Eindruck erweckt, Röhm wolle zu einem Aufstand anstiften. Gerüchte wurden geschürt, Zitate bewusst gefälscht.
Am 30. Juni 1934 war Röhm zur Kur in Bad Wiessee, begleitet von mehreren SA-Führern. Der SS-Sturmbann Dachau, am 29. November 1934 in SS-Sturmbann Oberbayern umbenannt und Heinrich Himmler zur ausschließlichen Verfügung unterstellt-
verhaftete die SA-Führung am 30. Juni 1934 in Bad Wiessee. Zwischen 150 und 200 Menschen kommen in der “Nacht der langen Messer” ums Leben. Die in Bad Wiessee verhaftete SA-Führung wurde nach München-Stadelheim gebracht und dort erschossen.
Man hatte aber SA-Führer aus allen Teilen nach München zu einer Konferenz beordert. Die meisten kamen mit Nachtschnellzügen in München an, wurden sofort auf dem Bahnhof verhaftet, auch nach Stadelheim gebracht und erschossen. Nur bei Ernst Röhm, immerhin Hitlers Weggefährte zeigte der Führer noch Skrupel. Er sollte einen “ehrenvollen” Abgang erhalten. Er wurde aufgefordert, Selbstmord zu begehen. Als er das nicht tat, wurde er auch erschossen. Goebbels war während dieser Aktionen auch in München und gab auf ein Zeichen Hitlers aus dem Braunen Haus das Stichwort “Kolibri” telefonisch nach Berlin durch. Daraufhin setzte auch dort die Mordaktion ein. Aber nicht nur die SA-Führung wurde liquidiert. Alte Gegner, Kritiker und Mitwisser wurden ebenfalls aus dem Weg geräumt. auch alte Rechnungen wurden beglichen. So starb Ritter von Kahr, der als bayerischer Generalstaatskommissar Hitler bei seinem Putsch 1923 die Unterstützung versagt hatte. Der ehemalige NSDAP-Organisationsleiter Georg Strasser wurde am 30. Juni 1934 in Berlin von der Gestapo verhaftet, in das Gestapo-Hauptquartier in Berlin in der Prinz-Albrecht-Straße gebracht und dort liquidiert.Sein Tod wurde zunächst als Suizid deklariert. Gut möglich, dass sich Himmler und Göring eines potentiellen Konkurrenten entledigte, bevor diesem ein Come-Back gelang. Getötet wurden auch Regimegegner aus der katholischen Kirche wie Erich Klausener, der den Vorsitz der Katholischen Aktion in Berlin innehatte. Er war Beamter im preussischen Innenministerium.
Schon vor der Machtergreifung war er überzeugter Gegner linker wie rechter Kampforganisationen und hatte eben auch die SA mit den Mitteln der preussischen Polizei entschieden bekämpft. Auch der Münchner Journalist und Archivar Fritz Gerlich zählte zu den Opfern. Gerlich war von 1920-1928 Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten, einer Vorgängerzeitung der Süddeutschen Zeitung. Ab 1930 gab er die Zeitschrift “Illustierter Sonntag’” heraus, die ab 1932 als “Der Gerade Weg” erschien. Verleger war
Erich August Fürst von Waldburg zu Zeil und Trauchburg, der am Rande erwähnt mit dieser Zeitung eine Menge Geld verlor. Gerlich schrieb in der Ausgabe vom 31.Juli 1932 “Nationalsozialismus heißt: Lüge, Hass, Brudermord und grenzenlose Not”
(Digitalisat der Bayerischen Landesbibliothek)In derselben Ausgabe wird eine Zuschrift veröffentlicht, die sich wie eine Vorwegnahme des weiteren Schicksals von Gerlich liest “Sie erbärmlicher Schmutzfink.Seien sie überzeugt, daß die Stunde bald schlägt,
wo Deutschland von Ihnen und Ihresgleichen befreit wird. Wir werden an Ihnen und Ihrer schwarzen Sippe ein besonderes Exempel statuieren…” Gerlich wurde am 9. März 1933 von einem SA-Trupp misshandelt, in Schutzhaft genommen und verblieb dort
bis zur Nacht vom 30. Juli, wo er in Dachau erschossen wurde. Von Papen konnte seine Mitarbeiter auch nicht mehr schützen, was seine Machtlosigkeit im Kabinett Hitler illustriert. Edgar Julius Jung wurde wohl in Oranienburg ermordet. Er war
politischer Berater und Redenschreiber von Papens und entwarf die Marburger Rede, die von Papen am 17.Juni 1934 vor Marburger Studenten hielt. Carl Fedor Eduard Herbert von Bose war Oberregierungsrat und Referent von von Papen. Er wurde erschossen, weil ja auch die “Papencique” zerschlagen werden sollte. Auch die Reichswehr hatte tote zu beklagen. So wurde Kurt von Schleicher, der ehemalige Reichskanzler und Ferdinand von Bredow, enger Mitarbeiter und Vertrauter Kurt von Schleichers ermordet.
Hitler hatte allerdings behauptet, von Schleicher und von Bredow hätten Landesverrat betrieben. Das empörte zwar die gesamte Generalität und sie beschwerte sich beim Reichwehrminister von Blomberg. Dieser versprach eine Dokumentation zu den Vorfällen zu liefern. es blieb aber bei dem Versprechen. Der einzige, der Konsequenzen daraus zog, war Generalleutnant Wolfgang Fleck, der seinen Abschied einreichte. Die angespannte Stimmung im Offizierskorps blieb aber und sie veranlasste Hitler zu der
Aussage in einer geschlossenen Versammlung, Untersuchungen hätten ergeben, dass die Generäle von Schleicher und von Bredow irrtümlich erschossen worden seien. Hitler hatte der Reichswehr auch zugesichert, dass sie das militärische Monopol behalten solle.
Trotzdem erhielt die SS schon wenige Monate später die Erlaubnis, eigene bewaffnete Verbände aufzustellen. Am 20. Juli 1934 löste Hitler die SS aus der SA und erhob sie zu einer selbstständigen Organisation im Rahmen der NSDAP. 1934 wurden solche Mordaktionen noch juristisch bemäntelt. Am 3. Juli 1934 erließ die Regierung das Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr. Im einzigen Artikel darin heißt es: “ Die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen sind als Staatsnotwehr rechtens.”
Und was war mit Bürckel während des Röhmputsches? Am Tag der Verhaftung Röhms hatte Bürckel die pfälzischen Bauern zu einer Versammlung auf dem “Thingplatz” am Königstuhl auf dem Donnersberg eingeladen.Bei dieser Veranstaltung griff er den landwirtschaftlichen Gaufachberater der NSDAP Ludwig Schickert scharf an. Die beiden hatten wohl schon seit 1932 Probleme miteinander.
Auch Walther Darré war anwesend. Er war am 28. Mai 1934 zum Reichsbauernführer und am 29. Juni, also am Vortag zum Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ernannt worden. Dessen agrarpolitische Vorstellungen empfand er als unsozial. Die Politik
Darrés missachtete nach Bürckels Einschätzung die dringenden Belange der Bauern. Bürckel nahm kein Blatt vor den Mund. In einer im Protokoll nicht vorgesehenen Schlussrede wandte er sich direkt an den neuernannten Minister und bat ihn jede unsoziale, die dringenden Bedürfnisse der pfälzischen Bauern missachtende Politik zu unterlassen. Darré war über dieses unprogrammäßige Schlusswort erzürnt und ließ ihm, nachdem er nach Berlin zurückgekehrt war, ausrichten, sein Schlusswort auf dem Donnersberg
habe ihm so gut gefallen, dass er nicht umhin könnte “Gauleiter Bürckel mitzuteilen, dass gerade Georg Strasser erschossen worden ist.” (Wettstein S. 211). Bürckel hatte aus der Säuberung für sich den Schluss gezogen, dass sie sich gegen den Machtanspruch einer
der Sittenlosigkeit und Korruption verfallenen SA-Führung gerichtet hat. In diesem Sinn fiel auch sein Telegramm aus, das er am nächsten Tag an Hitler schickte. “Die Haltung des Gaus Pfalz ist ganz selbstverständlich. Für die durchgeführte Säuberung dankt das ganze pfälzische Volk, aber auch aufrichtig die SA des Gaues Pfalz.Ihr getreuer Bürckel”. Flankiert wurde das in einem Aufruf, der in allen pfälzischen Tageszeitungen veröffentlicht wurde. “Der Führer hat aufgeräumt und uns damit erlöst…” (Wettstein S. 212).
Hindenburg hatte das Vorgehen gegen die SA durchaus forciert. Als Hitler den kranken Präsidenten auf seinem Gut Neudeck besuchte, forderte Hindenburg Hitler auf, endlich “endlich etwas gegen die revolutionären Unruhestifter zu unternehmen” und er überlegte wohl, das Kriegsrecht zu verhängen. Am 2. August 1934 starb der Reichspräsident Paul von Hindenburg. Der verstorbene Präsident sollte eigentlich auf seinen ausdrücklichen Wunsch auf Gut Neudeck bestattet werden. Doch die Nazis ließen sich nicht nehmen, daraus eine perfekte Inszenierung nationalsozialistischer Machtausübung zu machen. Der Leichnam war am 7. August zum Tannenberg überführt worden. Am Tag darauf wurde er in einem pompösen Staatsakt beigesetzt von Hitler mit
“Toter Feldherr, geh‘ nun ein in Walhall!“ Schon am am 1. August Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs erlassen.
Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:
§ 1
Das Amt des Reichspräsidenten wird mit dem des Reichskanzlers vereinigt. Infolgedessen gehen die bisherigen Befugnisse des Reichspräsidenten auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler über. Er bestimmt seinen Stellvertreter.
§ 2
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung von dem Zeitpunkt des Ablebens des Reichspräsidenten von Hindenburg in Kraft.
Noch am Todestag von Hindenburg lässt Reichswehrminister General von Blomberg alle Soldaten einen Eid auf Hitler ableisten. Der Eid lautete nun “Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, daß ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.“ Dabei hatte der Reichswehrminister gar keine rechtliche Befugnis den Text des Eides zu ändern.
Er lautete bis dahin so: “Ich schwöre der Reichsverfassung und gelobe, daß ich als tapferer Soldat das Deutsche Reich und seine gesetzmäßigen Einrichtungen jederzeit schützen, dem Reichspräsidenten und meinen Vorgesetzten Gehorsam leisten will.“
Von Blomberg erhoffte sich von dieser Änderung der Reichswehr eine starke Position zu sichern. De facto stärkte er aber die Position Hitlers. Auch hatte dies Spätfolgen, die damals natürlich nicht abzusehen waren. Als es um den Widerstand gegen Hitler,
fühlten sich viele Offiziere auch durch den Eid auf Hitler gebunden und das machte den Widerstand für einzelne durchaus auch zu einer Gewissensentscheidung. Die deutsche Bevölkerung sollte die Zusammenlegung der Ämter des Reichspräsidenten und Reichskanzlers in einer Volksabstimmung absegnen, die für den 19. August 1934 angesetzt war. Bürckel war seit 7. August 1934 offizieller Sonderbevollmächtigter der Reichsregierung für die Saarabstimmung im Januar 1935. Schon am 18. Juli hatte Joseph Goebbels
den Pfälzer Gauleiter mit der Durchführung der Saarpropaganda beauftragt. Zwar ging es bei der Volksbefragung am 19. August eigentlich um nichts. Sie diente lediglich der Akklamation. Bürckel aber musste sich beweisen. In allen Wahlen hatte er ja immer
Spitzenergebnisse eingefahren. Und auch jetzt brachte er sein erprobtes Erfolgsrezept. Aufmärsche, Fahnen, Marschmusik und aus den Lautsprechern tönten reden Hitlers oder sonstiger Parteigrößen. Am 14. August fand in Speyer eine Massenkundgebung mit
mehr als 10.000 Teilnehmern statt. Seine Rede ließ er gleichzeitig über Lautsprecher in sämtliche Gemeinden des Kreises übertragen. Er schloss pathetisch “Ich sage, dass ich am Abend des 19. Augusts vor den Führer treten werde mit der Meldung: Mein Führer,
die Kompanie Pfalz steht geschlossen hinter dir! “ (Wettstein S. 214) Seine Prophezeiung traf ein. Die Pfalz meldete 99,9 %. (Zahl nach Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen).
Das Saargebiet kam nach der Niederlage von 1918 unter die Regierung des Völkerbundes. 1920 wurde es für 15 Jahre unter französische Verwaltung gestellt. Für 1935 war vertragsgemäß eine Volksabstimmung vorgesehen, die den künftigen Status des Gebiets festlegen sollte Im Jahr 1931 hatte Bürckel eine Art Patenschaft für die saarländische NSDAP übernommen. Er ordnete Parteiredner für die Partei, aber auch Saalschutz durch SA und SS-Leute aus der Pfalz ab. Er versorgte sie mit Uniformen. Er gab saarländischen Parteigenossen die Möglichkeit, in der Pfalz zu hospitieren. Er kannte die saarländische NSDAP also genau. So war es nur folgerichtig, dass Hitler Bürckel nach der Machtergreifung zum Gauleiter des Gaus Saar ernannte,
ohne aber den amtierenden Gauleiter Karl Brück seines Amtes zu entheben. Er löste den Gau Saar auf und unterstellte die NSDAP seiner Gauleitung mit der Zentrale in Neustadt. Die Regierungskommission, das war die Behörde, die das Saargebiet im
Auftrag des Völkerbundes verwaltete, verabschiedete kurz darauf ein Gesetz, das die Parteien an der Saar zur rechtlichen Eigenständigkeit gegenüber dem Deutschen Reich verpflichtete. Somit konnte Bürckel nicht Gauleiter für die Saar bleiben. Als Strohmann
für Bürckel wurde Alois Spaniol, 1904 im saarländischen Lisdorf geboren, eingesetzt. Die bürgerlich-liberalen Parteien und das katholische Zentrum schlossen sich unter auf eine Initiative des VölkIinger Industriellen Herrmann Röchling zur ,,Deutschen Front (DF)“ zusammen. Sie trat für den Anschluss des Saargebiets an das Reich ein. Bürgerliche Politiker und Pfarrer dienten als Aushängeschilder. Nach außen wirkte sie wie eine überparteiliche Bewegung. Tatsächlich aber stand sie vollständig unter der Kontrolle
der NSDAP und die Fäden hielt Bürckel in der Hand. Der DF gehörte als Nationalsozialist Jakob Pirro an. Die Saar-NSDAP wurde am 26. Februar 1934 aufgelöst Neuer Leiter wurde Pirro. Er gilt als Vertrauter Bürckels, der also seine Strategie bei der Personalauswahl, alle Posten mit seinen Vertrauten zu besetzen fortführte.
Bürckel hatte mit der Saarpropaganda zwei Aspekte abzudecken. Zum einen musste er natürlich die Saarländer für die Rückgliederung begeistern. Er musste aber auch die Reichsbevölkerung für die innen-und außenpolitische Bedeutung sensibilisieren.
Für den Kampf um saarländische Stimmen griff er auf seine bewährten Propagandainstrumente zurück. Presse und Film und natürlich wie immer öffentliche Kundgebungen und Versammlungen wurden genutzt. Wichtigstes Propagandamittel wurde aber mehr und mehr der Reichsrundfunk. Für die Reichsdeutschen kreierte er Saarveranstaltungen und Saarausstellungen. In Zweibrücken fand am ersten Aprilwochenende die wohl erste offizielle Saarlandkundgebung statt. Über 70.000 Menschen waren gekommen.
Auch in Mannheim, Mainz und Ludwigshafen fanden große Kundgebungen statt. Sternfahrten zur saarländischen Grenze von Parteiorganisationen wurden organisiert. Aber auch der Sängerbund Westmark oder die NS-Frauenschaft waren eingebunden.
Der Sängerbund hielt in Zweibrücken eine Kundgebung ab und das Gautreffen der NS-Frauenschaft, auch in der Grenzstadt Zweibrücken hatte 10.000 Teilnehmer/Innen.
Bürckel sah aber auch, dass es außer diesem propagandistischen Trommelfeuer wichtig war, auch die katholische Kirche zu gewinnen. Immerhin waren 73 % der saarländischen Bevölkerung Katholiken. Wichtig war ihm eine offizielle Zustimmung der beiden für das Saarland zuständigen Oberhirten Franz Rudolf Bornewasser in Trier und Ludwig Sebastian in Speyer.


Zwar waren beide Bischöfe national eingestellt und waren deshalb für die Rückgliederung des Saargebiets ins Reich, doch ganz so glatt lief es nicht, wie Bürckel sich das erhofft hatte. Sebastian hatte sich schon 1933 geweigert, einen von Bürckel vorbereiteten Wahlaufruf zu unterschreiben. Er hatte im März 1933 demonstrativ katholische Schutzhäftlinge in Neustadt besucht. Angesichts der ständig zunehmenden Repressalien gegen den Klerus und Ordensleute hatte er sich auch geweigert nach dem Abschluss des Reichskonkordats einen Dankgottesdienst zu feiern. Auch waren die Ausschreitungen in der Pfalz während der Gleichschaltung, die Schutzhaft für pfälzische Geistliche
und die Verfolgung von Mitgliedern des Zentrums und der BVP im Saarland durchaus registriert worden. Bürckel fuhr nun einen geschmeidigeren Kurs. So wies er die pfälzische Kreisregierung im Juni 1934 an, kein Uniformverbot für die katholischen Jugendverbände zu erlassen. Er verbot die Verbreitung des “Mythus des 20. Jahrhunderts” von Rosenberg, der bei der katholischen Kirche seit Anfang 1934 auf dem Index stand. Am 21. Juni 1934 ordnete er für Fronleichnam für die Pfalz eine allgemeine Arbeitsruhe an.
Fronleichnam war seit dem Feiertagsgesetz vom 27. Februar 1934 kein Feiertag mehr. Außerdem ordnete im “Interesse des Religionsfriedens” behördlichen Schutz für Fronleichnamsprozessionen an. Auch untersagte er , dass in der Pfälzer und saarländischen
Presse antireligiöse und die Kirche verunglimpfenden Artikel veröffentlicht wurden. Gleichzeitig machte er Druck. Er intervenierte sogar beim Vatikan, um die beiden Kirchenfürsten zu veranlassen, ihre bisherige Neutralität aufzugeben.
Am 6. Januar 1935 wurde im Reich und auf Anordnung der fürs Saargebiet zuständigen Bischöfe von Trier und Speyer ein Hirtenbrief verlesen “Am Sonntag, den 13. Januar 1935, wird im Saargebiet die Volksabstimmung stattfinden über die Frage,
ob dieses deutsche Land seine Bewohner in der durch den Versailler Gewaltfrieden aufgezwungenen Trennung vom deutschen Reich verbleiben sollen (zitiert bei Wettstein S. 264)Bei Bischof Sebastian unterblieb die Formulierung vom “Versailler Gewaltfrieden”.
Aber natürlich hat dieser Hirtenbrief das Abstimmungsergebnis beeinflusst. Das Ergebnis war überzeugend. 90,8 % der Wähler entschied sich für das Rückkehr ins Reich. Für den Status quo stimmten 8,8 % und nur 0,4 % votierten für Frankreich.
Bürckel hatte seine Fähigkeit wieder voll unter Beweis gestellt. Hitler gratulierte zu dem Erfolg persönlich am Telefon und einem persönlich an ihn gerichteten Telegramm “Aufrichtigen Dank für Ihre vorbildliche Arbeit” (Wettstein S. 267)
Auch Goebbels, der sich oft über Bürckels “sozialistische Alleingänge” ärgerte oder Dr. Frey, den er mit seiner Personal-und Verwaltungspolitik in der Pfalz oft brüskierte, gratulierten.
Am 30. Januar wurde “Gesetz über die vorläufige Verwaltung des Saarlandes” erlassen. § 1 lautete: “An der Spitze der Verwaltung des Saarlandes steht bis zur Eingliederung in einen Reichsgau der Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes mit dem Amtssitz in Saarbrücken. Der Reichskommissar wird vom Führer und Reichskanzler ernannt”. Bürckel wurde am 11. Februar zum Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes ernannt und am 1. März 1935 in Saarbrücken von Dr. Frick in einem Festakt
in das Amt eingesetzt. Fast alle Parteigrößen waren dabei: Hitler, Heß, Goebbels, Himmler, Rosenberg, Darré, Ley. Auch die beiden Bischöfe Bornewasser und Sebastian waren anwesend. In seiner Antrittsrede versprach Bürckel den Bau von 2000 Häusern und
Siedlungen. Zur Rückgliederung des Saarlandes sagte er klar “diese sei keine bayrische,preußische Angelegenheit, sondern allein (eine)deutsche Angelegenheit (Wettstein S.270)Tatsächlich war das Saargebiet das erste von den Nationalsozialisten geschaffene „führerunmittelbare Territorium“, in dem der Reichskommissar neben seiner Position als oberster Präsentant der Reichsaufsicht zugleich die Funktion eines Regierungschefs ausübte.Für seine Kirchenpolitik anerkannte er die Aufgabe der Kirche. Doch sagte er auch, dass der Nationalsozialismus als Träger des Staates ungehindert seine Aufgaben erfüllen werde. Jeder sollte auf seine Arbeit beschränkt werden.
Wie er das auch in der Pfalz gemacht hatte, besetzte er die führenden Posten mit ihm loyal ergebenen Parteigenossen. Durch Führererlass vom 17. Juni 1936 wurde Bürckel zum Reichskommissar für das Saarland ernannt. Im selben Jahr wurde er
auch Obergruppenführer der SA, das entspricht dem Rang eines Generals.
Noch ein Blick auf das gesamte Reichsgebiet und die weitere Entwicklung des nationalsozialistischen Herrschaftssystem.
873.668
Auf dem Gebiet der Innenpolitik geschah auch Wichtiges
Mit dem “Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums” vom 7. April 1933 hatte die Ausgrenzung der Juden begonnen.
Die “Nürnberger Gesetze”, die am Abend des 15. September 1935 anlässlich des 7. Reichsparteitag der NSDAP, des “Reichsparteitags der Freiheit”, einstimmig angenommen wurden, schlossen die Juden praktisch aus dem deutschen Volk aus.
Die beiden Gesetze, das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (RGBl. I S. 1146) und das “das Reichsbürgergesetz” (RGBl.I S. 1146) gaben der nationalsozialistischen Rassenideologie ihre juristische Grundlage.
An der Erarbeitung von Vorlagen und Gesetzesentwürfen maßgeblich beteiligt- auch für die “Nürnberger Gesetze” war als Referent im Innenministerium Hans Globke. Er gab auch zusammen mit seinem Vorgesetzten dem Staatssekretär
Wilhelm Stuckart den ersten Kommentar zu den Nürnberger Gesetzen und deren Ausführungsverordnungen heraus. Er verfasste auch das Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 17. August 1938 , das Juden zur Führung
des zusätzlichen Vornamens Israel für Männer und Sara für Frauen verpflichtete. Er konzipierte auch das J, das Juden in ihre Pässe eingeprägt bekamen, mit.
Hans Globke brachte es trotz dieser Vorgeschichte zum Zeugen der Anklage im Nürnberger Prozess. Unter Adenauer wurde er Ministerialdirigent. Am Schluss brachte er es sogar zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Er war die Schaltstelle im Kanzleramt
und Adenauers engster Vertrauter. Auch über Ordensverleihungen konnte er sich nicht beklagen. Er erhielt das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Auch eine Karriere!
Mit dem Blutschutzgesetz wurde die Eheschließung sowie der außereheliche Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden verboten. Das Reichsbürgergesetz legte fest, dass nur “Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes“ Reichsbürger
sein konnten. Das hatte zur Folge,dass kein Jude mehr ein öffentliches Amt innehaben durften. Jüdische Beamte, die 1933 wegen des “Frontkämpferprivilegs” noch einmal davon gekommen waren, mussten nun bis zum 31. Dezember 1935 ihren Dienst quittieren.
Juden verloren das politische Wahlrecht und durch weitere Verordnungen zum Reichsbürgergesetz wurde jüdischen Ärzten und Rechtsanwälten auch ihre Zulassung entzogen.
Zu Gauleiter Bürckel. Gleich nach 1933 waren Juden aus ihren Geschäften gedrängt worden. Der Weinhandel war traditionell überwiegend von jüdischen Händlern betrieben und die waren planmässig aus dem Geschäft gedrängt worden, oft mit fadenscheinigen Vorwürfen von Weinbetrug und Weinpanscherei. Im Mainzer Karnevalszug von 1936 fuhr sogar ein Motivwagen mit, der den Vorwurf, dass Juden minderwertige Weine als Spitzenweine verkaufe. Dazu kam ein Weinjahrgang, dessen Mengen
das 2 1/2 fache eines normalen Jahrgangs ausmachte. Die Winzer fürchteten einen Preisverfall. Also proklamierte Bürckel “Die Deutsche Weinstrasse”. Sie verlief von Schweigen nach Bockenheim und sollte die schönsten Winzerdörfer der Pfalz verbinden.
Man musste lediglich neu ausschildern. Orte die an der Route lagen durften den Zusatz “an der Weinstraße” sowie Neustadt- bisher an der Haardt nun an der Weinstraße. Am 19. Oktober 1935 wurde in Bad Dürkheim die Deutsche Weinstraße feierlich eröffnet.
Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden wurden nur zehn Tage vorher in Kenntnis gesetzt. Ursprünglich war geplant mit einer Pfälzerwald Hochstrasse vom Donnersberg bis zum Hohen Derst, der ist oberhalb von Dörrenbach für den Fremdenverkehr
und damit auch für den Wein zu werben. Bürckel war im Juli 1935mit seinem Gefolge in der Schweigener Gaststätte “Zum Bayerischen Jäger”eingekehrt. Dabei kam man auf die Änderung der Pläne. Am Anfang der Weinstraße steht das Deutsche Weintor,
das die provisorische Holzattrappe, die bei der Eröffnung stand, ersetzt hatte. Es gab einen Architektenwettbewerb, den die Architekten August Josef Peter und Karl Mittel aus Landau gewonnen hatten. Die Grundsteinlegung fand am 27. August 1936 statt, der Abschluss der Bauarbeiten wurde nicht einmal zwei Monate später, am 18. Oktober, gefeiert.
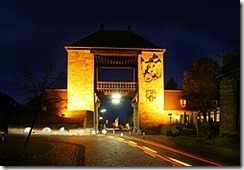
Entlang der Weinstraße sollten 6 Bauwerke entstehen, die zum einen als Kelterstation, zum anderen als Gaststätte mit Ausflugszielcharakter dienen sollten. Gebaut wurde
aber noch 1936 nur der “Saarhof”. Er sollte so heißen, weil die Stadt Saarbrücken die Trägerschaft übernommen hatte. Der Rohbau wurde bei Kriegsbeginn vollendet. dann nahm ihn die Wehrmacht in Beschlag. 1944/45 kaufte die Gemeinde Leinsweiler das Anwesen von der Stadt Saarbrücken. 1951 übernahm es der Landkreis Landau.Heute ist der “Leinsweiler Hof” in Privatbesitz. Parallel zur Errichtung der Weinstraße begründete Bürckel Partnerschaften Pfälzer Winzergemeinschaften mit deutschen Städten. Natürlich überschritt Bürckel damit seinen Kompetenzrahmen, denn Weinbau und Weinwerbung lagen eigentlich im Zuständigkeitsbereich von Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Darré. Aber um Kompetenzen hat Bürckel sich nie gekümmert, zumal wenn er vom Zuständigen keine hohe Meinung hatte. Für die Weinstraße regelte er vieles mit einer Reihe von Erlassen. Aus Vorgärten mussten Reklameschilder, Leuchtstofftransparente, nicht für die Pfalz typische Pflanzen, selbst Gartenzwerge entfernt werden.
Modische Bauweisen, Edelputz und Mosaiken an den Hauswänden waren verboten. Alte Fachwerkhäuser, alte Wirtshausschilder und alte Zäune waren zu erhalten. Bürckel liess die postalische Bezeichnung “an der Weinstrasse” an die Ortsnamen anhängen-
werbewirksam bis heute.
Das Verhältnis des Nationalsozialismus zur Kirche, vor allem zur katholischen, war von Anfang an ziemlich gespannt. Und wie oben gezeigt gab es gleich zu Beginn massive Übergriffe auf Geistliche und vor allem heftige Verfolgung von Zentrumsmitgliedern.
Das Verhältnis entspannte sich nach dem Konkordat ein wenig und unter Gauleiter Bürckel in der Pfalz als es um die Saarabstimmung ging und Bürckel einfach auch die massive Unterstützung der Bischöfe brauchte, um ein möglichst gutes Stimmergebnis im Saarland zu erreichen. Der Speyrer Bischof Sebastian war von Anfang an nicht auf Konfrontation aus.Wie oben gezeigt wurde, verlief die Zeit kurz vor dem Ermächtigungsgesetz sehr turbulent. Auch in der Pfalz waren sehr viele katholische Geistliche in Schutzhaft genommen worden oder wie der Pfarrer von Rheingönnheim Caroli misshandelt worden. Bischof Sebastian willigte in ein Abkommen mit der Gauleitung ein, das katholischen Priestern strengste Zurückhaltung in politischen Fragen auferlegte. Getragen war dies von der
Hoffnung, die Haftentlassung der Pfarrer zu erreichen. Das Hauptziel des Bischofs lag darin, eine geregelte Seelsorge aufrecht zu erhalten. Nach dem für das Regime günstigen Ausgang der Saarabstimmung war man nicht mehr auf Rücksichtnahme auf die Kirche angewiesen. Eine Atempause verschafften nochmals die Olympischen spiel 1936 in Deutschland. Man wollte sich im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit natürlich gut zeigen. Es kam dann Ende 1936/Anfang 1937 zum Frankenholzer Schulstreik. Es ging hier um den Rang von Schulkreuzen und Hitlerbildern. Als der nationalsozialistische Schulleiter Philipp Klein Kreuze durch Hitlerbilder ersetzen ließ, behielten Eltern ihre Kinder daheim. Als die Gestapo gegen die Rädelsführer ermittelte, schlossen sich Bergleute dem Protest mit
einem Bummelstreik an. Darauf wurden 15 Grubenarbeiter fristlos entlassen, 5 Eltern in U-Haft genommen. Gauleiter Bürckel gab nach, ließ die Geldstrafen für die Schulverweigerung aufheben,
veranlasste, dass die Verhafteten entlassen wurden und machte den Platztausch von Hitlerbild und Kreuz rückgängig. Bischof Sebastian hatte den Vorfall in seiner ganzen Diözese publik gemacht und mit klaren Worten darauf hingewiesen,dass Frankenholz kein Einzelfall sei sondern symptomatisch für die Gesamtentwicklung im Deutschen Reich war. Die Stellungnahme des Bischofs belegte, dass Bürckels Fiktion vom Religionsfrieden in seinem Gau nicht stimmte.Fast gleichzeitig ließ Bürckel eine Abstimmung über die Einführung einer Gemeinschaftsschule im Gau Saarpfalz durchführen und erhielt ein klares Votum für die Gemeinschaftsschulen. Das wieder zeigte, dass die Bereitschaft vieler Katholiken, sich den Forderungen des Nationalsozialismus zu widersetzen, sehr rasch an ihre Grenzern stieß, wenn konkrete Nachteile drohten. Die Abstimmung war am 19. März angesetzt worden und schon am 20. März abgehalten worden. So wurde den Pfarrern die Möglichkeit genommen, dagegen Stellung zu beziehen, z. b. in Predigten.
Der 20. März war der Samstag vor Palmsonntag. Am 21. März aber wurde in allen katholischen Kirchen die päpstliche Enzyklika “Mit brennender Sorge” verlesen. Schon im Januar 1937 hatte Papst Pius XI. die Kardinäle Faulhaber (München und Freising), Bertram (Breslau zugleich Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz),und Schulte(Köln) sowie die Bischöfe Galen (Münster) und Preysing (Berlin) nach Rom gerufen, um mit ihnen zu beraten, wie man der immer feindseliger werdenden Kirchenpolitik in Deutschland begegnen sollte. Ein Brief des Papstes an Adolf Hitler oder eine öffentliche Kundgebung des Papstes gegen den Nationalsozialismus in Form einer Enzyklika wurde besprochen. Der Brief wurde verworfen, die Enzyklika beschlossen.
Kardinalstaatssekretär Pacelli bat Kardinal Faulhaber einen ersten Entwurf zu verfassen. Er arbeitete nur nachts und ohne fremde Hilfe, um die geringste Gefahr oder Indiskretion auszuschließen. Gleichzeitig bereite der Vatikan eine gleichzeitig geplante
Enzyklika gegen den Kommunismus („Divini Redemptoris“) so auffällig vor, daß die NS-Diplomaten nur auf dieses Dokument warteten. Beim Korrekturerlesen kam Faulhaber zu der Meinung, dass sich sein Entwurf vielleicht für einen deutschen Hirtenbrief,keinesfalls aber für ein päpstliches Rundschreiben eigne. Papst Pius XI. und sein Staatssekretär entschieden anders. Pacelli brachte noch geringfügige Änderungen an. Das überarbeitete Manuskript wurde in der Druckerei des Vatikans gedruckt und ging
mit einem diplomatischen Sonderboten an die Nuntiatur nach Berlin. Über Kuriere wurde es direkt an die deutschen Bischöfe übergeben. Der Postweg wurde gemieden.Vertrauenswürdiger Kirchenmitarbeiter transportierten das Papier per Fahrrad und Motorrad in die Pfarrhäuser. Man nutzte Wald- und Feldwege, um kein Aufsehen zu erregen. Die Kopien des geheimen Textes wurden in Beichtstühlen übergeben. Zwar gelangte ein Tag vor der geplanten Verlesung ein Exemplar in die Hände der Gestapo. Aber da war die Zeit zu Beschlagnahme natürlich zu knapp. Der Coup war geglückt. In den 11.500 Gemeinden Deutschlands wurde das Rundschreiben verlesen und 300.000 Kopien verteilt. Es ist diese die einzige päpstliche Enzyklika in deutscher Sprache.
Hitler soll getobt haben, als er am Vorabend der Verlesung von der Enzyklika erfuhr. In der Enzyklika steht zwar weder “Adolf Hitler” noch Nationalsozialismus aber es ist eine klare Lagebeschreibung der katholischen Kirche in Deutschland, wie es in der Überschrift heißt. Nach Abschluss des Konkordats hatten sich die Verstöße gegen die Vereinbarung gehäuft. Kardinalsstaatssekretär Eugenio Pacelli hatte dem Botschafter des Deutschen Reiches am Heiligen Stuhl über 50 diplomatische Protestnoten übergeben-
nun erklärte der Papst “daß in diesen schweren und ereignisvollen Jahren der Nachkonkordatszeit jedes Unserer Worte und jede Unserer Handlungen unter dem Gesetz der Vereinbarungstreue standen.” Und fährt dann fort ”wie von der anderen Seite die Vertragsumdeutung, die Vertragsumgehung, die Vertragsaushöhlung, schließlich die mehr oder minder öffentliche Vertragsverletzung zum ungeschriebenen Gesetz des Handelns gemacht wurden.” Auch zum zur Rasselehre wird klar Stellung bezogen:
“Wer die Rasse, oder das Volk, oder den Staat, oder die Staatsform, die Träger der Staatsgewalt oder andere Grundwerte menschlicher Gemeinschaftsgestaltung – die innerhalb der irdischen Ordnung einen wesentlichen und ehrengebietenden Platz behaupten – aus dieser ihrer irdischen Wertskala herauslöst, sie zur höchsten Norm aller, auch der religiösen Werte macht und sie mit Götzenkult vergöttert, der verkehrt und fälscht die gottgeschaffene und gottbefohlene Ordnung der Dinge. Ein solcher ist weit von wahrem Gottesglauben “ Auch zum Führerkult gibt es deutliche Worte: “Wer in sakrilegischer Verkennung der zwischen Gott und Geschöpf, zwischen dem Gottmenschen und den Menschenkindern klaffenden Wesensunterschiede irgend einen Sterblichen, und wäre er der Größte aller Zeiten, neben Christus zu stellen wagt, oder gar über Ihn und gegen Ihn, der muß sich sagen lassen, daß er ein Wahnprophet ist, auf den das Schriftwort erschütternde Anwendung findet: „Der im Himmel wohnt, lachet ihrer“ (Originaltext auf der Internetseite des Vatikans) Natürlich schlug der NS-Staat sofort zurück. Man antwortete mit Hausdurchsuchungen und Verhaftungen.Bistumszeitungen, die den Text gedruckt hatten, wurden beschlagnahmt und für drei Monate verboten. Zwölf der an der Vervielfältigung beteiligte Druckereien wurden entschädigungslos enteignet. Katholische Schulen und Klöster wurden geschlossen. Gegen Priester und Ordensleute wurden Prozesse wegen Unterschlagung und Sittlichkeitsprozesse geführt und publizistisch ausgeschlachtet.
Bürckel griff Bischof Sebastian scharf an. Er bezeichnete ihn als Landesverräter und Staatsfeind. Die Gestapo hatte einen Brief des Bischofs an Pacelli abgefangen, geöffnet und fotografiert in dem er über die Bedrückungen der Kirche berichtet hatte..
Am 15. August 1937 sollte in Speyer das goldene Priesterjubiläum des Bischofs gefeiert werden. 25.000 Frauen wollten zu einer “Jubelmesse” nach Speyer kommen. Sonderzüge waren bei der Reichsbahn angefordert und bereits zugesagt worden.
Nun legte Bürckel eine Großkundgebung von Parteiformationen in Speyer auf den 15. August. Die Reichsbahn zog ihre Zusage für die Sonderzüge zurück. Autobusse, die eigentlich den Frauen zur Verfügung stehen sollten, wurden von der Gauleitung
beansprucht. Bischof Sebastian entschied sich deshalb, seinen Ehrentag im Stift Neuburg gemeinsam mit dem Erzbischof von Bamberg und den Bischöfen von Würzburg und Eichstätt in einer stillen Feier zu begehen. Bürckels
Aktion hatte die die Feier des Bischofs zwar verhindert, war aber doch ins Leere gelaufen.
Auf internationaler Ebene war in der Zeit bedeutsam. Im Februar 1936 hatte die Volksfront in Spanien die Wahlen gewonnen. Daraufhin planten Offiziere nahezu öffentlich einen Putsch. Ihre Aktivitäten wurden von der Regierung praktisch ignoriert.
Als am 13. Juli 1936 der monarchistische Oppositionsführer José Calvo Sotelo ermordet wurde, mischten sich immer mehr Gruppen ein. aus dem Putsch war ein Bürgerkrieg geworden. Zwar gab es unter der Ägide des Völkerbundes ein Nichteinmischungskomitee.
Aber die faschistischen Mächte Italien und Deutschland unterstützten die Putschisten offen.Die Sowjetunion unterstütze die Regierung mit Waffen und Beratern. So wurde Spanien zum Übungsfeld für den Systemkonflikt in Europa. Ab November 1936 kämpfte
die Legion Condor mit 12000 Mann, offiziell nur Freiwillige, in Spanien. Ab Frühjahr 1937 waren auch deutsche Seestreitkräfte beteiligt. Am 26. April 1937 wurde die religiöse Hauptstadt des Baskenlandes Gernika unter massgeblicher Beteiligung der
Legion Condor fast vollständig zerstört.
Im November 1937 hatte Hitler die militärische Führungsspitze und Außenminister von Neurath zu einer Konferenz nach Berlin eingeladen. Dabei ging es zunächst um Versorgungsprobleme der Rüstungswirtschaft insbesondere mit Stahl. Doch Hitler wich von der
Tagesordnung ab und gab in einem mehrstündigen Monolog Einblick in seine außenpolitischen Ziele. Hitlers Wehrmachtsadjutant Oberst Friedrich Hoßbach fasste diese Gedankengänge Hitlers stichwortartig in einer Niederschrift zusammen. Diese wurde später als
“Hoßbachprotokoll” bezeichnet und diente später der Anlagevertretung beim Nürnberger Prozess als Beweismittel, dass die Beschuldigten einen Angriffskrieg geführt hätten. Man kannte schon Hitlers Idee vom “Lebensraum”. Nun gab es aber einen konkreten zeitlichen Rahmen. Da wurde auch klar, dass die Tschechoslowakei und Österreich auf der Agenda standen.
Im Juli 1934 putschten in Österreich Nationalsozialisten. Am 25. Juli ermordete der österreichische Nationalsozialist Otto Planetta den österreichischen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß. Im Anschluss an den missglückten Putsch wurden viele Todesurteile verhängt, von denen 13 auch vollstreckt wurden, unter anderem wurde Otto Planetta durch den Strang hingerichtet. Nachfolger von Dollfuß wurde Kurt Schuschnigg, der bisher Justizminister im Kabinett Dollfuß war.
Für Adolf Hitler bedeutete der Putsch eine enorme außenpolitische Belastung, zumal angenommen wurde, dass Deutschland zu mindestens die Finger im Spiel hatte. Am Grenzübergang Zollerschlag wurde ein Kurier festgenommen, der Dokumente bei sich hatte, das”Kollerschlager Dokument” legt den Verdacht nahe. für die österreichische Regierung war es der Beleg, dass der Juliputsch auf reichsdeutschem Boden geplant und von dort aus geleitet wurde. Hitler ging auf völlige Distanz zu den österreichischen Nationalsozialisten. Die österreichische Landesleitung der NSDAP wurde aufgelöst, der Landesinspekteur Theodor Habicht seiner Ämter enthoben. In Berlin hatte zu der Zeit die Saarabstimmung, dann die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und
die Besetzung des entmilitarisierten Rheinlandes Priorität am 7. März 1936. Weitere personelle Konsequenz war, dass Kurt Heinrich Rieth, der deutsche Botschafter in Wien, in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde.Für ihn wurde von Papen als
Außerordentliche Gesandter nach Wien berufen. Die deutsch-österreichische Vereinigung sollte aus den Schlagzeilen verdrängt werden. Die Beziehungen sollten scheinnormalisiert werden.
Das faschistische Italien hatte sich als Schutzmacht Österreichs gesehen und die wichtigste außenpolitische Stütze Österreichs. Das faschistische Italien war aber bisher die wichtigste außenpolitische Stütze Österreichs. Österreich war für
Italien ein Puffer, der dem Land die gemeinsame Grenze mit Deutschland ersparte.
Das Eingreifen Deutschlands im spanischen Bürgerkrieg hatte auch zu einer Annäherung an Italien geführt, das General Franco ja ebenfalls unterstützte. Am 2. Oktober 1935 begann Italien den Abesinnienkrieg. Der Völkerverbund verhängte Wirtschaftssanktionen.
Berlin unterstütze nun Italien.
Eine Reaktion auf diese Annäherung der beiden faschistischen Mächte war das Abkommen vom 11.Juli 1936 zwischen Österreich und dem Deutschen Reich. Es bestand aus zwei Teilen, dem offiziellen Kommuniqué. Darin anerkannte die deutsche Regierung “die volle Souveränität des Bundesstaates Österreich”.Jede der beiden Regierungen “betrachtet die in dem anderen Land bestehende innenpolitische Gestaltung… als eine innere Angelegenheit des anderen Landes, auf die sie weder mittelbar noch unmittelbar Einfluss nehmen wird.”. Dann wurde noch vereinbart, dass Österreich ihre Politik auf einer Linie halten wird, die der Tatsache entspricht, dass Österreich sich als deutscher Staat bekennt. (Quellensammlung zur österreichischen und deutschen Rechtsgeschichte ,2683)In dem nichtoffiziellen Teil, als Gentlemen Agreement bezeichnet, verpflichtete sich Österreich die seit dem Juliputsch inhaftierten Angehörigen der NSDAP zu amnestieren, einzelne deutsche Zeitungen, den Völkischen Beobachter aber allerdings nicht, wieder zu zu lassen und außerdem “Vertreter der bisherigen sogenannten “nationalen Opposition in Österreich”zur Mitwirkung an der politischen Verantwortung heranzuziehen” (Quellensammlung 2864). Dafür hob Deutschland die “Tausend-Mark-Sperre” auf. Diese wurde am 1.6. 1933 durch die deutsche Reichsregierung als Reaktion auf die Ausweisung des bayrischen Justizministers Hanns Frank erlassen worden. Demnach musste jeder deutsche Staatsbürger, der nach Österreich reisen wollte, vor eine Reise nach Österreich 1000 Reichsmark bezahlen. Der Anteil deutscher Touristen nach Österreich betrug 1932 40 % und dieses Gesetz belastete den österreichischen Fremdenverkehr spürbar.
Edmund Glaisé-Horstenau wurde zum Minister ohne Portefeuille ernannt. Guido Schmidt wurde Staatssekretär des Außenministeriums.
Bei der Tagung im November 1937 war Hitler bei der Skizzierung seiner Außenpolitik auf massive Kritik von Blomberg, Fritsch und Neurath gestoßen. Anfang 1938 tauchten Polizeiakten auf, in denen die Gattin Blombergs als Prostituierte geführt wurde und Fritsch wurde als Homosexueller denunziert. Beide Offiziere wurden daraufhin zum Rücktritt gezwungen. Außenminister von Neurath wurde zum Präsidenten eines nie zusammengetreten Kabinettsrates ernannt und in seinem Amt durch Ribbentrop ersetzt. Das war ein Zeichen, dass Hitler nun gewillt war, die Entwicklung in Österreich nach seinen Vorstellungen voranzutreiben. Auf “Einladung” Hitlers kamen der österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg am 12. Februar 1938 in Begleitung des Staatssekretärs für Äußeres, Guido Schmidt auf den Obersalzberg bei Berchtesgaden. Nach einem zweistündigen Gespräch ohne Zeugen legte ihnen Hitler den Entwurf eines Abkommens vor. Die NSDAP sollte in Österreich wieder zugelassen werden.Arthur Seyss-Inquart sollte Innenminister mit absoluter Polizeigewalt werden. Verhandelt wurde nicht. Es war ein Diktat.Hitler: “ich ändere keinen Beistrich. Sie haben zu unterschreiben, oder alles andere ist zwecklos,…” (AdR, BKA/AA, Staatsurkunden, Deutsches Reich 1938 Februar 12)
Schuschnigg erreichte lediglich eine Gnadenfrist von 3 Tagen, da Ministerernennungen verfassungsrechtlich erst vom Bundespräsidenten gebilligt werden müssten. Er unterschrieb. Aber er setzte eine Volksabstimmung für den 13. März an.
Genau in diesen Tagen war Glaisé-Horstenau auf einer Vortragsreise in Stuttgart. Am 9. März fuhr er zu einem Verwandtenbesuch nach Landau. Dort erfuhr er aus Wien telefonisch von der geplanten Volksbefragung. Bürckel hatte von einem Korrespondenten von
der Anwesenheit von Glaisé-Horstenau erfahren. Bürckel lud ihn zu einem Umtrunk nach schweigen und dann zu einem geselligen Abendessen nach Neustadt ein. Dabei hörten beide eine Rundfunkübertragung von Schuschniggs Rede zu der beabsichtigten Volksbefragung. Bürckel rief umgehend in Berlin an. Dort erreichte er den persönlichen Adjutanten Hitlers in der Reichskanzlei und teilte ihm mit, dass sich Glaisé-Horstenau gerade bei ihm befand. Beide wurden sofort nach Berlin beordert.
Auf Druck Berlins wurde die Volksabstimmung abgesagt. Schuschnigg trat am 11. März zurück. Seyss-Inquart wurde vom Bundespräsidenten Miklas zum Bundeskanzler ernannt. Am 12. März marschierte die Wehrmacht ohne Widerstand des Bundesheeres in Österreich ein. “Der Anschluss” war vollzogen. Seyss-Inquart legte dem Präsidenten das Anschlussgesetz zur Unterzeichnung vor. Miklas legte aber seine Amtsgeschäfte nieder. Seine Funktionen gingen der Verfassung gemäß auf den Kanzler über und dieser unterzeichnete.Hitler legte eine Volksbefragung für den 10. April fest, um den Anschluss im nachhinein legitimieren zu lassen. Bürckel war ja in diesen Tagen in unmittelbarer Nähe Hitlers. Er stand beim Führer ja in hohem Ansehen. Zuverlässig hatte er immer hervorragende Wahlergebnisse geliefert und auch die Saarabstimmung problemlos und mit einem Wunschergebnis abgeschlossen. Er wurde von Hitler zum Beauftragten für die Volksabstimmung und für die Reorganisation der NSDAP ernannt.
In der Wiener Zeitung vom 14. März wurde veröffentlicht, dass Hitler Gauleiter Bürckel damit beauftragt hat und “Ich habe Gauleiter Bürckel mit der Vollmacht ausgestattet, alle Maßnahmen zu ergreifen oder anzuordnen, die zur verantwortungsvollen Erfüllung des erteilten Auftrags erforderlich (online in anno.onbc.ac.at) sind.”Schon gleich nach dem Amtsantritt von Ribbentrop hatte dieser den aus Heidelberg stammenden Wilhelm Keppler als Staatssekretär für besondere Aufgaben ins Auswärtige Amt übernommen. Ab 1936 war er Berater Hermann Görings für die Durchführung des Vierjahresplan. Am 16. März wurde im Reichsinnenministerium die “Zentralstelle für die Durchführung der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich” eingerichtet. Innenminister Frick und Göring wollten, dass Keppler dieser Stelle vorstand.
Sie ernannten deshalb Keppler zum “Reichsbeauftragten für Österreich”. Hitler hatte Bürckel ja schon am 13. März mit seiner Aufgabe persönlich beauftragt. Zwar überschnitten sich die Aufgabengebiete der beiden grundsätzlich nicht. Keppler war
für die wirtschaftlichen und politischen Belange zuständig, Bürckel sollte sich mit der Partei und der Vorbereitung der Volksabstimmung befassen.Da sich beide nicht um Zuständigkeitsbereiche kümmerten und beide ehrgeizig waren, waren Interessenkonflikte vorprogrammiert. Bürckel hatte aber schnell die besseren Karten. Er wurde am 23. April von Hitler zum “Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich” ernannt. Die Dienststelle des
Reichsbeauftragten für Österreich wurde dem Reichskommissar untergeordnet. Von Göring und Frick erhielt Keppler nun wenig Rückhalt, da sie beide Hitler mit offener Unterstützung Kepplers nicht brüskieren wollten.
Bürckel war schon am 13. März nach Wien gereist, um dort den Einzug Hitlers vorzubereiten und gleichzeitig erste organisatorische und personelle Maßnahmen für die Volksabstimmung zu treffen. Rund 200.000 Menschen waren am 15. März auf den Heldenplatz gekommen, um Hitler begeistert zu feiern als dieser “den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich” meldete.
Bürckel ging seine Aufgabe mit Elan und von keinerlei Selbstzweifel geplagt an. Es galt zwar 90,8 % aus der Saarabstimmung zu übertreffen, denn in der Heimat des Führers sollte natürlich noch ein weitaus deutlicheres Ergebnis erzielt werden.
Bürckel sah seine Aufgabe als Vertrauensbeweis des Führers, vor allem aber als Chance, sich Gunst und Dankbarkeit Hitlers zu erhalten. Anders als an der Saar hatte er diesmal keine diplomatischen Rücksichten zu nehmen, da dieses Mal kein misstrauischer
Völkerbundsrat zuschaute. Als Dienstsitz wählt er das Parlamentsgebäude aus und ließ es beschlagnahmen, da mit “Der Beschlagnahme des Hauses kein lebenswichtiger Betrieb gestört wird” (zitiert nach Wettstein, S. 379)Politisch gewieft setzte er gleich zu Anfang durch, dass er zwischen Innenminister Frick und ihm ein Abkommen zustande kam,in dem er ausdrücklich als Hitlers politischer Beauftragter anerkannt wurde. In der Praxis bedeutete dies,dass er in Österreich zum obersten Dienstherr geworden war und bis auf
auf Wehrmacht und Polizei über alle staatlichen Stellen und Parteiorganisationen die Kompetenzhoheit besaß und somit die Geschicke Österreichs und vor allem der Stadt Wien beeinflussen konnte.
Am 10. April nun wurde die Volksabstimmung abgehalten. Im “Altreich” stimmten 99,01 Prozent der Deutschen und in Österreich 99,73 Prozent der Österreicher für den “Anschluss”.
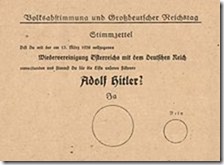
Vor der Abstimmung lief die nationalsozialistische Propaganda auf Hochtouren. Auch waren rund 8 % der eigentlich Wahl-und Stimmberechtigten schon ausgeschlossen worden. Juden (200.000) und “Mischlinge” (170.000) durften nicht abstimmen. Es herrschte
ein Klima der Angst und viele wagten es gar nicht mehr, anonym in der Wahlkabine abzustimmen sondern machten ihr Kreuz öffentlich vor dem Wahlhelfer, um ja nicht in den Verdacht geraten, mit Nein gestimmt zu haben.
Wie schon in der Pfalz und dem Saarland hatte Bürckel auch in Österreich wichtige Schlüsselstellungen mit ihm loyal ergebenen Mitarbeiter aus der Pfalz besetzt. Parteibeauftragter der Stadt Wien wurde Karl Kleemann, Lehrer wie Bürckel und schon 1926
in die NSDAP eingetreten. Ab 1936 war er Kreisleiter der Stadt Ludwigshafen. Claus Selzner, der in Ludwigshafen bei der IG Farben (heute BASF) die NS-Betriebszelle gegründet hatte und dann Leiter der NSBO der Pfalz war, übernahm die Organisation der DAF in Österreich.Rudolf Röhrig, Stellvertreter des OSAF für die Pfalz, Fritz Schwitzgebel und ab 1936 Gauschulungsleiter für den Gau Saarpfalz wurde. Carl Caspary wurde über Bürckel hauptamtlich für die SA tätig. Nach der Vereinigung des Saargebiets war er für die
Neuorganisation der SA im Saarland zuständig. dann war er Brigadeführer der SA-Brigade 151 in Saarbrücken. Nach dem Anschluss holte Bürckel ihn nach Wien. Dort leitete er die neugeschaffene SA-Reichsschule. Natürlich kam das bei den Einheimischen Nazis schlecht an, die sich um die Früchte ihrer Mitgliedschaft in der “Kampfzeit” gebracht sahen. An den Kritiken und Unmutsäußerungen störte er sich nicht. Wie schon im Saarland hatte er auch in Österreich nach dem Anschluss eine Aufnahmesperre. Denn wie in der Pfalz nach der Machtergreifung und an der Saar nach der Vereinigung mit dem Reich hatte auch in Österreich ein Zustrom opportunistischer Mitläufer eingesetzt. Bürckels enger Vertrauter und Berater Karl Barth war von 1938 bis 1940 zu ihm abgeordnet worden.
Er hatte ein Memorandum erarbeitet zu einer Neugliederung Österreichs. Nach den Vorstellungen Bürckels sollte eine reichseinheitliche Lösung angestrebt werden. Partikularistische Interessenwahrung der österreichischen Länder sollte vermeiden werden.
Oberstes Zentrum aller staatlichen und kommunalen Amtsgewalt sollte die Partei sein. Die Länder sollten aufgelöst und in Gaue umgewandelt werden. An der Spitze sollte der Gauleiter stehen, der gleichzeitig Reichsstatthalter war und somit als Reichsorgan
die Befehlsgewalt über jede Landesregierung innehatte. Einheimische Parteifunktionäre sollten ins Reich versetzt werden und somit die immer wieder aufflammenden inneren Streitigkeiten in den NS-Klüngeln ausgeschaltet werden. Bürckel hatte die österreichischen Parteigrößen Kaltenbrunner, Globocnic und Klausner in seine Planungen mit einbezogen um ihre Unterstützung zu bekommen.Bürckel gliederte die “Ostmark”, wie Österreich jetzt genannt wurde, in sieben Gaue.
Salzburg, Oberdonau mit der Hauptstadt Linz, Niederdonau mit der Hauptstadt Krems, Wien, Steiermark mit der Hauptstadt Graz, Kärnten mit der Hauptstadt Klagenfurt und Tirol mit der Hauptstadt Innsbruck. Dabei ging Osttirol im Gau Kärnten auf, Vorarlberg
im Gau Tirol. Das Burgenland wurde zwischen Steiermark und Unterdonau aufgeteilt. Bad Aussee wurde Oberdonau zugeteilt. Großwien wurde in einen eigenen Stadtgau umgewandelt. 97 Gemeinden waren eingemeindet worden und Wien war nun fast fünf mal so groß wie vor dem Anschluss. Am 22. Mai 1938 wurden per Führererlass die Gauleiter ernannt. Wenig Begeisterung fand bei Bürckel die Ernennung Globocnics zum Gauleiter von Wien. Die wichtigsten stellen hatte er ohnehin schon mit ihm ergebenen Leuten aus der Pfalz besetzt. Er wurde nur ein halbes Jahr später aus dem Amt entfernt, wo er ein finanzielles und organisatorisches Chaos hinterlassen hatte. In Wien war er maßgeblich für die Enteignung und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung verantwortlich.
In Kärnten wurde Hubert Klausner Gauleiter. Er starb am 12. Februar 1939 ganz plötzlich in Wien. Sein Tod gab Anlass zu Gerüchten und Spekulationen, bis hin zu von einem von Bürckel veranlassten Giftmord durch die SS, wie sein ehemaliger Adjutant
Erwin Aichinger schrieb (siehe dazu Alfred Elste: Kärntens braune Elite, S. 71f ) In Salzburg wurde Friedrich Rainer Gauleiter, der eng mit Globocnic befreundet war. In Oberdonau wurde August Eigruber Gauleiter und in Niederdonau wurde Hugo Jury Gauleiter, was er bis zu Kriegsende blieb. In der Steiermark wurde der junge promovierte Jurist Siegfried Uiberreither Gauleiter. Den Gau Tirol schließlich leitete Franz Hofer. Er schlug 1944 Hitler vor, ein Kerngebiet in den Alpen als letzte Bastion des Reiches zur
Alpenfestung auszubauen. Sämtliche Gauleiter waren Österreicher und unter ihren Stellvertretern nur ein Reichsdeutscher. Bürckels Vorschlag jedem Gauleiter einen reichsdeutschen Stellvertreter beizuordnen, war Hitler nicht gefolgt. Allerdings gab er dem
telegrafischen Ersuchen Bürckels statt, 26 der besten reichsdeutschen Kreisleiter zu Aufsichtszwecken in den Kreis-und Bezirksverbänden auszuleihen. Die Neugliederung Österreichs war weitgehend nach Bürckels Vorstellungen gelaufen, zumal er sich immer
auf den “Führerwillen” berief und somit jeglicher Kritik den Boden entzog.
Am 28. August 1938 richtete Bürckel in Wien die Zentralstelle für jüdische Auswanderung ein. Formell unterstand sie Franz Walter Stahlecker. Aufgebaut und organisiert wurde sie aber von Adolf Eichmann. In Berlin hatte er seit 1935 beim SD in der Abteilung II (Juden) gearbeitet. Nach dem Anschluss wurde er nach Österreich versetzt.Die Zentralstelle war geschaffen worden, um Auswanderungswilligen die nötigen Papiere auszustellen. Die Dokumente wurden praktisch im Fließbandverfahren erstellt, nicht ohne die Ausreisenden praktisch bis zum völligen Vermögensverlust auszuplündern. Die Behörde arbeitete so effizient, dass sie schnell zum Vorbild für weitere Auswanderungsstellen wurde, so die Reichszentrale in Berlin oder später die Auswanderungsstellen in Prag oder Amsterdam. Heydrich brüstete sich bei einer Konferenz im Reichsluftfahrtministerium kurz nach der Reichskristallnacht, die Zentralstelle in Wien habe in kurzer Zeit immerhin 50 000 Juden aus Österreich herausgebracht, während es im Altreich nur 19 000 Juden waren.
Am 7. November 1938 hatte Herschel Grynszpan in Paris den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath bei einem Attentat getötet. Zu der Zeit war die Führungsspitze der NSDAP in München versammelt, um den 15. Jahrestag des Hitlerputsches zu begehen.
Von München aus erging nun die Weisung zu den seit der Machtübernahme heftigsten antisemitischen Ausschreitungen, die als Reichskristallnacht in die Geschichte eingegangen sind. 91 Tote, 267 zerstörte Gottes- und Gemeindehäuser und 7.500 verwüstete Geschäfte – das war die “offizielle” Bilanz der “berechtigten und verständlichen Empörung des deutschen Volkes“, wie das NS-Regime dazu erklärte. Tatsächlich starben mehr als 1300 Menschen. Über 1400 Synagogen oder Gebetshäuser, das war mehr als die
Hälfte in Deutschland und Österreich wurde stark beschädigt oder ganz zerstört. Am nächsten Tag wurden mehr als 30 000 männliche Juden in Konzentrationslager verschleppt. Das einzige was Göring daran zu kritisieren hatte war, die “volkswirtschaftlich unsinnige Zerstörung von Sachwerten”.
Wie Hitler schon bei der Tagung ausgeführt hatte, die im Hossbachprotokoll beschrieben wurde, stand jetzt die Tschechoslowakei auf seiner Tagesordnung. Schon vor dem Einmarsch in Österreich hatte er in der Reichstagsrede vom 20. Februar 1938 erklärt “
so wird auch das heutige Deutschland seine wenn auch um soviel begrenzteren Interessen zu vertreten und zu wahren wissen. Und zu diesen Interessen des Deutschen Reiches gehört auch der Schutz jener deutschen Volksgenossen, die aus eigenem nicht in der Lage sind, sich an unseren Grenzen das Recht einer allgemeinen menschlichen, politischen und weltanschaulichen Freiheit zu sichern.” Als Hebel in der Tschechoslowakei sollte Konrad Henlein mit seiner Sudetendeutschen Partei SdP (seit 1935, vorher Sudetendeutsche Heimatfront) Am 24. April 1938 stellte Henlein in Karlsbad ein acht-Punkte-Programm vor, ganz im Sinne Hitlers “immer so viel (zu)fordern, dass wir nicht zufrieden gestellt werden können.“

Henlein forderte die volle Gleichberechtigung der deutschen Minderheit als Volksgruppe, die Feststellung und Anerkennung des deutschen Siedlungsgebiets innerhalb der Tschechoslowakei,den Aufbau einer deutschen Selbstverwaltung mit ausschließlich deutschen Beamten, die Wiedergutmachung der ab 1918 erlittenen wirtschaftlichen Schäden der deutschsprachigen Bewohner und endlich die „volle Freiheit des Bekenntnisses zum deutschen Volkstums und zur deutschen Weltanschauung”.
Der tschechische Premierminister Milan Hodza war bereit dieser Forderung mit dem Entwurf einer neuen Verfassung entgegenzukommen. Der tschechische Präsident Edvard Benes lehnte dies aber ab. Am 21. Mai nahm die Tschechoslowakei
eine Teilmobilmachung vor, die von Großbritannien und Frankreich gebilligt wurde.
Hinter den Kulissen gab es wegen der Sudetenkrise, die ja die Gefahr eines zunächst nur europäischen Krieges befürchten ließ, hektische diplomatische Aktivitäten. Auch Bürckel hatte sich da eingeschaltet. Er hatte geheime Kontakte zur böhmischen Hocharistokratie geknüpft, vor allem zu Max Egon von Hohenlohe-Langenburg. Dieser hatte sich schon vor der Sudetenkrise für eine Gleichstellung der deutschen Bevölkerung in der Tschechoslowakei eingesetzt. Er hatte hervorragende kontakte
nach allen Seiten. Er bewegte sich ganz ohne offizielle Funktion in den unterschiedlichsten Kreisen, beim britischen Foreign office, beim tschechischen Präsidenten und Ministerpräsidenten aber auch beim Staatsekretär in Berlin. Auch der Wiener Bürgermeister
Neubacher hatte Kontakte nach England und zwar zu dem böhmischen Grafen Alfred Dubsky, der über enge Verbindungen zu Londoner Regierungskreisen verfügte. Über ihn erfuhr Neubacher von deren diplomatischen Schritten zur Lösung der Sudetenkrise.
Neubacher gab seine Informationen dann an Bürckel weiter. Diese deutsch-böhmische Adelsgruppe stand aber auch mit der konservativen, vor allem militärischen Opposition in Kontakt. So blieben dieser die Kontakte Bürckels natürlich nicht verborgen.
Sie hofften, Bürckel für ihre Pläne zur Vermeidung des Krieges zu gewinnen. Es ist alles nichts Näheres bekannt, ob es Kontaktversuche der Militäropposition zu Bürckel gegeben hat. Bürckel hatte in seinen Reden zur Volksabstimmung immer wieder den ehrlichen Friedenswillen des deutschen Reiches betont. Auch als die Sudetenkrise ihrem Höhepunkt zustrebte, betonte Bürckel die feste Entschlossenheit gegen jeden, der den Frieden stören wolle.
In England war Neville Chamberlain seit 1937 Premierminister. Schon sein Vorgänger Ramsay MacDonald begegnete Hitler mit der “Appeasement”-Politik, also einer Beschwichtigungspolitik. Dieses Konzept ein Nachgeben innerhalb bestimmter, als „vernünftig“ geltender Regeln vor und tat gleichzeitig Hitlers Attacken als bloß rhetorisch ab. Auch Edouard Daladier mehrfacher französischer Ministerpräsident, zuletzt wieder von 1938-1940 folgte den Briten mit dieser Politik. Die Tschechoslowakei musste einsehen,
dass sie keinen Bündnispartner mehr hatte, der bereit war, für sie zu kämpfen. Dafür hatte sie einen Nachbarn, der täglich zielstrebig das Feuer weiter schürte. Außerdem schlug Hermann Göring am 1. August dem ungarischen Botschafter vor, Ungarn solle ebenfalls Gebietsforderungen an die Tschechoslowakei stellen und auch Polen wurde ermuntert, dies zu tun.
Am 12. September sagte Hitler in seiner Abschlussrede zum Reichsparteitag. “wenn diese gequälten Kreaturen kein Recht und keine Hilfe selbst finden können, sie beides von uns bekommen können. Die Rechtlosmachung dieser Menschen muss ein Ende nehmen.”
(bezogen auf die Sudetendeutschen)(Aus Max Domarus (Hg)Hitler.Reden und Proklamationen 1932-1942 2 Bde. Neustadt an der Aisch, Bd I, S. 897-906, bes. S. 901). Diese Rede stieß im Sudetenland auf begeisterte Zustimmung, löste aber auch Unruhen aus,
bei denen es Tote gab. Daraufhin erklärte sich Chamberlain bereit, unverzüglich mit Hitler zusammenzutreffen. Obwohl Hitler Chamberlain mehrfach brüskiert. Schon die Tatsache, den Gast nicht an einem Ort in der Mitte zwischen Berchtesgaden und London zu treffen, sondern ihn zwingt, auf den Berghof zu reisen, war eine Zumutung. Dort empfängt er ihn so, dass er bei der Begrüßung auf der Freitreppe zwei Stufenüber ihm steht, war ein diplomatischer Affront. Als Hitler vorbringt, Benes wende Gewalt gegen
seine Landsleute im Sudetenland an, er lasse sich das nicht länger bieten und werde diese Frage in kürzester Zeit aus eigener Initiative lösen “so oder so”. Auf diese unverhohlene Drohung von Gewaltanwendung, droht der Gast seinerseits mit der Abreise.
Hitler muss nachgeben und wenigstens grundsätzlich in offenen Verhandlungen einwilligen. Damit war Hitlers Eskalationsstrategie zunächst mal gescheitert. Der geplante Angriff auf die Tschechoslowakei sollte als Reaktion auf vermeintliche antideutsche
Maßnahmen der Prager Regierung kaschiert werden. Lord Walter Runciman war schon am 8. August als Sonderbotschafter nach Prag geschickt worden um dort den Stand der sudetisch-tschechischen Differenzen zu ermitteln und gegebenenfalls auch zu vermitteln.
Sein Bericht, den er am 21. September abgab, war für die Tschechen nicht sehr gut “Mein Eindruck ist, dass die tschechische Verwaltung im Sudetengebiet, wenn sie auch in den letzten 20 Jahren nicht aktiv unterdrückend und gewiß nicht “terroristisch” war, dennoch einen solchen Mangel an Takt und Verständnis und so viel kleinliche Intoleranz und Diskriminierung an den Tag legte, dass sich die Unzufriedenheit der deutschen Bevölkerung unvermeidlich zu einem Aufstand fortentwickeln mußte”
Er gibt die Empfehlung ab,die Grenzbezirke mit überwiegend deutscher Bevölkerung unverzüglich von der Tschechoslowakei zu trennen und Deutschland anzugliedern.
Chamberlain hatte Hitler nach dem treffen auf dem Berghof zugesagt, die Frage des Selbstbestimmungsrechts für die Sudetendeutschen sofort mit seinem Kabinett in London zu beraten und dann zu einem zweiten Gespräch nach Deutschland zurückzukommen.
Chamberlain hatte ja kein Mandat der Tschechoslowakei. Er hatte auch noch keine Zustimmung der Tschechen für die Anschlussforderungen Henleins und Hitlers. Hitler sicherte aber zu, die Wehrmacht nicht marschieren zu lassen, so lange die deutsch-britischen Gespräche laufen. Am 19. September forderte die englische und französische Regierung nun auf, Gebiete mit mehr als 50% sudetendeutscher Bevölkerung an das Deutsche Reich zu übergeben. Das lehnte die Tschechoslowakei aber ab. Zwei Stunden später
erklärt Hodza aber, dass die Tschechoslowakei im Falle eines Krieges ohne britische Unterstützung zum nachgeben bereit wäre. Da England und Frankreich klarstellen, den Tschechen beizustehen, falls Deutschland angreift, hat die Tschechoslowakei keine Wahl
und muss nachgeben. Der englisch-französische Plan zur Abtretung der mehrheitlich von Sudetendeutschen bewohnten Gebiete wird akzeptiert, wenn auch “unter Schmerzen”. Der tschechische Staatspräsident Beneš hatte Frankreich noch einen
anderen Vorschlag gemacht, nämlich böhmische Landesteile mit 800-900.000 Sudetendeutschen an Deutschland abzutreten. Im Gegenzug sollten 1,5 bis 2 Millionen Sudetendeutsche aus der Tschechoslowakei nach Deutschland ausgesiedelt werden. Das findet
aber keine Zustimmung. Beneš sucht nun Hilfe von der Sowjetunion. Da aber Polen und Rumänien keine Durchmarscherlaubnis für die Rote Armee in die Tschechoslowakei geben, ist auch von da keine Hilfe zu erwarten.Dass die Tschechoslowakei am 21. September die Abtretung des Sudetenlands akzeptiert hatte, machte den Weg frei für das zweite Treffen von Chamberlain und Hitler, diesmal in Bad Godesberg vom 22.-24.September. Chamberlain erklärt dass der französisch-britische Plan nur unter großen
Mühen und Druck zustande gekommen ist. Aber statt von Hitler Dank zu ernten sieht sich der englische Premierminister neue Forderungen Hitlers gegenüber. Er verlangt die gleichen Regelungen für die ungarische und die polnische Minderheit sowie die sofortige Besetzung der mehrheitlich von Sudetendeutschen bewohnten Zonen durch die Wehrmacht innerhalb von nur vier Tagen. In die Gespräche hinein wurde, die Nachricht bekannt, die Tschechoslowakei habe mobil gemacht. Chamberlain erklärte dies als tschechische Defensivmassnahme. Hitler interpretierte dies als aggressiven Akt der tschechoslowakischen Staatsführung. Auf deutscher Seite stehen nun sieben Divisionen. Hitler beharrt darauf, dass seine Forderungen bis zum1. Oktober erfüllt werden. Andernfalls so droht er, werde er die Sudetengebiete mit Gewalt besetzen. Dann gibt es plötzlich ein Vermittlungsangebot des italienischen Diktators Mussolini, das Hitler überhaupt nicht zu Pass kommt.Hitler lädt die Staats- und Regierungschefs aus Rom, Paris und London nach München ein. Hitler sorgt dafür, dass die Tschechoslowakei, um die es ja geht, von den Verhandlungen ausgeschlossen bleibt. Es kommt zum “Münchner Abkommen “von 1938. Es ist keine Vereinbarung zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei sondern der drei Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Diese vereinbaren die Räumung der Sudetenlande mit der Tschechoslowakei. Sie haben ja auch in Saint-Germain-en-Laye die Auflösung der österreichischen Reichshälfte mi dem dort geschlossenen Staatsvertrag nach dem Ende des 1. Weltkriegs die Tschechoslowakei gegründet. Mit dem Abkommen gaben die damaligen Siegermächte ihre Zustimmung zum Anschluss des gesamten Sudetenlandes an das Deutsche Reich.
Teile der Wehrmacht standen zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft Hitler und seinen Kriegsplänen durch aus kritisch gegenüber. Im Laufe der Sudetenkrise bildete sich ein Widerstandskreis an dem Militärs aus dem Heer aber auch Beamte aus dem auswärtigen Amt beteiligt waren. Einer der wichtigsten Planer war der Abwehroffizier Hans Oster. Er hatte schon 1935 begonnen ein Netzwerk von Opponenten des NS-Regimes in Staat, Verwaltung und Sicherheitsorganen zu knüpfen. Auch sein Chef Wilhelm Canaris war an den Plänen für den Umsturz beteiligt. Ranghöchster Militär war Ludwig Beck, Generalstabschef des Heeres. Er hatte nach dem Hossbachprotokoll die Absicht des Führers kritisiert, die Tschechoslowakei so schnell wie möglich anzugreifen. Im August 1938 bat er um Enthebung von seiner Stellung und übergab am 27. August die Dienstgeschäfte an Franz Halder. Alle drei wurden später im Zuge des Attentates vom 20.Juli 1944 getötet, Beck direkt nach dem Attentat, als die ihm zugestandene Selbsttötung nicht glückte, Oster und Canaris kurz vor Kriegsende in Flossenbürg. Bei der “Septemberverschwörung” wurde geplant, dass Hitler am 28. September 1938 gefangen genommen und vor Gericht gestellt werden. Der Plan wurde dann noch so abgeändert, dass Hitler getötet werden sollte. Am 28. September kam aber die überraschende Nachricht von der Münchner Konferenz. Hitler hatte teilgenommen und der friedlichen Lösung der Sudetenfrage zugestimmt. Nicht nur, dass er alle seine Ziele erreicht hatte. Er stand nun auch noch als Wahrer des Friedens da. Die Verschwörer hatten ihre Waffe Hitlers militärisches Abenteurertum verloren. Die Popularität des Führers hatte einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Verschwörer erholten sich von dieser Wende lange nicht. Nur ein kleiner Kern blieb zusammen. Erst mit Claus Schenk Graf von Stauffenberg gelang es wieder Staatsstreichpläne zu schmieden, die über ein blosses Attentat hinausgingen. Der Gestapo wurden die Umsturzpläne vom September 1938 erst bekannt, als nach dem 20. Juli
Akten in einer Außenstelle des Amtes Abwehr in Zossen gefunden wurden.
Was hatte Hitler erreicht? Er hatte einen großen Gebietsgewinn erzielt. Er hatte der Tschechoslowakei das Befestigungssystem abgenommen, neue Industrien gewonnen und Benes ins Exil gezwungen. aber er hatte mehr gewollt. Das Ziel war Prag.
Zwar hatte er in seiner Rede im Sportpalast am 26. September 1938 zwei Tage vor der Münchner Konferenz vollmundig erklärt, was er Chamberlain gesagt habe: “Ich habe ihm weiter versichert und wiederhole es hier, daß es – wenn dieses Problem gelöst ist ist — (gemeint ist das Problem “Sudetenland”)für Deutschland in Europa kein territoriales Problem mehr gibt! “(online in www.ns-archiv.de/krieg/1938 )
Aber nur drei Wochen später gibt er den Geheimbefehl zur Erledigung der “Resttschechei” Am 1. Oktober besetzen deutsche Truppen das Sudetenland. Vom 2.bis 10. Oktober besetzten polnische Truppen das Olsagebiet. Das ist in etwa das Gebiet des Herzogtums
Teschen im Habsburger Reich. Die Polen leiteten ihren Anspruch aus dem Zusatzabkommen zum Münchner Abkommen ab. “Sobald die Frage der polnischen und ungarischen Minderheiten in der Tschechoslowakei geregelt ist, werden Deutschland und Italien ihrerseits der Tschechoslowakei eine Garantie geben. “ Auch Ungarn machte daraus seine Ansprüche geltend und erhielt durch den Ersten Wiener Schiedsspruch vom 2. November 1938 den die Außenminister des Deutschen Reichs Ribbentrop und Italiens Ciano beschlossen hatten, in der Südslowakei und in der Karpatoukraine, wo eine ungarische Bevölkerungsmehrheit lebte, Gebiete zugesprochen.Berlin arbeitete weiter gezielt an der Destabilisierung der Tschechoslowakei. In der folge der Abtretungen musste die
Regierung den Provinzen Slowakei und Ruthenien eine umfassende Autonomie mit eigenem Parlament und eigener Regierung zugestehen. In der Slowakei war man damit aber nicht zufrieden. Slowakische Extremisten strebten eine Loslösung von der Tschechoslowakei mit totaler Selbstständigkeit an, voll unterstützt von Berlin. In einem Gespräch mit Ďurčanský, 1939-1940 Innen-und Außenminister des Slowakischen Staates sagte Hermann Göring: “Eine Tschechei ohne Slowakei ist uns, noch mehr, restlos
ausgeliefert.”(IMG Internationaler Militärgerichtshof Bd. III S. 171)
Seyss-Inquart schaltete sich ein. Er genoss bei den slowakischen Politikern Sidor, Tiso und Hlinka ein gewisses vertrauen, da er sich bei den Verhandlungen zum Wiener Schiedsspruch erfolgreich für die slowakischen Interessen eingesetzt hatte. Für ihn sprach auch, dass er wie die slowakischen Politiker eine katholische, konservative Herkunft hatte. Für Seyss-Inquart war es die Gelegenheit, verlorenen Boden gutzumachen.Aber auch Bürckel mischte mit.
Am 9. März ließ Hacha, der seit dem Rücktritt von Benes Präsident der Tschechoslowakei war, die Slowakei besetzen. Die Zentralregierung setzte Tiso ab. Neuer slowakischer Regierungschef wurde Sidor. Berlin betrachtete auch nach seiner Absetzung Tiso noch als
legitimen Vertreter. Außerdem lehnte Sidor die Ausrufung der Selbstständigkeit der Slowakei ab. Nun sollte Tiso den Slowakischen Staat ausrufen. Agenten des SD luden Tiso offiziell ein nach Berlin zu kommen. Auch ein Gespräch mit Hitler wurde in Aussicht gestellt. In Begleitung von Ďurčanský und Keppler traf er am 13. März in Berlin ein. Er hatte sich vorher von der neuen slowakischen Regierung die Zustimmung zur Reise nach Berlin geben lassen. Ribbentrop und Hitler verlangen von Tiso eine unverzügliche Entscheidung ob die Slowakei selbstständig werden wolle. Gleichzeitig informieren sie ihn über den ungarischen Truppenaufmarsch an der Slowakei. Doch auch Tiso will die Selbstständigkeit der Slowokei auf legalem Weg erreichen.
Er hatte schon vor seinem Abflug nach Berlin den slowakischen Landtag für den nächsten Tag einberufen. Tiso ist am nächsten Tag in Pressburg zurück. In einer kurzen Rede informiert er den Landtag über sein Gespräch in Berlin. Die Regierung Sidor tritt zurück.
Tiso erklärt “Kraft des Selbstbestimmungsrecht der Völker erkläre ich hiermit die Unabhängigkeit der Slowokei (nach Benoist-Méchin, Histoire de l’armée allemande Bd. 6, S. 65) Alle Abgeordneten erheben sich zum Zeichen der Zustimmung.
Am 18. März wurde zwischen der Slowakei und dem Deutschen Reich ein “Schutzvertrag” abgeschlossen.
Die Erledigung der Resttschechei war nun auch rasch über die Bühne gegangen. Schon am 14. März überschreiten deutsche Soldaten die tschechische Grenze und besetzen Mährisch-Ostrau. Hácha war nach Berlin gebeten worden, wobei es so arrangiert worden war,
als ob der Gesprächswunsch von den Tschechen ausgegangen wäre. Es war nun keine Verhandlung die folgte, sondern ein Diktat. Hitler erklärt dem tschechischen Präsidenten, dass er den Befehl gegeben habe, in die Rest-Tschechoslowakei einzurücken und das es nur zwei Möglichkeiten gebe, entweder die tschechische Armee leiste keinen Widerstand, dann würde er der Tschechoslowakei die größtmögliche Autonomie gewähren, mehr als sie im Habsburger Reich gehabt hätte. Falls die Armee widerstand leiste, werde sie mit allen zur Verfügung stehenden Mittel vernichtet werden.Der aus dem Urlaub herbeigerufene Generalfeldmarschall setzt mit der Drohung nach, Prag bombardieren zu lassen. Hácha gibt nach und unterschreibt am frühen morgen eine Erklärung, dass er” das Schicksal des tschechischen Volkes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches legt” (ADAP, Serie D, Bd.IV, Dokument 229)
Bis zum Abend hat die Wehrmacht die Landesteile Böhmen und Mähren besetzt. Am Abend traf Hitler in Prag ein. aus der Tschechoslowakei war das Protektorat Böhmen und Mähren geworden. Zum Reichsprotektor wird Konstantin Freiherr von Neurath bestellt.
Bürckel wurde Chef der Zivilverwaltung in Mähren mit Sitz in Brünn.
Die Zerschlagung der Tschechoslowakei wird international als Bruch des Münchner Abkommens angesehen. England, Frankreich, Polen, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion erkennen die faktische Annexion nicht an. Die USA verhängten ab dem 17. März
1939 einen Strafzoll in Höhe von 25 % auf alle deutschen Importe. Folgenreichste Entscheidung wie sich bald zeigen sollte, war eine Garantieerklärung, die England und Frankreich dem polnischen Staat am 31. März gaben.
Die Angliederung Böhmens und Mährens ohne Krieg, die Untätigkeit der Regierungen in London, Paris und Moskau sieht Hitler als Schwächezeichen und zieht den falschen Schluss, dass sie nicht in der Lage seien, sich zu einer Abwehr durchzuringen. Bestärkt wird er
in seiner Annahme dass die Botschafter Francois-Poncet und Henderson wiederholt militärisches Eingreifen angedroht hatte. Passiert war aber nichts.
Noch einmal fällt ein weiteres Gebiet ans Reich zurück. 1920 war das Memelland abgetrennt worden. Es wurde als Völkerbundsmandat unter französische Verwaltung gestellt. 1923 drangen litauische Soldaten und Freischärler in das Memelgebiet ein und vertrieben 200 französische Soldaten. Die Ständige Botschafterkonferenz der Siegermächte legt Protest ein. Litauen weigerte sich jedoch, das Memelland herauszugeben. Die Siegerstaaten gaben nach und übertrugen am 16. Februar 1923 die Souveränität über das Memelgebiet an Litauen. Der Völkerbund schloss aber nun mit dem Land Litauen die Memelkonvention .Als Anhang gehörte dazu das Memelstatut. Die litauische Regierung ist durch einem Gouverneur im Memelland vertreten. Ohne dass sie befragt wurden, werden die Memelländer Litauer. Ständige Reibereien sind an der Tagesordnung. Nach dem Österreich und das Sudetenland an das Deutsche Reich angeschlossen worden waren, wollen auch die Memelländer “heim ins Reich”.
Litauen will sich nun seinen Anspruch auf das Memelland von Frankreich und England garantieren lassen, erhält die Garantie aber nicht. Am 31. Oktober 1938 will Litauen die deutsch-litauischen Beziehungen neu zu gestalten und bittet um eine
Erklärung Deutschlands zur Unverletzbarkeit des litauischen Staatsgebiets. Da dies praktisch einen Verzicht auf das Memelland bedeutet, kommt diese Erklärung natürlich nicht. Vor weiteren Gesprächen verlangt Deutschland aber erst einmal die
völlige Einhaltung der Autonomie für das Memelland. Am 1. Dezember erklärt Litauen die Bereitschaft, dem Memelgebiet die volle Autonomie zu geben. Im Außenministerium werden zwei Vertragsentwürfe entworfen. Im Entwurf I steht
die Rückkehr des Memellands zu Deutschland als Gegenleistung einen litauischen Freihafen und Wirtschaftsprivilegien in Memel. Entwurf II sieht nur die volle Autonomie für das Memelland vor. Am 11. Dezember 1938 finden wieder Wahlen statt.
die deutsche Liste erhält 87 % der Stimmen, was man auch als Votum der Bevölkerung für den Anschluss an das reich werten könnte. Am 20. März 19139 reist der litauische Außenminister Urbšys nach Berlin. Dort wird er von Ribbentrop vor die Wahl
gestellt die Streitfrage gütlich zu lösen. Litauen gibt das Memelland zurück, dafür erhält es einen Freihafen. Falls nicht, haben die Militärs das Wort. Am Tag darauf berät das litauische Kabinett darüber. Am 22. März 1939 schließen Litauen und das Deutsche
Reich darüber einen Vertrag ab.
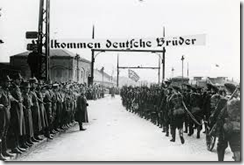
Danach ging es zielstrebig der nächsten militärischen Auseinandersetzung entgegen. Am 11. April gibt Hitler die “Weisung für die einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht für 1939/40”. Darin ist der Fall Weiss, der die Planung für einen Angriff auf Polen enthielt.
Die englisch-französische Garantieerklärung für Polen, sowie die Weigerung Polens Zugeständnisse in der Korridor- Frage zu machen, nahm Hitler zum Anlass, am 28. April sowohl das englisch-deutsche Flottenabkommen als auch den Nichtangriffspakt mit Polen zu kündigen.
Am 23. Mai 1939 berief er die Oberbefehlshaber der Wehrmacht auf dem Oberberghof ein. Dort erklärte er den versammelten Kommandeuren, dass eine Auseinandersetzung mit Polen unvermeidlich sei und auch worum es vor allem gehe.
“Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns um die Erweiterung des Lebensraumes im Osten und Sicherstellung der Ernährung, sowie der Lösung des Baltikum- Problems. Lebensmittelversorgung ist nur von dort möglich, wo geringe Besiedelung herrscht. Neben der Fruchtbarkeit wird die deutsche, gründliche Bewirtschaftung die Überschüsse gewaltig steigern. “ (NS-Archiv, 23.05.1939).
Am 23. August 1939 unterzeichneten Ribbentrop und Molotow in Moskau in Anwesenheit Stalins den Deutsch-Sowjetischen Nichtangriffspakt. Er stand zwar im Widerspruch zu Hitlers bisherigen antibolschewistischen Haltung. Aber er vereitelte
die britisch-französischen Bestrebungen die Sowjetunion in eine Allianz gegen das nationalsozialistische Deutschland einzubinden. Vor allem hielt er ihm den Rücken frei zu einem Überfall auf Polen.
Im Geheimen Zusatzprotokoll wird auch die Aufteilung, Ausbeutung und Unterdrückung Europas durch das nationalsozialistische Deutschland und die stalinistische Sowjetunion aktenkundig gemacht.
“Aus Anlass der Unterzeichnung des Nichtangriffsvertrages zwischen dem Deutschen Reich und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken haben die unterzeichneten Bevollmächtigten der beiden Teile in streng vertraulicher Aussprache die Frage der Abgrenzung der beiderseitigen Interessenssphären in Osteuropa erörtert. Diese Aussprache hat zu folgendem Ergebnis geführt:
- Für den Fall einer territorial-politischen Umgestaltung in den zu den baltischen Staaten (Finnland, Estland, Lettland, Litauen) gehörenden Gebieten bildet die nördliche Grenze Litauens zugleich die Grenze der Interessenssphären Deutschlands und der UdSSR. Hierbei wird das Interesse Litauens am Wilnaer Gebiet beiderseits anerkannt.
- Für den Fall einer territorial-politischen Umgestaltung der zum polnischen Staate gehörenden Gebiete werden die Interessenssphären Deutschlands und der UdSSR ungefähr durch die Linie der Flüsse Narew, Weichsel und San abgegrenzt.
Die Frage, ob die beiderseitigen Interessen die Erhaltung eines unabhängigen polnischen Staates erwünscht erscheinen lassen und wie dieser Staat abzugrenzen wäre, kann endgültig erst im Laufe der weiteren politischen Entwicklung geklärt werden.
In jedem Falle werden beide Regierungen diese Frage im Wege einer freundschaftlichen Verständigung lösen.
- Hinsichtlich des Südostens Europas wird von sowjetischer Seite das Interesse an Bessarabien betont. Von deutscher Seite wird das völlige politische Desinteressement an diesen Gebieten erklärt.
- Dieses Protokoll wird von beiden Seiten streng geheim behandelt werden.
Moskau, den 23. August 1939.” (NS-Archiv, 23.8.1939)
Ab Ende August inszenieren SS-angehörige als polnische Freischärler getarnt immer wieder Grenzzwischenfälle. Die bekannteste war der angebliche Überfall auf den Sender Gleiwitz. Am 1. September erfolgt der Angriff auf Polen.
Im Reichstag hält Hitler die berühmte Rede:”Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen! Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten! Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf, ganz gleich, gegen wen, so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind” Er hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass
England und Frankreich “nur mit dem Säbel rasseln” würden. Umso mehr war er erschüttert, als ihm die beiden Westmächte noch am Abend des 1. September eindeutige Ultimaten überreichen ließen und am 3. September den Krieg erklärten.
Allerdings griffen sie noch nicht aktiv in den Krieg ein. An Kopfstärke gemessen Angreifer waren der polnischen Armee gleich. Rüstungstechnisch und an Beweglichkeit war die Wehrmacht aber weit überlegen. Das taktische Konzept war von dem Zusammenspiel von Luftwaffe und Heer bestimmt. Vom ersten Tag an führte die Wehrmacht den Krieg mit grausamer Härte. Schon am 6. Oktober kapitulierten die letzten Truppenteile. Die Sowjetunion und Deutschland teilten Polen unter sich auf, wie sie es in ihrer Zusatzvereinbarung zum Nichtangriffspakt abgemacht hatten. Die deutsch besetzten Gebiete wurden als Danzig-Westpreussen und Wartheland als Reichsgaue in das Deutsche Reich inkorporiert. Was nicht in der sowjetischen Interessensphäre lag, wurde
“Restpolen” in einem Generalgouvernement okkupiert und ausgebeutet.
Im Westen kam es zunächst zum Sitzkrieg oder französisch drôle de guerre. Frankreich startete am 9. September die Saaroffensive und überschritt im Saarland die Grenze. Die Wehrmacht zog sich hinter den Westwall zurück. Frankreich war nicht auf einen
Offensivkrieg vorbereitet und auf deutscher Seite gab es einen Führerbefehl, der untersagte, die Grenze ohne ausdrückliche Genehmigung Hitlers zu überschreiten. Man wollte auf jeden fall einen Zweifrontenkrieg vermeiden.
Am 9. April 1940 begann das Unternehmen “Weserübung”. Das war die Besetzung Norwegens und Dänemarks zum einen um sich die Häfen Norwegens zu sichern, zum andern um eine Seeblockade zu verhindern. Außerdem sollte die Kontrolle der Ostseezugänge
und vor allem die Eisenerzversorgung aus Schweden gesichert werden. Am 10. April 1940 begann der insgesamt 29 mal verschobene Westfeldzug. Am 10. Januar gelangten die Belgier und damit auch die Engländer und Franzosen in Besitz des Plans für einen wichtigen Teil des deutschen Einfalls in Frankreich und der Niederlande. Ein Kurier sollte die Unterlagen zu einer Stabsbesprechung nach Köln bringen. Dort wurde er aufgehalten. Er erhielt ein Angebot in einer Kuriermaschine der Luftwaffe mitzufliegen.
Er nahm es an trotz strengen Verbotes, Geheimsachen auf dem Luftweg zu befördern. Der Pilot verflog sich bei dichtem Nebel und landete in Belgien. Bevor die Akten vernichtet werden konnten, trafen belgische Gendarmen ein. Daraufhin wurde ein völlig
neuer Angriffsplan ausgearbeitet. Erich von Manstein erarbeitete den “Sichelschnittplan” . Statt wie leicht vorauszuberechnen ähnlich wie im Schlieffenplan im 1. Weltkrieg in einer Umfassungsbewegung durch Belgien nach Frankreich vorzustoßen,
änderte er die Angriffsrichtung. Der Angriffsschwerpunkt sollte nun in den Ardennen liegen. Diese bewaldete Bergland schien Frankreich nicht für einen Panzerangriff geeignet zu sein. Entsprechend schwach waren die dort postierten Einheiten.
Das Überraschungsmoment war voll auf deutscher Seite. Zwar gelang es den Belgiern fast alle Brücken zu sprengen. Obwohl das Marschtempo so erheblich eingeschränkt wurde, erreichten die Spitzen der Panzertruppe General Guderians bereits am 12. Mai die Maas. Am 18. Mai war bereits die Kanalküste erreicht. Am 24. Mai wurde Dünkirchen erreicht. Dort war das britische Expeditionskorps. Es konnte aber entkommen, nicht zuletzt wegen des Haltebefehls, den Rundstedt gegeben hatte. 338.000 Mann konnten übergesetzt werden. In Frankreich hinterließ die Evakuierung aber auch ein Gefühl des Im Stich gelassen seins. Der Krieg in Frankreich war rasch zu Ende. Am 14. Juni marschierte die Wehrmacht in Paris ein. Am 22. Juni wurde in Compiegne der Waffenstillstand geschlossen. Hitler machte daraus seinen persönlichen Triumph. Schon der Ort war mit Bedacht ausgewählt. Dort hatte 22 Jahre zuvor Matthias Erzberger die deutsche Kapitulation unterschreiben müssen. Sogar den Waggon in dem das stattgefunden hatte,
hatte Hitler aus dem Museum holen lassen und auf die Gleise stellen lassen. Die “Vorrede” zum Waffenstillstandsabkommen drückt genau dieses aus.
“Wenn zur Entgegennahme dieser Bedingungen der historisch Wald von Compiègne bestimmt wurde, dann geschah es, um durch diesen Akt einer
wiedergutmachenden Gerechtigkeit — einmal für- immer – eine Erinnerung zu löschen, die für Frankreich kein Ruhmesblatt seiner Geschichte war, vom
deutschen Volke aber als tiefste Schande aller Zeiten, empfunden wurde. (online unter www.zaoerv.de)
Der Sieg über Frankreich wurde vom Nationalsozialismus als dreifacher Triumph empfunden. Einmal war es das Ende eines Ringens über drei Jahrhunderte hinweg. Und Deutschland war schließlich siegreich geblieben. Ludwig XIV. hatte den Kampf
um die Rheinlinie begonnen. Stück um Stück ging in dessen Verlauf für das Deutsche Reich verloren. Dann war es der Sieg “über die abgelegten Ideale” von 1789, über die “Untermenschenrevolution” (Zitat aus Das Schwarze Korps, vom 22.08. 1940)
mit Postulaten der Menschenrechte, der parlamentarischen Regierungsform, der Demokratie, “den sanften Idealen und der brutalen Wirklichkeit” (Eugen Mündler im “Reich” vom 21.7. 1940). Auch über die Urheber und Hüter der Versailler Ordnung wurde triumphiert. Frankreich und England hatten ja den Völkerbund dominiert und dabei die kleinstaatliche Klientel bedient. Im kleinen Kreis wurden nun die Pläne für die Aufteilung Frankreichs erörtert. Burgund stand im Blickpunkt der publizistischen Vordenker.
Gehörte es ihrer Meinung nach zum “germanischen Kreis” wie die Champagne und Elsass-Lothringen. Himmler hatte in Burgund die deutschen Südtiroler ansiedeln wollen. In Elsass-Lothringen wurde eine Politik der Rückgliederung schon in den ersten
Anordnungen der Militärverwaltung im Jahre 1940 erkennbar. Das Vorgehen wurde gleichermaßen bestimmt durch das Verlangen nach Wiedergutmachung der Inbesitznahme von 1681 und 1918 wie auch dem germanischen Blut-und Rassemythos.
Man führte den Begriff des volksdeutschen Elsass-Lothringer ein, um die alteingesessene Bevölkerung von der 1918 zugewanderten französischen Bevölkerung zu unterscheiden. (zu diesem kurzen Abschnitt der Aufsatz “Nationalsozialistische Europaideologie”
von Paul Kluke in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte online www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1955_3_2_kluke.pdf)
Zurück zu Bürckel.
Am 2. 8. 1940 unterzeichnete Hitler einen Geheimerlass. Damit ernannte er die Gauleiter Bürckel Westmark und Wagner Baden als Chefs der Zivilverwaltung CdZ in Lothringen bzw. im Elsass.(Institut für Zeitgeschichte Fb 91 Fotokopie) Wie das schon bei Bürckel in Österreich geschehen war, wurden sie einerseits Hitler unmittelbar unterstellt andererseits waren sie an die fachlichen Weisungen der obersten Reichsbehörden gebunden. Dies zeigte, dass Hitler gewillt war, Elsass-Lothringen dem Deutschen Reich einzuverleiben. In einer Besprechung mit den beiden Gauleitern erläuterte Hitler seine Zielvorstellung, dass Elsass-Lothringen in 10 Jahren völlig deutsche Gebiete würden.
Am 2. August 1940 wurde Bürckel in seinen Funktionen als Gauleiter und Reichsstatthalter durch Baldur von Schirach abgelöst. Dieser war vorher Reichsjugendführer. Nach seiner Ernennung zum Gauleiter von Wien wird er Beauftragter der für die Inspektion der
gesamten HJ. Außerdem wird er ab September mit der Kinderlandverschickung beauftragt. Während des Zweiten Weltkriegs waren rund 5 Millionen Kinder und Jugendliche aus den durch Luftangriffen bedrohten Städten evakuiert worden.
In Wien wurde Bürckel keine Träne nach geweint, weder von den Wienern noch von vielen Parteifunktionären. Wie schon öfters gezeigt stieß er öfters auch mit Ministern zusammen, da er von niemanden einen Kompetenzrahmen respektierte,
wenn es um die Durchsetzung seiner Vorstellungen ging. Er konnte sich das leisten, da er bei Hitler in höchstem Ansehen stand und von dort praktisch immer Rückendeckung erhielt. In Wien kam seine joviale Pfälzer Art nicht an. Hinter vorgehaltener
Hand sprach man vom “Bierleiter Gauckel”, womit auch auf seine Affinität zum Alkohol angespielt wurde. Am 10. August wurde er offiziell verabschiedet. Von Heß bekam er ein persönliches Schreiben von Hitler überreicht. Er erhielt zahllose Geschenke.
Der Dr.Ignaz-Seipel-Ring wurde in Josef-Bürckel-Ring umbenannt. Allerdings erhielt er am 27. April 1945 seinen alten Namen zurück.

Ein weiteres Kapitel bleibt mit dem Namen der beiden Gauleiter verbunden, nämlich die Deportation von rund 6500 badischer und pfälzer Juden nach Gurs. In der Nacht vom 20. auf 21. Oktober 1940 zum Abschluss des Laubhüttenfestes musste sich die
jüdische Bevölkerung reisefertig machen. Sie hatte dazu nur rund 2 Stunden Zeit. Nur 50 Kilo Gepäck und eine Barschaft von 100 Reichsmark durfte mitgenommen werden. In sieben Eisenbahnzügen aus Baden und zwei aus der Pfalz wurden die Deportierten nach
Gurs am Fuß der Pyrenäen deportiert. Organisiert hatte die Züge Adolf Eichmann. Gurs war ursprünglich als Internierungslager für politische Flüchtlinge und Kämpfer im Spanischen Bürgerkrieg eingerichtet worden. Für so viele Menschen war
das Lager ursprünglich natürlich nicht vorgesehen. Entsprechend katastrophal waren die hygienischen Bedingungen. Im Schnitt starben täglich sieben Menschen. Die beiden Gauleiter aber konnten am Abend der Deportation stolz nach Berlin
melden “Mein Gau ist judenfrei”. Ab September 1941 wurde mit den ersten Vergasungen in Auschwitz begonnen. Ab August 1942 wurden die Insassen, die bisher in Gurs überlebt hatten, in die Vernichtunsglager im Osten weiter transportiert und
dort umgebracht.
Vor den letzten Lebensjahren von Bürckel nochmal ein Blick auf das Gesamtgeschehen.
Nachdem Frankreich kapituliert hatte, ging der Krieg trotzdem weiter, weil Großbritannien das sogenannte Friedensangebot vom 19. Juli 1940 nicht annahm. Mit der Weisung 16 vom 16.Juli 1940 hatte Hitler die Vorbereitung zu einer Landungsoperation
gegen England vorzubereiten, die dann unter dem Namen Unternehmen Seelöwe lief. Die Vorbereitung sollte Mitte August abgeschlossen sein. “Die englische Luftwaffe muss moralisch und tatsaechlich so weit niedergekaempft sein, dass sie keine nennenswerte Angriffskraft dem deutschen Uebergang gegenueber mehr zeigt. “ hieß es in der Weisung. Am 2. Juli begann nun Göring die “Luftschlacht um England”. Zunächst erfolgte eine begrenzte Offensive gegen die Schifffahrt im Ärmelkanal. Ziel war auch, die
RAF durch die Vernichtung ihrer Flugzeuge in der Luft zu schlagen.Aber die deutsche Luftwaffe erlitt sehr schnell große Verluste. Zwar konnte die Luftwaffe die Luftwaffe die Infrastruktur der britischen Armee schädigen, aber sie schaffte es weder die Lufthoheit zu erringen, noch dauerhaft das britische Potential an Flugzeugen und Piloten dauerhaft auszuschalten.Göring und Hitler hatten sich entschieden, London anzugreifen. Auch die Industriestädte Coventry und Birmingham waren Ziel der Angriffe.
Aber man schaffte es nicht, die Industrie entscheidend zu treffen oder die Bevölkerung zu demoralisieren. Die RAF und ihre Stützpunkte blieben durch die Zielverlagerung aber verschont. Die ohnehin bescheidenen Ressourcen an Menschen und Material wurden weiter zersplittert. Die Luftwaffe war so an keiner Front schlagkräftig genug, um den englischen Widerstand zu brechen. Eine weitere Folge war, dass die ins Auge gefasste Landungsoperation auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste.
Erstmals war es Hitler nicht gelungen, einem Land seinen willen aufzuzwingen.
Dafür dachte er an einen Angriff auf die Sowjetunion. “Lebensraum im Osten”. Schon in “Mein Kampf” hatte er geschrieben: “Damit ziehen wir Nationalsozialisten bewußt einen Strich unter die außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit. Wir setzen dort an, wo man vor sechs Jahrhunderten endete. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur Bodenpolitik der Zukunft. Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Rußland und die ihm untertanen Randstaaten denken” (Adolf Hitler: Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band. S. 742.)
So gab er am 18. November 1940 die Weisung Nr. 21 “Fall Barbarossa” heraus
“Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall Barbarossa).
Das Heer wird hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben mit der Einschränkung, dass die besetzten Gebiete gegen Überraschungen gesichert sein müssen.” (online www.1000dokumente.de). Das war er konkrete Angriffsplan.
Italien seit dem Dreimächtepakt, der am 27. September 1940 in Berlin zwischen Italien, Japan und Deutschland geschlossen worden war, Deutschlands Kriegsverbündeter führte seit September 1940 einen Parallelkrieg in Nordafrika und im Mittelmeerraum.
Mit Verspätung startete am 9. September eine italienische Offensive gegen das von Großbritannien besetzte Ägypten. Ziel war es, den Suezkanal unter Kontrolle zu bringen. Nach Anfangserfolgen kam die Offensive ins Stocken und blieb weit hinter den
Erwartungen zurück. Am 28. Oktober begann Italien mit der Invasion in Griechenland. Das verbesserte die Lage in Ägypten natürlich nicht, sondern lenkte lediglich die Aufmerksamkeit ab. Mussolini glaubte an einen raschen Sieg. der Einmarsch entwickelte
sich aber zu einem Fiasko für den Duce. Die griechischen Truppen waren gut organisiert und kannten sich in dem schwierigen Gelände natürlich bestens aus. Die Italiener wurden in nur 14 Tagen über die Grenzen Albaniens zurückgedrängt.
In Nordafrika hatte Großbritannien einen erfolgreichen Gegenangriff zur Rückeroberung gestartet. Dieser verlief so erfolgreich, dass die italienische 10. Armee in Nordafrika fast vollständig aufgerieben wurde. Hitler zögerte lange, weil es natürlich den
geplanten Feldzug gegen Russland beeinträchtigte. Am 11. Januar gab er mit der Weisung Nr. 22 schließlich den Einsatzbefehl für das Afrikakorps unter General Erwin Rommel. Rommels Meinung stand in krassem Gegensatz zu der des italienischen
Generals Gariboldi, der auf Defensive setzte. Rommel begann am 31. März eigenmächtig den Vormarsch und warf mit seiner Taktik des mobilen Wüstenkriegs die englischen Truppen rasch 800 Kilometer zurück und kam erst bei Tobruk zum Stehen.
Rommels Truppen waren allerdings zu schwach, um Tobruk einzunehmen. Nach schweren Verlusten befahl Rommel, die Eroberung dieser Hafenstadt zunächst zurückzustellen. Da das Afrikakorps mit schweren Versorgungsengpässen zu kämpfen hatte,
konnte man keine weiteren Vorstöße in Richtung Osten machen. Es kam zum Stellungskrieg bei Tobruk/Sollum. Im November begann Großbritannien mit der Operation Crusader. Die Besatzung von Tobruk konnte ausbrechen und es gelang den Engländer,
die deutschen Truppen fast auf ihre Ausgangsstellungen in der Cyrenaika zurückzuwerfen. Von Malta aus hatten britische U-Boote und Flieger die italienischen und deutschen Nachschubwege nach Nordafrika massiv gestört.
Anfang Januar flog nun die Luftflotte 2 Angriffe auf wichtige Knotenpunkte in Malta. Nun lief der Nachschub für eine Zeit wieder störungsfrei und Rommel konnte wieder die Initiative zurückgewinnen. Frisch herangeführte Verstärkungen und die Luftunterstützung ermöglichten ihm den Gegenangriff. Am 26. Mai startete eine neue Offensive mit dem Ziel Tobruk zu erobern. Das gelang am 20. Juni 1942. Die NS-Propaganda feierte diesen Handstreich und Rommel wurde zum Generalfeldmarschall befördert.
Die Panzertruppen kamen bis El Alamein. das ist 100 Kilometer vor Alexandria.Die Stadt sollte genommen werden und der Suezkanal besetzt werden. Hitler plante bereits, nach der Einnahme des Suezkanals weiter nach Vorderasien und bis nach Indien

vorzustoßen und von dort die englischen Kolonien zu bedrohen. Soweit kam es aber nicht. die Engländer hatten vor El Alamein einen Verteidigungsgürtel aufgebaut. Südlich davor war sumpfiges Gelände, so dass der Gürtel nicht umgangen werden konnte.
Versorgungsengpässe waren aufgetreten. Die Offensive blieb stecken. Rommel wollte nun im August die Entscheidung erzwingen. Aber entgegen der Erwartungen war die Nachschubversorgung wesentlich schlechter geworden, da britische U-Boote immer mehr Schiffe versenken konnten. Außerdem war es dem britischen Nachrichtendienst gelungen, wichtige Erkenntnisse aus der Entschlüsselung des verschlüsselten geheimen deutschen Nachrichtenverkehrs zu gewinnen. So kannte die britische Armee bereits
vor dem Angriff der Deutschen die Angriffsschwerpunkte. So war der Widerstand wesentlich stärker. die angestrebten Ziele wurden nicht erreicht und der gewonnene Boden musste wieder aufgegeben werden.
Am 13. August 1942 übernahm Bernhard Montgomery den Oberbefehl über die 8. Armee, die in Nordafrika kämpfte. Am 23. Oktober startete er bei El Alamein den Gegenangriff gegen die Achsenmächte. Die kräftemäßig unterlegenen deutschen und Italiener wurden zum Rückzug nach Libyen gezwungen. Am 8. November 1942 landeten in Marokko und Algerien 100.000 Mann frische Kräfte aus Amerika und Großbritannien. Nun wurde ein Zweifrontenkrieg gegen das Afrikakorps eröffnet. Tobruk fiel am
13. November wieder an die Briten zurück. An der Ostfront (dazu später) war die Lage ebenfalls kritisch geworden das Desaster von Stalingrad bahnte sich an. Das Oberkommando der Wehrmacht konnte deshalb dem Afrikakorps kaum Verstärkung anbieten.
Das Kräfteverhältnis hatte sich inzwischen total verändert. Den Truppen der Achsenmächte standen 500.000 alliierte Soldaten gegenüber. Das waren doppelt soviel. Dazu verfügten die Alliierten über die vierfache Zahl an Panzern und die totale Luftüberlegenheit.
Ende Januar musste Libyen aufgegeben worden. Im März und April wurden die Soldaten der Achsenmächte eingeschlossen. Rommel flog nach Deutschland und schlug Hitler vor, das Afrikakorps nach Europa zurückzuziehen. Hitler blieb stur und verweigerte das wütend.Die Folge 230.000 Mann gerieten in Kriegsgefangenschaft. Die alliierten hatten nun die Kontrolle über den Mittelmeerraum und damit gute Voraussetzungen für die Landung auf Sizilien.
Auch auf dem Balkan hatte das militärische Vorgehen Italiens Hitler zum Eingreifen gezwungen, obwohl seit November 1940 Russland das Ziel war. Im Herbst hatten Italien und Deutschland die Balkanländer umworben. Schon vor dem Krieg waren sie wichtige
Rohstoff-und Nahrungsmittellieferanten. Am 27. Mai 1940 wurde der Öl-Waffen Pakt abgeschlossen. Er sah rumänisches Öl gegen deutsche Waffen vor. Es war vor allem für die deutsche Seite ein profitables Geschäft. Der Pakt legte eine feste Preisrelation für die von Rumänien zu liefernden Mineralölerzeugnissen und den Waffen, die es dafür bekam fest und zwar unabhängig von den jeweiligen Tagespreisen am Markt. Am 23. November schließlich trat Rumänien dem Dreimächtepakt bei, um sich vor einer sowjetischen
aber auch vor einer deutschen Aggression zu schützen. Bulgarien hatte unter Zar Boris der Deutschen Wehrmacht zunächst ein Durchmarschrecht nach Griechenland eingeräumt. Am 1. März 1941 trat es dem Pakt bei. Am 25. März 1941 trat schließlich
noch das Königreich Jugoslawien bei unter Prinz Paul ein. Allerdings kam es zwei Tage später zu einem probritischen Militärputsch. Hitler akzeptierte den Versuch der neuen Regierung unter General Simovic nicht, zu einer neutralen Politik zurückzukehren und
begann am 6. April 1941 mit dem Angriff auf Jugoslawien. In der Weisung 25 vom 27.3.1941 hört sich das so an “Der Militärputsch in Jugoslawien hat die politische Lage auf dem Balkan geändert. Jugoslawien muss auch dann, wenn es zunächst Loyalitätserklärungen abgibt, als Feind betrachtet und daher so rasch als möglich zerschlagen werden.” Der Angriff auf Griechenland begann zur selben Zeit. Beide Staaten waren ohne Kriegserklärung oder vorheriges Ultimatum angegriffen worden. Insgesamt kämpften 33 Divisionen mit
680.000 Mann auf deutscher Seite. Belgrad wurde schon am 12. April eingenommen. Am 17. April kapitulierten die jugoslawischen Streitkräfte. Jugoslawien wurde in 10 Teile mit unterschiedlichem staatsrechtlichen Status aufgeteilt. Kroatien erklärte sich am 15. April zum unabhängigen Staat Kroatien.Dort etablierte sich ein Vasallenstaat unter Führung der Ustascha, auf Deutsch “Der Aufständische-Kroatische revolutionäre Organisation”. Serbien wurde stark verkleinert und umfasste nur noch ein viertel der
Gesamtfläche des ehemaligen Jugoslawiens. Etwa 180.000 Serben wurden zum Arbeitseinsatz nach Deutschland verschleppt.
In Griechenland marschierten die deutschen Truppen unter Generalfeldmarschall List über Bulgarien ein.Auch hier kamen die Truppen rasch vorwärts. Am 20. April ordneten die Briten die Evakuierung ihrer Truppen zunächst nach Kreta und dann nach Ägypten an. Über 50.000 Mann konnten entkommen. Die griechische Armee kapitulierte am 20. April vor dem SS Obergruppenführer Sepp Dietrich und dann nochmals zwei Tage späte, weil die italienische Armee ihre kämpferische Leistung nicht genügend gewürdigt sah,
offiziell gegenüber Deutschland und Italien. Am 27. April wurde Athen eingenommen. Der Feldzug endete am 29. April mit der Einnahme von Kalamata im Süden der Peloponnes. Kreta wurde in der Zeit vom 21. Mai bis 1. Juni in einer äußerst verlustreichen
Luftlandeoperation eingenommen.
Beide Länder waren besiegt. Doch es folgte ein Partisanenkrieg, der von deutscher Seite aus mit unerbittlicher Härte geführt wurde. In Jugoslawien, in Griechenland und auf Kreta beging die Wehrmacht schwere Kriegsverbrechen.
So wurden in Kalvrita im Aroania-Bergmassiv im Dezember über 800 Jungen und Männer in einer 5 Stunden dauernden Massenhinrichtung erschossen. In dieser gesamten Bergregion wurden in den Dezembertagen über 1300 Griechen umgebracht,
28 Dörfer und Klöster wurden niedergebrannt. In Kommeno in Epirus wurden über 300 Dorfbewohner brutal ermordet. In Distomo am Fuße des Parnass-Gebirges kamen über 200 Menschen ums Leben. Obwohl die Einheitsführer, die die Aktionen
angeordnet hatten, bekannt sind, kam es zu keiner Verurteilung. Zwar wurde bei dem Distomo Massakers ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet, dieses aber nach drei Jahren wegen Verjährung wieder eingestellt.
Der Balkanfeldzug verschob den Angriff auf die Sowjetunion um 4 Wochen. Am 22. Juni 1941 übergibt der deutsche Botschafter Friedrich Werner Graf von der Schulenburg dem sowjetischen Außenminister Molotow ein “Memorandum”.
Darin steht, die Sowjetunion habe den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt durch den Aufmarsch der roten Armee an der Grenze sowie durch die Annexion Ostpolens und der baltischen Staaten gebrochen. Dieser Bedrohung müsse die Wehrmacht mit allen Machtmitteln entgegentreten. Das Wort “Kriegserklärung” durfte auf Hitlers Befehl nicht verwendet werden. Zu dem Zeitpunkt der Übergabe des Memorandum bombardierte die Luftwaffe sowjetische Städte schon seit drei Stunden.
Juristisch war das Feld schon ab März vorbereitet worden. Am 13. Mai kam der “Erlass über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet „Barbarossa“und über besondere Massnahmen der Truppe” heraus. Darin wird festgelegt, dass Straftaten
feindlicher Zivilpersonen der Zuständigkeit von Kriegsgerichten und Standgerichten bis auf weiteres entzogen und dass Freischärler “durch die Truppe im Kampf oder auf der Flucht schonungslos zu erledigen” sind. Gegen Ortschaften
“aus denen die Wehrmacht hinterlistig oder heimtückisch angegriffen wurde” werden unverzüglich kollektive Gewaltmassnahmen durchgeführt, falls ein Täter nicht rasch festgestellt werden kann oder die Umstände dies nicht zulassen.
Zum Freibrief für Verbrechen wird die durch die Bestimmung “Für Handlungen, die Angehörige der Wehrmacht und des Gefolges gegen feindliche Zivilpersonen begehen, besteht kein Verfolgungszwang, auch dann nicht, wenn die Tat zugleich ein militärisches Verbrechen oder Vergehen ist.”
Die “Aktennotiz über Ergebnis der heutigen Besprechung mit den Staatssekretären über Barbarossa, 2. Mai 1941” lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und wurde am 26. November 1945 im Nürnberger Prozess von dem amerikanischen Anklagevertreter Sidney S. Alderman verlesen.Er sagte dazu: „Noch niemals ist wohl ein unheilvollerer Satz niedergeschrieben worden, als der Satz in dieser Urkunde” Es geht um die ersten beiden Punkte in diesem Dokument.
“1.) Der Krieg ist nur weiter zu führen, wenn die gesamte Wehrmacht im 3. Kriegsjahr aus Rußland ernährt wir.
2.) Hierbei werden zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird.”
Komplettiert wurden diese Bestimmungen mit dem sogenannten Kommissarbefehl vom 6. Juni 1941: “Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare. Im Kampf gegen den Bolschewismus ist mit einem Verhalten des Feindes nach den Grundsätzen der Menschlichkeit oder des Völkerrechts nicht zu rechnen. Insbesondere ist von den politischen Kommissaren aller Art als den eigentlichen Trägern des Widerstandes eine hasserfüllte, grausame und unmenschliche Behandlung unserer Gefangenen zu erwarten. Die Truppe muß sich bewußt sein: 1. In diesem Kampf ist Schonung und völkerrechtliche Rücksichtnahme diesen Elementen gegenüber falsch. Sie sind eine Gefahr für die eigene Sicherheit und die schnelle Befriedung der eroberten Gebiete. 2. Die Urheber barbarisch asiatischer Kampfmethoden sind die politischen Kommissare. Gegen diese muß daher sofort und ohne weiteres mit aller Schärfe vorgegangen werden. Sie sind daher, wenn im Kampf oder Widerstand ergriffen, grundsätzlich sofort mit der Waffe zu erledigen. “
(NS-Archiv Dokumente zum Nationalsozialismus –online)
121 Divisionen mit 3 Millionen deutscher Soldaten und weiterer 600.000 aus Italien, Ungarn, Finnland, Rumänien und der Slowakei waren beteiligt. (Zahlen unter anderem bei David Glantz Stumbling Colossus. The Red Army on the Eve of World War. University of Kansas Press, Lawrence 1998, S. 295.) Die Front war 2130 Kilometer lang. Die Heeresgruppe Mitte unter Generalfeldmarschall von Bock war die stärkste der drei Heeresgruppen. Sie kam auch sehr rasch voran. Am 30. Juni wurde die Grenzstadt Brest-Litowsk eingenommen. Die Kesselschlacht bei Bialystok- Minsk war die erste große Kesselschlacht des Rußlandfeldzugs. An der sowjetischen Westfront standen 46 Divisionen. Elf konnten ausbrechen.28 Divisionen und 7 Panzerdivisionen mit 325.000 Mann, 1.809 Geschützen und 3.332 Panzern wurden geschlagen, die Soldaten größtenteils gefangen genommen. Den Kommandanten der Westfront Pawlow machte Stalin für die Niederlage verantwortlich und ließ ihn nach Moskau kommen. dort wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen. In der Gegend um Smolensk hatte die Rote Armee eine neue Verteidigungslinie aufgebaut. Smolensk ist etwa 330 Kilometer von Minsk entfernt. Auch hier gelang es der Wehrmacht starke Kräfte einzukesseln.
Über 300.000 Rotarmisten und etwa 3000 Panzer waren eingeschlossen. Zeitweise konnte die Rote Armee den Kessel aufbrechen und zahlreiche Truppen verlegen. Auch in der Schlacht bei Smolensk hatte die Rote Armee enorme Verluste
zu verzeichnen. Vom 10. Juli bis 10. September waren das 760.000 Mann, davon 468.000 gefallen, vermisst oder in Gefangenschaft geraten, 274.000 verwundet. Aber auch die Wehrmacht hatte enorme Verluste. Und sie hatte auf dem Weg nach
Moskau viel Zeit verloren, denn die rote Armee hatte rund zwei Monate standgehalten. Das bot Zeit und Gelegenheit die Verteidigung von Moskau auszubauen. Die Wehrmacht war jetzt nur noch 400 Kilometer von Moskau entfernt.
Die Heeresgruppe Süd unter Generalfeldmarschall von Rundstedt konnte am 29. Juni bei der Panzerschlacht von Dubno-Luzk-Riwne fast das gesamte Mechanisierte Korps der Roten Armee vernichten. Darauf folgte die Kesselschlacht bei Uman.
Dabei eroberte sie über 300 Panzer und 850 Geschütze unzerstört. 103.000 Mann kapitulierten. Die Einschließungskräfte für den Kessel waren aber relativ schwach, so dass zehntausende Rotarmisten entkommen konnten. Ihre schweren Waffen und
Ausrüstung mussten sie allerdings zurücklassen. Die Heeresgruppe Süd beherrschte nun den Dnepr-Bogen. Das Hinterland der Ukraine war nun offen. Die verlorene Schlacht war der erste Schritt zur Eroberung der Ukraine.
Die deutsche Generalität sah das vorrangige Ziel nun in einer sofortigen Einnahme Moskaus. Es hatte eine wichtige geographische Bedeutung, war Verkehrs und Nachrichtenzentrale und ein wichtiges Industriegebiet und natürlich
politischer Mittelpunkt. Hitler dagegen wollte die für den Ostseeraum, die Ukraine und den Süden lebenswichtigen Resourcen zerstören oder unter deutsche Kontrolle bringen. Hitler lehnte die Vorschläge des Generalstabs rundheraus ab
Er bestand darauf, nach Leningrad im Norden und Kiew im Süden vorzustoßen, setzte sich durch. – und hatte Erfolg. Am 26. September endete die Kesselschlacht von Kiew. Nochmals waren 600.000 Rotarmisten in Gefangenschaft geraten. Über 800
Panzer waren erbeutet worden,über 400 Pak und über 3000 Geschütze. Die Einnahme bereitete allerdings nachträglich noch große Probleme. Es waren viele durch Funk auszulösende Sprengungen vorbereitet worden. Ein solcher Sprengsatz löste am 25. September
einen Großbrand aus, der erst am 29. September unter Kontrolle gebracht werden konnte und für große Verluste der deutschen Verbände in der Stadt sorgte.
Die frappierend schnellen siege, die enorme zahl an Kriegsgefangenen blendete die deutsche Führung. Schon im Juli hielt General Halder den Feldzug für gewonnen.
Die Zeit war aber knapp geworden. Der russische Winter war nicht mehr allzu fern und erfahrungsgemäß kam vor dem ersten Frost eine mehrwöchige Schlammperiode. Am 30. September startete die Offensive unter dem Decknamen Taifun.
Hitler wollte mit diesem Unternehmen vor Einbruch des Winters die russischen Truppen vor Moskau “entscheidend” schlagen.Seine Soldaten sollten “zu dem letzten gewaltigen Hieb, der noch vor dem Einbruch des Winters diesen Gegner zerschmettern soll“
ansetzen und auch die historische Dimension lieferte Hitler in seinem Tagesbefehl am 2. Oktober 1941 verlesen ließ. Sie sollten nicht nur das deutsche Reich sondern ganz Europa vor einer Gefahr schützen„wie sie seit den Zeiten der Hunnen und später der Mongolenstämme entsetzlicher nicht mehr über dem Kontinent schwebte“ und weiter „Dieser Feind besteht nicht aus Soldaten, sondern zum großen Teil nur aus Bestien.“ (zitiert in Die Zeit vom 13. Dezember 1991)
Zwar warnten auch diesmal die Generale eindringlich, dass weder die Ausrüstung ausreichend noch der Nachschub gewährleistet sei. Aber sie beugten sich auch dieses Mal. Und wieder schien der Führer recht zu behalten in den Kesselschlachten von Wjasma und Brjansk wurden nochmals 673.000 sowjetische Soldaten gefangen genommen und über 1300 Panzer erbeutet.
Die Wehrmacht war nun bis an den äußeren Verteidigungsring Moskaus gelangt. Aber nun setzte die Schlammperiode ein. Der Angriff blieb buchstäblich im Schlamm stecken.

Der Nachschub war wegen der aufgeweichten Wege und Straßen kaum mehr zu bewältigen und sank von 900 Tonnen täglich auf 20 Tonnen. Erst als im November leichter Frost einsetzte, waren die Straßen wieder befahrbarer. Aber es dauerte dann fast noch
zwei Wochen, bis genug Treibstoff und Munition angeliefert war, um die Offensive fortzusetzen. Nun setzte strenger Frost ein. Die Temperaturen sanken auf – 35 °, aber die deutschen Soldaten hatten immer noch keine Winterkleidung, was hohe Ausfälle
durch Erfrierungen zur Folge hatte. Die schützende Winterkleidung lagerte irgendwo auf polnischen Bahnhöfen. Die Loks, sofern sie überhaupt noch fahren können, müssen Munition, Treibstoff und Proviant an die Front bringen.
Was erstaunlicherweise aber immer noch funktioniert: jeden zweiten Tag ein Güterzug der Deutschen Reichsbahn jüdische Deportierte ins Ghetto nach Minsk!
Die Rote Armee dagegen war seit November vollständig mit warmer Kleidung ausgerüstet. Die Deutschen waren Ende November noch 18 Kilometer von der Stadtgrenze Moskaus entfernt.
Gleichzeitig hatte die Rote Armee aber auch mit den Planungen für eine Gegenoffensive begonnen.Die Planungen wurden durch einen Funkspruch Richard Sorges erleichtert. Sorge hatte am 1. Juni 1941 Stalin vor einem Angriff Deutschlands
gewarnt “Der Überfall wird am 22. Juni in aller Frühe auf breiter Front erfolgen” (in Julius Mader Dr. Sorge Report). Stalin glaubte dies aber nicht. Im September informierte Sorge Moskau, dass Japan nicht Russland angreifen würde, sondern
Indochina. Diesmal wurde ihm geglaubt. Daraufhin ließ Stalin 32 ausgeruhte Divisionen aus dem Fernen Osten in den Westen verlegen. Zwar hatte die deutsche Luftabwehr im November Truppenausladungen erkannt. Die deutsche Führung hatte dies
aber als Gespenstereien betrachtet. Am 16. November startete der erneute Angriff. Aber er traf auf erbitterten russischen Widerstand. Größere Teile der Luftflotte 2 unter Kesselring waren in den Mittelmeerraum verlegt worden, da dort Libyen verloren zu gehen
drohte. Das ermöglichte aber den sowjetischen Luftstreitkräften in wichtigen Abschnitten die Lufthoheit zu erringen. Die Generale von Bock und Guderian meldeten dem Oberkommando die bedrohliche Lage und auch, dass die Trupp erschöpft war.
Sie wurden aufgefordert, die Offensive mit einem letzten Kraftaufgebot fortzusetzen, zumal man annahm, dass auch auf russischer Seite mit den “letzten Bataillonen” gekämpft wurde. Halder sah die Entscheidung über Sieg oder Niederlage
immer noch als eine Willensfrage. Er war“durchdrungen von dem Gedanken, daß es bei beiden Gegnern um die letzte Kraftanstrengung geht und der härtere Wille recht behält“. (zitiert nach Der Spiegel ).
Im Divisionsbericht der 7. Infanteriedivision heißt es “Die völlige Verausgabung der Truppe und die Notwendigkeit von Ablösungen “ (Zitat in Die Welt vom 22.06.11)Fedor von Bock konstatierte, dass der Zeitpunkt sehr nahe sei,
„in dem die Kraft der Truppe völlig erschöpft ist“ (Zitat ebd.) Eigentlich hätte die Offensive abgebrochen werden müssen, die Truppe in Winterquartiere überführt werden. Stattdessen befahlen Hitler und die Wehrmachtsführung die weitere Offensive.
Diese kam Anfang Dezember zum völligen Erliegen.
Mit der Verteidigung Moskaus war Marschall Schukow betraut worden.Er und Stalin hatten die Nervenstärke, abzuwarten, bis die deutsche Offensive versiegte. Am 5. Dezember begann der Gegenangriff. Eine Million Mann und 700 Panzer
waren angetreten. Die deutsche Führung war völlig überrascht. Die deutschen Linien werden fast überall durchstoßen. Manche Divisionen entkommen nur mit Mühe der Umzingelung. Die deutsche Führung hatte dies zunächst nicht als Großangriff
der Roten Armee erkannt und befahl erst abends, den Angriff auf Moskau abzubrechen und in den Ausgangsstellungen auf Verteidigung überzugehen.
Am 7. Dezember 1941 überfielen aber auch die Japaner den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii. Am 11. Dezember erklären Italien und Deutschland den USA den Krieg. In seiner Rede vor dem Reichstag am 11. Dezember 1941
spricht er zunächst ausschweifend von den militärischen erfolgen Deutschlands. Dann zählt er eine Reihe “Völkerrechtsverletzungen der USA auf, um “Deutschland endlich zum Kriege zu zwingen”. Und dann bringt er es schließlich
auf den Punkt, was tatsächlich zum Krieg führt. “Wir wissen, welche Kraft hinter Roosevelt steht. Es ist jener ewige Jude, der seine Zeit als gekommen erachtet, um das auch an uns zu vollstrecken, was wir in Sowjetrußland alle schaudernd sehen und erleben mußten. Wir haben das jüdische Paradies auf Erden nunmehr kennengelernt. Millionen deutscher Soldaten haben den persönlichen Einblick gewinnen können in ein Land, in dem dieser internationale Jude Mensch und Gut zerstörte und vernichtete. Der Präsident der Vereinigten Staaten mag das vielleicht selbst nicht begreifen. Dann spricht das nur für seine geistige Beschränktheit.” (in Internet Archive Full text of „Adolf Hitler Krieg gegen die USA und Kriegsbericht 1941)
Am 19. Dezember entließ Hitler von Brauchitsch. Er übernahm selbst das Oberbefehl über das Heer. Am Tag zuvor hatte er Haltebefehle erteilt und die Truppen gezwungen “fanatisch” in ihren Stellungen auszuharren. Als Guderian Ende
Dezember entgegen der Haltebefehle seine Truppen eigenmächtig zurücknahm, wurde er seines Kommandos enthoben und zur Führerreserve versetzt, was praktisch einer vorübergehenden Versetzung in den Ruhestand gleichkam.
Am 8. Januar 1942 musste Generaloberst Hoepner seine Truppen zurücknehmen. Sie wären sonst eingekesselt worden. Hitler enthob ihn nicht nur seines Kommandos. Er wurde wegen „Feigheit und Ungehorsam“ unehrenhaft aus der Wehrmacht ausgestoßen.
Hoepner meinte dazu “ich habe Pflichten, die höher stehen als die Pflichten Ihnen gegenüber und die Pflichten gegenüber dem Führer. Das sind die Pflichten gegenüber der mir anvertrauten Truppe.” (zitiert bei Janusz Piekalkiewicz: Der Zweite Weltkrieg. Teilband II, Seite 570). Hitler hätte den General eigentlich nicht so einfach entlassen können. Er hätte formaljuristische und beamtenrechtliche Vorschriften einhalten müssen. Am 26. April 1942 erließ der Großdeutsche Reichstag einen Beschluss der den Führer praktisch
von solchen Vorschriften befreit. “Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Führer in der gegenwärtigen Zeit des Krieges, in der das deutsche Volk in einem Kampf um Sein oder Nichtsein steht, das von ihm in Anspruch genommene Recht besitzen muß, alles zu tun, was zur Erringung des Sieges dient oder dazu beiträgt. Der Führer muß daher – ohne an bestehende Rechtsvorschriften gebunden zu sein – in seiner Eigenschaft als Führer der Nation, als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht, als Regierungschef und oberster Inhaber der vollziehenden Gewalt, als oberster Gerichtsherr und als Führer der Partei jederzeit in der Lage sein, nötigenfalls jeden Deutschen – sei er einfacher Soldat oder Offizier, niedriger oder hoher Beamter oder Richter, leitender oder dienender Funktionär der Partei, Arbeiter oder Angestellter – mit allen ihm geeignet erscheinenden Mitteln zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten und bei Verletzung dieser Pflichten nach gewissenhafter Prüfung ohne Rücksicht auf sogenannte wohlerworbene Rechte mit der ihm gebührenden Sühne zu belegen, ihn im besonderen ohne Einleitung vorgeschriebener Verfahren aus seinem Amte, aus seinem Rang und seiner Stellung zu entfernen.“ (Reichsgesetzblatt 1942 I S.247, )
Hoepner wurde im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 am 21. Juli verhaftet und am 8. August unter Roland Freisler zum Tode verurteilt und am selben Tag hingerichtet.
Im Russlandfeldzug hatte die Wehrmacht bis dahin 500.000 Mann an Toten und Verwundeten verloren. Dazu kamen weitere 100.000 Mann die durch Erfrierungen ausfielen.1300 Panzer, 2500 Geschütze und über 15.000 Kfz gingen an Material verloren.
Die Wehrmacht konnte aber bis Ende Januar 1942 eine neue Verteidigungslinie aufbauen. Aber die Blitzkriegsstrategie war gescheitert, der Gegner nicht entscheidend geschwächt.
Zurück zu Bürkels letzten Jahren
Bürckel war so etwas wie Hitlers Fachmann für Anschlüsse geworden. Lothringen war die dritte Rückgliederung, die er durchzuführen hatte und auch hier hatte er wieder weitreichende Vollmachten. Aber in Lothringen wurde nicht gleichgeschaltet.
Es ging um die Liquidierung staatsrechtlicher und administrativer Strukturen eines eroberten Landes. Dazu kam die ideologische Umerziehung unter rassistischen Gesichtspunkten.
Die CdZ sollten die gesamte Verwaltung im zivilen Bereich führen. Die unklare Kompetenzdefinition führte wie auch in Österreich rasch zu heftigen Auseinandersetzungen. In einer Besprechung in der Reichskanzlei am 29. September 1940 bekamen die beiden CdZ weitgehend grünes Licht von Hitler. Er legte fest, dass für die gesamte Neuordnung in Elsass und Lothringen allein die beiden Reichsstatthalter Wagner und Bürkel zuständig und verantwortlich seien und dass die Reichsressorts den CdZ keinerlei Weisungen erteilen könnten. Bürckel begann nun in Lothringen eine rücksichtslose Germanisierungspolitik. “Deutschfeindliche Elemente” ließ er ausweisen.So wurden bis November 1940 aus dem Elsass 105.000 Menschen deportiert, aus Lothringen etwa 50.000, darunter alle lothringischen Juden. (Zahlen nach bpb Krieg und Besatzung in Ost- und Westeuropa)Die Transporte erfolgten unter chaotischen Verhältnissen. Die Ausgewiesenen hatten nur ihr Handgepäck dabei. Das unbewegliche Gut, Höfe, Geschäfte und handwerkerbetriebe mussten zurückgelassen werden und worden sofort entschädigungslos eingezogen. Am 21. November 1940 erklärte Bürckel die Ausweisungsaktion offiziell für beendet. Am 9.10 1941 wurde die Gültigkeit des RAD-Gesetzes für Elsass und Lothringen erklärt.
Allerdings entzogen sich viele Lothringer durch Flucht ihrer “Aufbaupflicht”. Daraufhin arbeitete Bürckel mit dem Mittel der Sippenhaft. Noch härter reagierte Bürckel, als Lothringer nach der Einführung der Wehrpflicht desertierten. Deren Angehörige nahm Bürckel
sofort in Sippenhaft, ließ sie umgehend ins Altreich aussiedeln und ihr Vermögen beschlagnahmen. Eine letzte große Aussiedlungsaktion betraf 8000 Menschen. Sie übertraf an Härte und Brutalität alle bisherigen Massnahmen.
Im August 1942 verlieh Bürckel den Lothringern die deutsche Staatsangehörigkeit.
Die Ausweisungspolitik Bürckels war in Regierungs-und Militärkreisen ihrer innen-und auch außenpolitischen Auswirkungen stark umstritten. So meldete sich der Chef der Präsidialkanzlei Otto Meissner, selbst gebürtiger Elsässer kritisch zu Wort.
Heftigster Kritiker war Dr. Best, der vor er Chef der Abteilung Verwaltung im Verwaltungsstab des Militärbefehlshabers Frankreich wurde, Karriere bei der Gestapo gemacht hatte. Er sah in den Ausweisungen eine Belastung des deutsch-französischen Verhältnisses,
die die notwendige Zusammenarbeit nur unnötig erschwerten. Bürckel war von dieser Kritik allerdings total unbeeindruckt. Allerdings mussten sowohl Bürckel als auch Wagner entscheidende Kompetenzen an den Reichsführer SS, der zugleich
Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums (RKF) war. Der durchbürokratisierte Apparat Himmlers beschränkte auf dem Gebiet der Volkstumspolitik die autonome Regionalherrschaft der Gauleiter.
Der Gau Westmark war 1940 gebildet worden. Er sollte den Gau Saarpfalz, also das Saarland und die bayrische Pfalz,
sowie das im Frankreichfeldzug eroberte lothringische Departement Moselle umfassen, das als Lothringen ins Reich eingegliedert werden sollte. Der Plan wurde während des 2. Weltkrieges aber nicht umgesetzt.
Es blieb nach außen hin beim alten Namen und bei der zugehörigen Bezeichnung „CdZ“ (Chef der Zivilverwaltung).
Im März 1941 wurde Bürckel von Hitler offiziell zum Reichsstatthalter ernannt.
Ihm unterstand nun ein 14.000 Quadratkilometer großes Territorium mit 2,6 Millionen Einwohnern. Das war der Höhepunkt seiner politischen Karriere
Im November 1942 wurde Bürckel zum Reichsverteidigungskommissar der „Westmark“ ernannt.
An dieser Aufgabe scheiterte er spätestens mit der Invasion und dem Vordringen der amerikanischen Truppen.
Dazu kamen Kompetenzschwierigkeiten mit Heinrich Himmler, die sich nach dessen Ernennung zum Innenminister erheblich verschärften.
Während der Schlacht um Lothringen Anfang September 1944 kam es in der Debatte um das militärische Vorgehen zum entscheidenden Zerwürfnis mit Hitler.
Auf Veranlassung von Martin Bormann (1900-1945) wurden Bürckel daraufhin am 8.9.1944 weit reichende Kompetenzen entzogen
Die Entsendung des Dienstleiters der Berliner Parteikanzlei Willi Stöhr (1903–1994) als „Bevollmächtigten des Reichsverteidigungskommissars für den Stellungsbau im Gau Westmark“ Anfang September 1944 bedeutete den Beginn der Entmachtung Bürckels.
Josef Bürckel verstarb wenig später am am 28.9.1944 in seinem Haus in Neustadt.
Die offizielle Todesursache war ein „Versagen des Kreislaufes“ als Folge einer Darmerkrankung und einer Lungenentzündung diagnostiziert.
Der plötzliche Tod gab Anlass zu Spekulationen.
Ein Nachweis für den Verdacht, Bürckel sei von der SS ermordet oder zum Selbstmord gezwungen worden, konnte jedoch nicht erbracht werden.



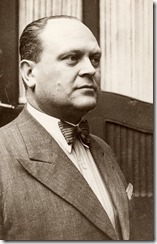




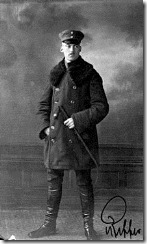


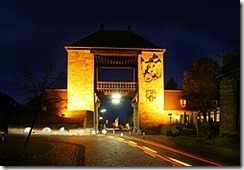
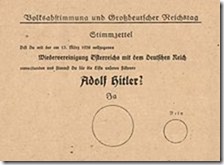

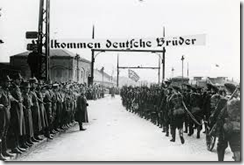









![[object Object]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Ertl_Kastl.png)







