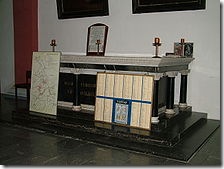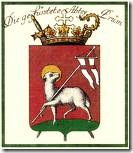Kloster Himmerod
Autor: Franz-Karl | Kategorie: Klöster in Rheinland-Pfalz
Kloster Himmerod ist das 14. Zisterzienserkloster und die erste Bernhardgründung in Deutschland. Auch heute noch abgelegen, wie es den Zielvorstellungen der Zisterzienser entsprach, wurde es 1135 an dem von Bernhard bestimmten Ort im Salmtal gegründet. 1134 wurde Abt Randulf von Bernhard in die Eifel geschickt. Freundschaftliche Beziehungen zwischen Bernhard und Albero von Montreuil, der 1131 zum Erzbischof von Trier ernannt wurde, führten zu dieser Entsendung, damit ein Zisterienserkloster auch auf trierischem Gebiet entstehen konnte. Von der entsandten Mönchsgruppe sind heute noch 9 Mönche namentlich bekannt. Und auch der Stab Randulfs ist noch erhalten. Die Mönche siedelten sich zuerst bei Winterbach an der Kyll an. Bernhard entsandte dann den Novizenmeister und Architekten Archard nach Himmerod, der dort das Kloster erbaute. Romanische Säulenreste des ersten Klosters lassen noch eine Vorstellung dieses Baues erahnen.
Der Gründerkonvent mit 12 Mönchen wohnte zunächst vorübergehend auf dem Gut Haymenrode, einer Rodung des erzstiftischen Bauern Haymo – daher Himmerod.
1136 wurde eine erste hölzerne Klosteranlage geweiht. 1134 erläßt das Generalkapitel die ersten Bau- und Kunstbestimmungen. Der zweite Klosterbau in Clairvaux wurde von demselben Baumeister wie Himmerod geplant. 1178 wurde der romanische Kirchenbau von Himmerod von Erzbischof Arnold von Trier geweiht. Das Kloster im Salmtal erlebte rasch eine erste Blütezeit und konnte sich des Ansturms junger Leute aus Ritterstand und Adel kaum mehr erwehren. So wurde rasch ein Filialkloster, das erste und einzige Himmerods im Mittelalter gegründet, nämlich Heisterbach. Von dort aus wurde 1212 eine neue Filiation, nämlich Marienstatt im Westerwald gegründet. Von diesem Kloster aus wurde 700 Jahre später also 1922 Himmerod wieder gegründet. Im 12. Jahrhundert wurde Himmerod das Kloster der Heiligen genannt. 74 Namen stehen im Heiligenverzeichnis des Ordens.
Die Grafen von Sponheim hatte bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts ihre Grablege in Himmerode. 1519 wurden dem Kloster die Pontifikalien, also die bischöflichen Insignien Mitra und Krummstab durch Papst Leo X. verliehen.
Die Zeit der Renaissance beeinflusste auch die geistige Entwicklung der Abtei. Die Mönche durften sich außerhalb des Klosters an Ordenskollegien ihren theologischen Studien widmen. Enge Beziehungen entwickelten sich vor allem mit der Universität Trier deren Rektor 1706 Abt Bootz wurde.
Im Dreißigjährigen Krieg hatte die Abtei schwer unter plündernden Soldaten zu leiden. Trotz des Krieges legte Abt Matthias Glabus den Grundstein für einen Klosterneubau, der 1688 unter Abt Bootz vollendet wurde.
Abt Leopold Kamp, der Sohn eines Himmeroder Hofpächters ließ 1739 von Christian Kretzschmar den Bau einer barocken Klosterkirche beginnen.
Am 26. Juli 1802 ließ die französische Regierung unter Napoleon das Kloster aufheben. Es wurde versteigert. Kloster und Kirche verfielen und wurden als Steinbruch genutzt. Nicht nur Klöster wurden aufgehoben. Die ganze Organisation des Zisterzienserordens wurde von Grund auf zerstört.
 Nach dem 1. Weltkrieg wurde deutschen Zisterziensermönchen aus Mariastern in Bosnien von der jugoslawischen Regierung die Rückkehr in ihr Professkloster untersagt. Auf der Suche nach einer neuen Heimat fiel der Blick der Mönche auf diese historische Stätte, obwohl viele guterhaltene Klosterbauten in Süddeutschland käuflich zu erwerben gewesen wären. Sie kauften das Gut Himmerod vom letzten Besitzer Reischsgraf Ottokar von Kesselstatt für 500000 Reichsmark. Die Abtei Marienstatt im Westerwald übernahm auf Wunsch der Trierer Kurie die Funktion einer Mutterabtei. Am 15. Oktober konnte man die kanonische Wiedererichtung Himmerods feiern. Die alten Konventsgebäude wurden bis 1927 wieder errichtet. Die klosterfeindliche Politik der Nazis erschwerte ab 1933 den weiteren Fortschritt. Erst nach dem 2. Weltkrieg konnte man daran gehen, die Barockkirche in den alten Ausmaßen zu rekonstruieren. Am 15. Oktober wurde die Kirche neugeweiht.
Nach dem 1. Weltkrieg wurde deutschen Zisterziensermönchen aus Mariastern in Bosnien von der jugoslawischen Regierung die Rückkehr in ihr Professkloster untersagt. Auf der Suche nach einer neuen Heimat fiel der Blick der Mönche auf diese historische Stätte, obwohl viele guterhaltene Klosterbauten in Süddeutschland käuflich zu erwerben gewesen wären. Sie kauften das Gut Himmerod vom letzten Besitzer Reischsgraf Ottokar von Kesselstatt für 500000 Reichsmark. Die Abtei Marienstatt im Westerwald übernahm auf Wunsch der Trierer Kurie die Funktion einer Mutterabtei. Am 15. Oktober konnte man die kanonische Wiedererichtung Himmerods feiern. Die alten Konventsgebäude wurden bis 1927 wieder errichtet. Die klosterfeindliche Politik der Nazis erschwerte ab 1933 den weiteren Fortschritt. Erst nach dem 2. Weltkrieg konnte man daran gehen, die Barockkirche in den alten Ausmaßen zu rekonstruieren. Am 15. Oktober wurde die Kirche neugeweiht.
Im Okober 1950 tagten ehemalige Wehrmachtsoffiziere, um im Auftrag der Regierung unter
Konrad Adenauer die Wiederbewaffnung Deutschlands vorzubereiten. Das Ergebnis dieser Tagung war die Himmeroder Denkschrift.
Heute leben 13 Mönche im Kloster, betreiben ein Museum, eine Buch- und Kunsthandlung , sowie eine Gaststätte, ein Gästehaus und eine Fischerei.
13 Jan. 2011