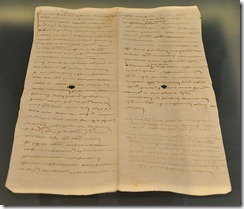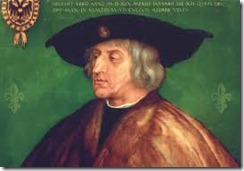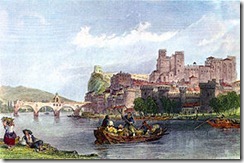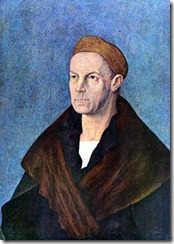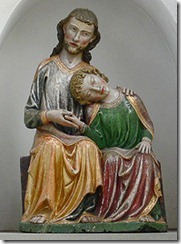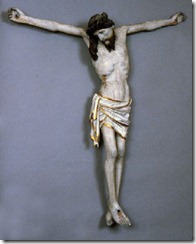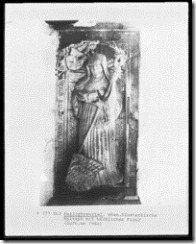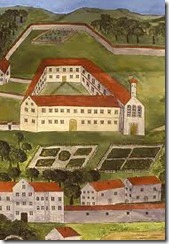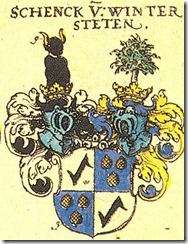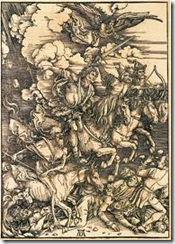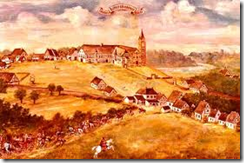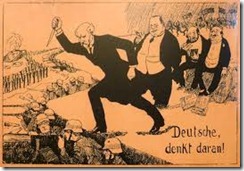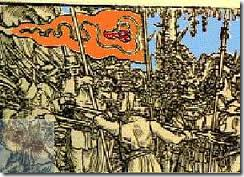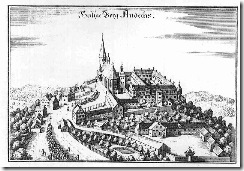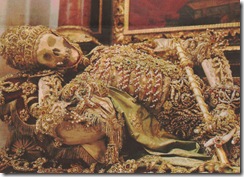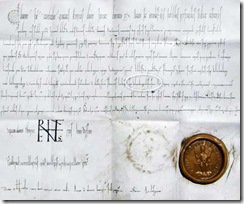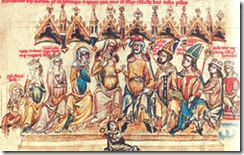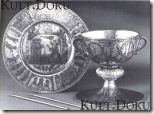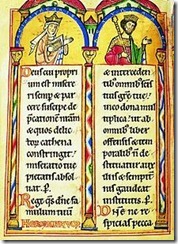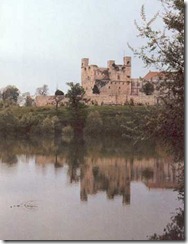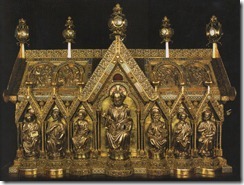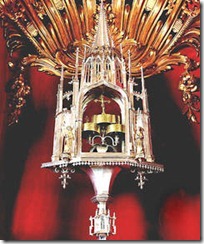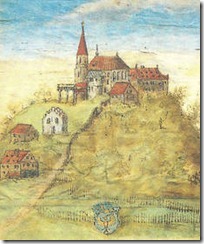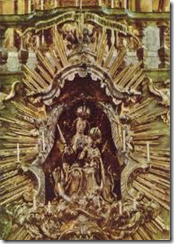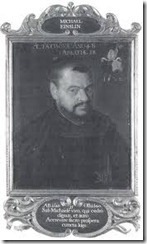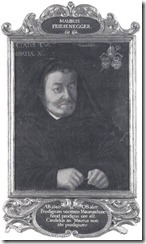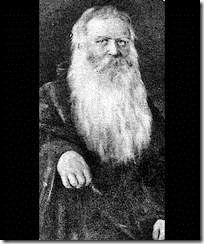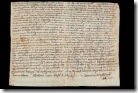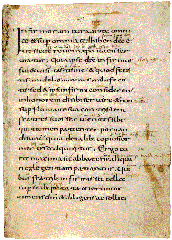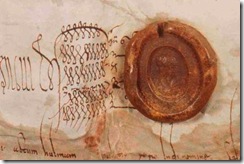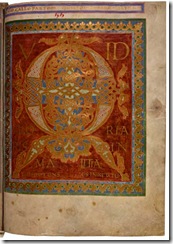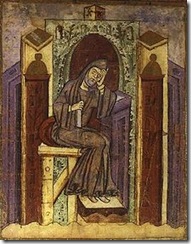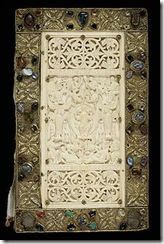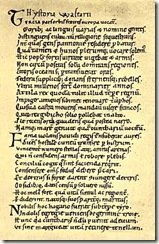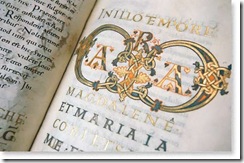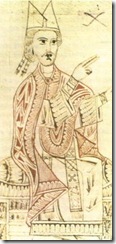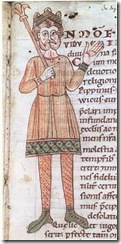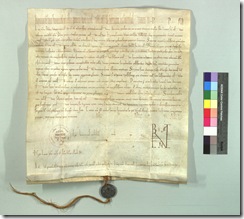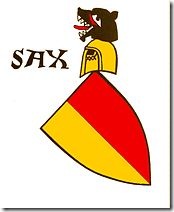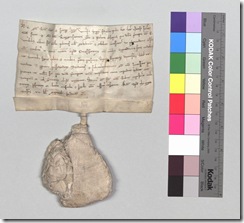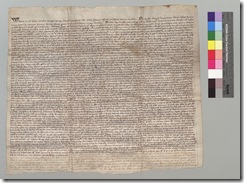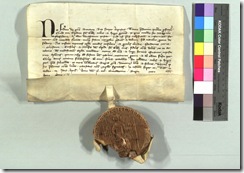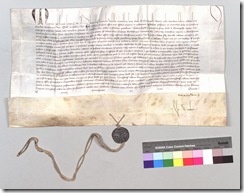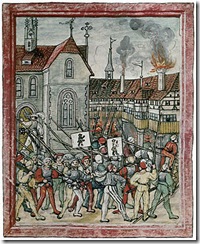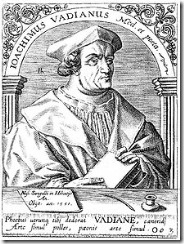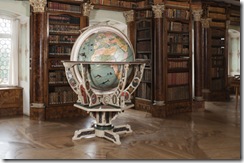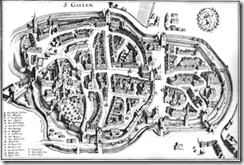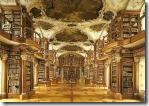Kloster Einsiedeln
Autor: Franz-Karl | Kategorie: Klöster in der Schweiz
Viele Klöster in der Schweiz sind aus einer Einsiedelei hervorgegangen. In St. Gallen hatte sich der irische Mönch 615 St. Gallus an der Steinach niedergelassen und dort eine Einsiedlerklause
errichtet. In Rheinau war das nach der Klosterüberlieferung der irisch-keltische Wandermönch Findan, in Dissentis war das der Legende nach 614 Sigisbert ein fränkischer Mönch, und wie Gallus
ein Schüler Kolumbans und in Einsiedeln, das ja schon in seinem Namen auf die Einsiedelei hinweist, hatte Meinrad seine Zelle errichtet.Meinhard oder Meginhard wurde in Sülchen geboren.
Das ist eine abgegangene Siedlung bei Rottenburg am Neckar. Die Siedlung gab auch dem Sülchgau seinen Namen. Dieser umfasste in etwa die heutigen Orte Kirchentellsinfurt, Rottenburg und Ergenzingen.
Meinhards Eltern, die namentlich nicht bekannt sind, gehörten dem alemannischen Adel an. Ein Verwandter Meinhards, Erlebald, wohl sein Onkel, war Lehrer an der Klosterschule in Reichenau.
Meinhard wurde, wie damals oft üblich, schon als Fünfjähriger auf die Reichenau gebracht. Erlebald wurde als Nachfolger Haitos Reichenauer Abt und war das von 823-838. Wohl auf Anraten seines Onkels
trat er in den Benediktinerorden ein und wurde mit 25 zum Priester geweiht. In Benken am Zürichsee bestand zu der Zeit ein kleines Kloster “babinchova” mit einer Schule, in das Meinrad 825 geschickt wurde. Er war dort als Lehrer
tätig. Meinrad sah seine Berufung aber als Eremit. Mit Erlaubnis seines Abtes baute er sich auf dem Etzelpass seine erste Klause. Der Etzelpass liegt im Kanton Schwyz und führt von
Pfäffikon nach Einsiedeln.Auf der Passhöhe steht heute noch die Meinradskapelle, die schon im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde und 1698 von Caspar Moosbrugger erbaut wurde.Über Caspar Moosbrugger später mehr.
Zurück zu Meinrad. Sieben Jahre lebte Meinrad am Etzelpass. Meinrad hatte sich im Volk einen guten Ruf geschaffen und viele kamen zu ihm, um seinen Rat zu suchen.
Da der Andrang immer größer wurde, zog er sich weiter in den Wald zurück. Auf einer kleinen Ebene errichtete er eine neue Klause, bei deren Bau er von einer Äbtissin namens Hadwiga unterstützt wurde. P. Rudof Henggeler, der Chronist von Kloster Einsiedeln,
vermutet in seiner Geschichte des Klosters Einsiedeln, dass es sich dabei um Kloster Schänis im Kanton St. Gallen handelte, relativ nahe gelegen und zwischen 806 und 823 gegründet. Es unterhielt regelmässige Beziehungen zum Kloster Säckingen.
Spätere Lebensbeschreibungen Meinrads machen aus Hadwiga die Äbtissin des Damenstifts in Säckingen.Auch von seiner neuen Bleibe breitete sich sein Ruf rasch aus. An seine neue Zelle kamen viele Besucher und brachten auch Geschenke mit,
die er immer an die Armen in seiner Gegend weitergab. Nachdem er rund 25 Jahre im Wald gelebt hatte, kamen auch zwei Besucher zu ihm, die angelockt durch die Nachrichten über ihn, wertvolle Dinge bei ihm vermuteten. Er bewirtete sie,
gab ihnen aber zu verstehen, dass er sie durchschaut hatte. Daraufhin erschlugen sie ihn. Der Überlieferung zufolge hatte Meinrad zwei Raben aufgezogen, die bei ihm lebten. Diese verfolgten die Mörder deren Namen und Herkunft genannt werden,nämlich
eine Alamanne namens Richard und ein Rhätier namens Peter,und verrieten sie durch ihr lautes Geschrei. Der Todestag ist der 21. Januar 863.
Graf Adalbert der Erlauchte (854-890), der als Graf im Thurgau bezeugt ist, verurteilte die Mörder zum Feuertod. Die “Meinradsraben” wurden später von den Fürstäbten ins Wappen des Kloster Einsiedeln aufgenommen. Der Reichenauer Abt Walter (858-864) ließ
Meinrads Leichnam auf die Reichenau überführen und dort bestatten. Die Verehrung Meinrads bürgerte sich auf der Reichenau rasch ein. Abt Berno (1008-1048) hatte 1039 die neue Klosterkirche in Einsiedeln geweiht und zu Ehren
des heiligen Meinrad eine Offizium gedichtet und komponiert. Auch die erste Vita wird wohl von einem Reichenauer Mönch zu Anfang des 10. Jahrhunderts, also ziemlich kurz nach dem Tode Meinhards verfasst.
Die “Vita sive passio venerabilis heremitae meginrati” findet sich als prächtige Handschrift aus dem 10.Jahrhundert im Kloster St.Gallen. 1019 überwies Kaiser Heinrich II. Reliquien ans Basler Münster, woraus man schließen kann,
dass er zu der Zeit schon als Heiliger verehrt wurde und er auch nicht 1039 bei der Translation seiner Gebeine nach Einsiedeln heiliggesprochen worden ist. Es ist nicht ganz sicher ob schon zu Meinrads Lebzeiten andere Eremiten in seiner Nähe lebten.
906 erhielt die Klause wieder einen Bewohner und zwar Benno, der bisher in Straßburg als Domherr gelebt hatte. Angezogen vom Ruf Meinrads Ruf erneuerte er die Zelle, die mittlerweile ziemlich baufällig geworden war und das Kirchlein wieder.
Er erweiterte das Wohngebäude, so dass es mehrere Klosterbrüder aufnehmen konnte. Nach dem Zeugnis von Abt Johann von St. Arnulf, ein Zeitgenosse Bennos,stammte dieser aus Schwaben. Der Einsiedler Kapitular Justus Landolt führt
in seinem 1845 herausgegebenen Buch “Ursprung und erste Gestaltung des Stiftes Maria-Einsiedeln nebst einem Anhange über die Engelweihe und die Wallfahrt” aus, dass es sich ergeben hätte, dass Benno dem burgundischen Königshause entstammte,
ein Sohn Konrads des Jüngern und ein Bruder von König Rudolf gewesen sei. Er sammelte immer mehr Männer um sich. Das hatte bald etwas von einer klösterlichen Gemeinschaft. Benno hatte sein ganzes Vermögen für die Meinradszelle aufgewendet.
Er erbat sich vom Stift Säckingen auch die Ufnau im Zürichsee. Kaiser Otto hat sie dann vom Kloster Säckingen eingetauscht und dem Kloster Einsiedeln geschenkt. Bis ins Jahr 927 lebte Benno in der Waldeinsamkeit. Dann berief ihn
König Heinrich I. als Bischof nach Metz. Nach dem Tod von Bischof Wigerich (917-927) hatte das Kapitel zwar einen Bischof gewählt, der aber von einem Teil des Kapitels nicht unterstützt wurde. Daraufhin setzte Heinrich Benno ein. Die Beziehungen der
Metzer Bürgerschaft zum verstorbenen Bischof scheinen angespannt gewesen zu sein. Und der König erhoffte sich, dass der gute Ruf des Einsiedlers die Bürger wieder befrieden würde. Nur ungern und nach vieler Überredung folgte Benno
dem königlichen Ruf. Das gemeine Volk konnte Benno für sich einnehmen, die Reichen und Mächtigen verschworen sich gegen ihn, zumal er sie in seinen Predigten hart anging. Sie liessen ihn überfallen und blenden. In Duisburg wurden die Urheber der Tat zum
Tode verurteilt. Benno gab sein Amt ab und kehrte nach Einsiedeln zurück. In Metz wurde Adalbero von Bar (929-962) zu seinem Nachfolger gewählt.Von den zurückgebliebenen Brüdern wurde Benno wieder als Vater und Führer begrüßt.
Er übernahm auch wieder das Vorsteheramt in der Einsiedelei.
Um 923 war an der Bischofskirche von Straßburg Eberhard Dekan. Von dem berühmten Mönch der Reichenau, Hermann der Lahme, erfahren wir erstmals über ihn. Das “liber Heremi” nennt Eberhard einen Verwandten Bennos und berichtet, dass er Domherr und
Dekan in Strassburg gewesen sei. Eberhard war vornehmer Herkunft, was auch daraus hervorgeht, dass er in den Urkunden Ottos des Großen mit dem Titel “illustris” genannt wird. Es ist anzunehmen, dass er zur Familie der Nellenburger gehört hat. Einiges spricht
dafür, so schon der Name Eberhard. Die Nellenburger werden oft wegen des Leitnamens Eberhard auch Eberhardinger genannt. Die Nellenburger sind später auch Vögte des Klosters Einsiedeln. Auch seine Beziehungen zum Hause Schwaben sowie zu Otto lassen
das durchaus als wahrscheinlich annehmen. Die Ankunft Eberhards in Einsiedeln wird in den Annalen übereinstimmend mit 934 angegeben. Er kam nicht allein “sondern mit einem ansehnlichen Gefolge”. Er brachte auch sein großes Vermögen in die Meinradszelle
mit, so dass der Grundstein zum neuen Kloster gelegt werden konnte.
Klostergründung
Die Zeit in der Eberhard seine Gemeinschaft um sich sammelte, ist eine Aufbruchszeit in den Klöstern Westeuropas. 909/910 war in Burgund das Kloster Cluny gegründet worden. Die von dort ausgehende Reformbewegung der Cluniazenser erfasste
viele Klöster. Im schwäbischen und alemannischen Raum wirkte die von Gorze ausgehende Reformbewegung zunächst noch stärker.Von Gorze aus war Lorsch reformiert worden und dieses Kloster verbreitete die Reformbewegung weiter. Auch auf
St. Maximin in Trier und St. Emmeran in Regensburg hatte Gorze großen Einfluss. Diese beiden Klöster wirkten wiederum auf das neu gegründete Einsiedeln, das unter Eberhards Nachfolgern zu einem blühenden Reformkloster wurde.
Am 3. Oktober 940 verstarb Benno. Er wurde vor der Gnadenkapelle bestattet. Eberhard hatte die Einsiedler, die sich um ihn und Benno gesammelt hatten, zu einer klösterlichen Gemeinschaft auf der Grundlage der Benediktinerregel vereinigt.
Nachhaltige Unterstützung erfuhr er durch den Herzog von Schwaben, Hermann I. (926-949), der ja möglicherweise mit ihm verwandt war. Der Herzog hatte den Grund, auf dem das Kloster erbaut war, erworben und dem Kloster geschenkt.
947 war das Kloster wohl fertiggestellt. Otto I.bestätigt die Schenkung Hermanns in der am 27.Oktober 947 in Frankfurt ausgestellten Urkunde. Otto ”verleiht auf bitte des herzogs Herimann dem auf dessen eigen und mit dessen unterstützung vom eremiten, nun
abt, Eberhard zu ehren der h. Maria und Mauricius erbauten kloster Einsiedeln (Mehinratescella) freie abtwahl immunität und königschutz”,
Zwei Dinge sind dabei bemerkenswert. Aus einem anfänglichen Eigenkloster des schwäbischen Herzogs ist nun ein Reichskloster geworden, das natürlich in die Reichspolitik des Herrschers einbezogen war. Die freie Abtswahl lag voll im Bestreben der
Klosterreform und das Immunitätsprivileg bedeutete eine weitere Stärkung der königlichen Macht, da sie die Gewalt der Herzöge herabminderte. Ganz auf dieser Linie ist auch die Bestätigung oder Verleihung der Immunität an andere Klöster,
im schwäbischen und alemannischen Raum 940 St. Gallen, 950 Pfäfers, 952 der Fraumünsterabtei in Zürich, 956 der Reichenau , Ottobeuren 971, 972 Rheinau und Amorbach in Bayern 996. Die Immunität bedeutete Freiheit von fremder richterlicher Gewalt. Diese lag
beim Abt und seinem Konvent. Abt Eberhard baute den Besitz des jungen Klosters zielstrebig aus. So kaufte er 947 die Weiler Bäch und Freienbach am Zürichsee. 947 findet auch die Weihe der Klosterkirche statt und in der Urkunde von Otto sind auch die Patrone
genannt, nämlich die heilige Maria und Mauritius. Auch erhielt Eberhard für seine neue Klosterkirche gleich bedeutende Reliquien, für ein Kloster immer wichtig, da sich neben der ideellen Stärkung immer auch wirtschaftliche Vorteile ergaben, wie bei
praktisch allen Klöstern, deren Geschichte in diesem Blog erzählt wird, nachverfolgt werden kann. Erinnert sei hier nur an Kloster Andechs, Steingaden, Weingarten, Weissenau oder Schussenried. All diese Klöster hatten viel besuchte Wallfahrten
und damit auch gute Einnahmequellen. Weissenau konnte zum Beispiel durch die Schenkung einer Heilig Blut Reliquie durch König Rudolf von Habsburg 1283 und die damit verbundene Wallfahrt seine angeschlagene wirtschaftliche Lage wieder
stabilisieren. Herzog Hermann von Schwaben ließ Einsiedeln über seinen Hofkaplan Hartpert, der auch Otto I. sehr nahestand, zwei Rippen der Züricher Heiligen Felix und Regula zu kommen, verknüpft allerdings mit der Bedingung,
dass diese Reliquien wieder an Zürich zurück zu geben seien, falls die noch junge Gründung wieder einginge. Der Augsburger Bischof, der heilige Ulrich, schenkte dem Kloster Reliquien der Augsburger Stadtheiligen Afra und des Mauritius. Dazu erhielt
Einsiedeln auch noch einen kostbaren Ornat, der in hohen Ehren gehalten wurde, der allerdings beim Brand von 1577 zerstört wurde. Der Schwabenherzog spielte in den Gründungsjahren des Klosters eine gewichtige Rolle. Er hatte ja schon die Bestätigung durch
Otto in die Wege geleitet. Hermanns einzige Tochter Ida wurde um die Jahreswende 947/948 mit Liudolf, dem Sohn von Otto I. vermählt. Als sein Schwiegervater Hermann 949 starb, übertrug Otto seinem Sohn das Herzogtum 950. Das Kloster hatte
also beste Beziehungen über das Herzogshaus Schwaben zum König. Von Hermann erhielt das Kloster 948 nachdem es ja schon den Klostergrund, auf dem es errichtet worden ist, geschenkt bekommen hatte, den herzoglichen Besitz in Gams. Auch von Otto erhielt das Kloster reiche Schenkungen. 948 schenkte er dem Kloster seinen Besitz in Grabs das ist im Rheintal im heutigen Kanton St. Gallen, die Kirche mit Zehnten sowie das Salland mit allem, was dem König in dem Hofe zusteht. 952 folgte der Ort Liel, heute ein Ortsteil von Schliengen
im Landkreis Lörrach. Diese Schenkungen waren eigentlich nur eine Umverteilung. Der König hatte diese Gebiete konfisziert, damit den lokalen Adel geschwächt und die Kirche gestärkt, die ja in seiner Machtpolitik eine gewichtige Rolle spielte.
948 fand die Weihe der Klosterkirche durch den Konstanzer Bischof Konrad I. (935-976) statt. Konrad war der Sohn des Klostergründers von Weingarten, dem Welfen Heinrichs “mit dem goldenen Wagen”. Konrad wurde 1123 heilig gesprochen. Der Kloster-und
Kirchenpatron Mauritius war auch Patron der Mauritiusrotunde neben dem Konstanzer Münster und im 10. Jahrhundert auch Reichsheiliger. Und Mauritius war der Heilige, zu dem Otto der Große eine besondere Beziehung hatte. Zur Kirchweihe war auch
der Augsburger Bischof Ulrich anwesend.Am Tag der Weihe, am 14.September 948 soll sich die”Engelweihe” ereignet haben. Als Konrad die Kirche weihen wollte, soll aus der Höhe eine Stimme erklungen sein und gerufen haben “Höre auf, höre auf Bruder,
die Kapelle ist göttlich eingeweiht”. (nach P.Justus Landolt). Natürlich verbreite sich die Kunde von diesem Geschehen rasch. In einer Urkunde von Papst Leo VIII. vom 10.11.964 erklärt der Papst, nachdem ihm Bischof Konrad von Konstanz in Anwesenheit von
Kaiser Otto I. und dessen Gemahlin Adelheid von dem wunderbaren Ereignis berichtet hatte, die Weihe als gültig. Auf Bitten des Kaiserpaars nimmt er das Kloster in seinen Schutz und gewährt dessen Besuchern einen Ablass.
Abt Eberhard wird in den Urkunden nur zweimal namentlich erwähnt, nämlich in der Bestätigungsurkunde von 947 von 949 bei der Schenkung von Gabs. In der Bestätigungsurkunde für Abt Gregor vom 25. Januar 965 wird er als verstorben erwähnt. (beatae memoriae vir illustris Eberhardis). Das Todesjahr ist übereinstimmend nach den verschiedenen Einsiedlern Annalen 958. Nachfolger Eberhards wird Thietland. Dieser kam 945 nach Einsiedeln. Er gilt einigen als Sohn von Herzog Burkhard. Dafür gibt es allerdings keinen Beleg.
Am 3. Februar 961 wird Thietland als Abt erwähnt. Otto verleiht dem Kloster wieder Immunität und freie Abtswahl nach Thietlands Tod . Sein Todestag wird mit dem 28. Mai angegeben. Sein Todesjahr ist in den Annalen nicht vermerkt. Da sein Nachfolger Gregor
erstmals am 23. Januar genannt wird, muss das Todesjahr zwischen 961 und 965 legen. Die Überlieferung gibt 964 an.
Während der Amtszeit Abt Eberhards lebte der Mönch Adalrich im Kloster. Der Überlieferung nach war er ein Sohn Burkards I., des Herzogs von Schwaben und seiner Gattin Reginlind von Schwaben. Historisch lässt sich die Angehörigkeit Adalrichs zu den
Burkhardingern nicht aufrecht erhalten, aber seine Existenz kann nicht angezweifelt werden. Erstmals berichtet der St. Galler Mönch 1072 in der Lebensbeschreibung der heiligen Wiborada (sieh Blog St. Gallen) über den Mönch St. Adalrich. Erste schriftliche
Äußerungen gibt es dann im 14. Jahrhundert wieder. Im Jahrzeitbuch der Kirche auf der Ufnau sind 4 Pergamentblätter enthalten, die aus dem Leben St. Adalrichs erzählen. Nach dem legendenhaften Bericht hatte er seine Mutter
Reginlind auf die Ufnau begleitet. Nach dem Tod ihre Gemahls hatte sie sich dorthin begeben, da se vom Aussatz befallen war. Ihr Erbe, die Höfe Stäfa, Wollikon und Pfäffikon vermachte sie Abt Werner, wie im Text steht, damit ihr Sohn Mönch in Einsiedeln werden
könne. Da lag beim Schreiber wohl eine Verwechslung Werners mit Eberhard vor. Allerdings hatte Reginlind laut dem Professbuch des Klosters Einsiedeln gar keine Söhne, weder aus ihrer ersten Ehe mit Burkhard- Burkhard II. gilt nicht als direkter Nachkomme
Burkhard I., noch aus ihrer zweiten mit Herzog Hermann. 1141 weihte Kardinal Dietwein die neue Kirche auf der Ufnau. Ob er dabei auch die Heiligsprechung Adalrichs vornahm, lässt sich nicht genau sagen. Adalrich wurde aber in Einsiedeln und auf der Ufnau als
Heiliger verehrt. Die Verehrung auf der Ufnau verliert sich erst seit dem 18. Jahrhundert. Abt Placidus Reimann (1629-1670) ließ 1659 das Grab des Heiligen öffnen, die Gebeine erheben und sie 4 Jahre später feierlich in einem steinernen Sarkophag beisetzen.
Einzelne Reliquien wurden in Einsiedeln zurückbehalten. Auch das sogenannte Adelrichsmeßgewand befindet sich dort.
Der Nachfolger Thietlands kommt nach den Annalen 949 nach Einsiedeln. Auch Hermann der Lahme gibt dieses Datum an.Gregor stammte aus England. Die Legende hatte später einen Königssohn aus ihm gemacht, der erst nach Rom pilgerte und dort in einem Traum
aufgefordert wurde, die verlassene Zelle des Meinrad aufzusuchen. Dort habe er Eberhard getroffen und zusammen mit ihm das Kloster gegründet. Urkundlich erwähnt wird Gregor erstmals am 23. Januar 965. Otto I. weilt auf der Reichenau und bestätigt dem
Kloster freie Abtwahl und Immunität. In der Urkunde nennt er den Abt ”«sanctissimus vir cunctis virtutibus pollens Gregorius». Mit gleichem Datum schenkt er “Abt Gregor und den Mönchen daselbst die Ufnau mit allen Zugehörden im Herzogtum Alemannien, in
der Grafschaft Zürichgau, nämlich Pfäffikon, Uerikon, der Kirche in Meilen und allen andern Zugehörden, was alles er um seinen Hof Schan in Adalberts Grafschaft Rätien samt Kirche und Zugehörden mit Walenstadt in der gleichen Grafschaft, Schiffahrt und Fahrgeld
von der Abtei Säckingen eingtauscht hat.” Bei Otto II., dem Sohn Ottos des Großen stand das Kloster ebenfalls in hoher Gunst. Noch zu Lebzeiten des Vaters bestätigte Otto II. am 14.8.972 in St. Gallen Einsiedeln die Immunität und alle Besitzungen. Erstmals werden
hier ausführlich die Besitzungen des Klosters aufgeführt. Deshalb ist diese Urkunde besonders wichtig. Nur drei Tage später, nämlich am 17.8.972 gewährt Otto die Befreiung von Zoll und Münzabgabe in Zürich.Während der Amtszeit Abt Gregors trat Wolfgang ins
Kloster Einsiedeln ein. Wolfgang war um 924 als Sohn einer schwäbischen nicht adeligen Familie wahrscheinlich in Pfullendorf geboren. Schon mit 7 kam er auf die Klosterinsel Reichenau. Mit ihm war Heinrich von Babenberg in der Reichenauer Klosterschule,
Sohn Heinrichs aus der mächtigen Grafenfamilie der Babenberger im östlichen Franken. Wolfgang war sehr begabt, was den Neid seiner Reichenauer Mitschüler erweckte. Als Heinrichs Bruder Poppo 940 Bischof von Würzburg wurde, berief er Stefan von Novarra an
951 die um 790 gegründete Domschule. Stephan war ein berühmter Grammatiklehrer aus der Lombardei. Poppo hatte bei der Berufung des Lehrers wohl auch den Hintergedanken, seinem Bruder Heinrich einen ausgezeichneten Lehrer zu verschaffen. Heinrich ging
an die Domschule nach Würzburg und brachte auch Wolfgang dazu, die Reichenau zu verlassen. In Würzburg eckte er allerdings mit seinem Lehrer über die Auslegung einer Stelle aus dem Werk des spätantiken Dichters Martianus Capella über die freien Künste so
an, dass Stephan ihn aus dem Unterricht ausschloss. Schon 956 wurde Wolfgangs Freund Heinrich auf den erzbischöflichen Stuhl von Trier erhoben. Dies verdankte er wohl seinen ausgezeichneten verwandtschaftlichen Beziehung. Er war ein
Enkel einer Schwester von Kaiser Heinrich I. und ein Cousin Otto I., dessen treuer Gefolgsmann er zeitlebens war. Wolfgang folgte Heinrich nach Trier und wurde dort Leiter der Domschule und war wohl von ihm auch als Nachfolger im Bischofsamt vorgesehen.
Heinrich starb auf einem Italienzug Ottos 964 an der Pest. Obwohl ihm der Kölner Erzbischof Brun, der Bruder Otto I., einen Bischofstuhl in Aussicht stellte, wollte sich Wolfgang ganz von der Welt zurück ziehen. Wolfgang trat ins Kloster Einsiedeln ein, das wegen
seiner Strenge bekannt war. Nachdem er in Einsiedeln sein Noviziat abgelegt hatte, wurde er von Abt Gregor als Lehrer eingesetzt. Bald nach seinem Noviziat wurde er von Bischof Ulrich aus Augsburg 968 zum Priester geweiht.
970 unternahm er eine Missionsreise nach Pannonien. 971 wurde er allerdings von Bischof Pilgrim nach Passau zitiert, weil er sich ohne Erlaubnis des Bischofs in dem von Pilgrim beanspruchten Missionsgebiet aufhielt. 972 war er wieder auf Missionsreise
in Ungarn unterwegs, diesmal mit Erlaubnis des Bischofs. Aber er wurde bald wieder zurückgerufen. Denn er sollte Bischof in Regensburg werden. Weihnachten 972 erfolgte die Investitur durch den Kaiser. 973 wurde er im Beisein von Bischof Pilgrim von
Erzbischof Friedrich von Salzburg zum Bischof von Regensburg geweiht. In Regensburg gründete er 975 die Domschule aus der die Regensburger Domspatzen hervorgingen. Der Abtretung böhmischer Gebiete, die die Gründung des Bistums Prag ermöglichte,stimmte
er zu. An das Stift St. Emmeran in Regensburg berief er Ramword aus St. Maximin in Trier, das er ja aus seiner Trierer Zeit kannte. Trier war 934 von Gorze aus reformiert worden. Von Regensburg aus wurde dann St. Peter in Salzburg, Tegernsee, Feuchtwangen,
Benediktbeuren und St. Afra in Augsburg reformiert. Da Wolfgang aber Mönche aus Trier und nicht Einsiedeln berief, bewirkte das, dass der Einfluss von Trier-Gorze überwog. Er war der erste, der das Amt des Bischofs von Regensburg und des im 8. Jahrhundert in
Regensburg entstandenen Benediktinerkloster trennte. Das sorgte zwar für Spannungen zwischen den späteren Regensburger Bischöfe, gab dem Kloster aber einen großen Entwicklungsschub in geistlicher und kultureller Aktivität.
Wolfgang begleitet Otto II.. Als nach Ottos Tod Streitigkeiten um die Nachfolge entstanden waren, Theophanu, die Gattin Ottos für ihren dreijährigen Sohn Otto die Herrschaft übernahm, stellte sich Wolfgang auf die Seite des Bayernherzogs Heinrich II, der Zänker.
Er wurde auch Erzieher seiner Kinder Heinrich, des späteren Kaiser Heinrichs II. 994 reiste er nach Pöchlarn, das zur Diözese Regensburg gehörte. Auf dem Weg dahin starb er am 31.Oktober in Pupping in Oberösterreich. Am 7.Oktober 1052 wurde er von Papst Leo IX.
heilig gesprochen.
Abt Gregor hatte, wie wir oben gesehen haben, beste Beziehungen zu den sächsischen Kaisern.Es ist nicht sicher, ob er dies seiner vornehmen Herkunft zu verdanken hat, von der mehrere Quellen berichten.
Gregor war mehrmals persönlich am Königshof, so 984 in Ingelheim, 992 in Frankfurt und 996 in Bruchsal. Dabei wurde ihm von Otto III. auf Intervention von Kaiserin Theophanu und Herzog Konrad von Schwaben, die von ihm vorgelegten Urkunden Kaiser Otto I.
über den Besitzstand der Abtei sowie die Befreiung von Zoll und Münzabgaben in der Stadt Zürich bestätigt. Am 24. Januar 992 bestätigt Otto auf Bitte seiner Großmutter Adelheid und auf Intervention seiner getreuen Herzöge Konrad und Heinrich, sowie auf
Intervention und Bitte des Abtes Gregor, der ihm die Urkunden der beiden ersten Ottonen vorweist, dem Kloster Einsiedeln die von diesen Herrschern geschenkten Güter und Rechte in Rätien, in Grabs und bei Sargans mit der Kirche in Wangs bei Mels, im Kanton St.
Gallen. ‒ (RI II,3 n.1049). 994 war Otto III. volljährig geworden.Am 9. Dezember 995 erteilte Otto III. einem Gütertausch zwischen Abt Gregor und dem Wormser Bischof Hildibald (978-998) die Genehmigung. Es ging dabei um ein bischöfliches Gut zwischen Freiburg
und Breisach, das Gut Schelbingen in der Grafschaft Birthilos und das Gut Gronau an der Nidda, das Kloster Einsiedeln gehörte. Hildibald war seit 979 deutscher Kanzler und Vertrauter der beiden Kaiserinnen Adelheid und Theophanu.
Am 31.10 996 erneuerte Otto die Privilegien nun als Volljähriger, die er schon 984 in Ingelheim bestätigt hatte (RI II,3 n. 1211). Auch zu den schwäbischen Herzögen stand Gregor in gutem Einvernehmen. Herzog Hermann II. von Schwaben hatte 992 seinen Sohn
Bertold zur Taufe nach Einsiedeln gebracht und Gregor war Taufpate. Bertold starb allerdings schon 993 und ist in Marchtal begraben. In der Amtszeit Gregors vermehrte sich der Besitzstand Einsiedelns erheblich. Aber auch um die Klosterzucht war er sehr bemüht.
Die neuere Forschung nimmt an, dass Gregor die Gebräuche der englischen Klöster, die zu der Zeit schon enge Beziehungen zu Cluny hatten, in Einsiedeln einführte. Die Zahl der Mönche war mittlerweile so groß geworden, dass 987 eine Vergrößerung der Kirche notwendig war.
Auf eine größere Mönchszahl lässt auch schließen, das eine Neugründung möglich war. 979 war Gebhard in Konstanz Bischof geworden. 983 stiftete er das Kloster Petershausen in Konstanz und stattete es mit seinen Erbgütern aus (siehe dazu Beitrag Kloster
Petershausen). Zur Besiedelung wurden Mönche aus Einsiedeln gerufen.Gebhard hatte einen gewissen Rupert nach Einsiedeln gesandt, damit dieser dort ins Ordensleben eingeführt würde. Dass das Kloster im Ruf höchster Frömmigkeit stand, haben wir schon in
der vita des Heiligen Wolfgangs gehört und der Vermerk “quoniam monachi illius coenobii tunc temporis fuerunt religiosissimi” wie die Chronik des Klosters Petershausen auf Seite 631 vermerkt, geht in diesselbe Richtung. In der gleichen Quelle wird Pezilin als erster Abt von
Petershausen genannt. In der Vita Gebhardi wird er Periger genannt.
Gregor starb am 8.November 996. Bei seinen Zeitgenossen stand er in hohem Ansehen. Gregor wurde von Anfang an als Heiliger verehrt. Zu Gregors Nachfolger wurde Wirunt (996-1026 )am 27. Dezember 996 gewählt. Die Chronisten des 15. Jahrhundert sehen in
ihm einen Grafen von Wandelburg. Allerdings gibt es dafür keinen schlüssigen Beweis. Nur auf seinem Epitaph ist eine allgemeine Bemerkung, die auf eine vornehme Herkunft schließen lässt. Auch Wirunt unterhält gute Beziehungen zum Herrscherhaus.
Am 28. April 998 schenkt Otto dem Kloster zu seinem Seelenheil und dem seiner Eltern 4 Hufen in Billizhausen, ein Weiler beim heutigen Betzgenried nahe Göppingen, ohne dass Abt Wirunt namentlich genannt wird (RI II,3 n. 1273). Graf Eberhard von Nellenburg
tauschte diese im selben Jahr gegen Güter in Volketswil im Kanton Zürich und Stetten an der Reuss im Kanton Aargau
Als Heinrich II. 1004 in Zürich weilte, suchte ihn Abt persönlich auf. Heinrich bestätigt dem Kloster Einsiedeln auf Bitten des Abtes Wirund den einem Guntram wegen Treubruch entzogenen Hof Riegel (nordwestl. v. Freiburg i. Br.) im Herzogtum Schwaben in der
Grafschaft Breisgau mit allem Zubehör und mit den Orten Endingen, Wendlingen, Kenzingen, Theningen, Burkheim und Bahlingen (alle Kr. Freiburg i. Br.) zu freiem Verfügungsrecht zum Nutzen des Klosters RI II,4 n. 1572. Am 5. Januar 1018
bestätigte Heinrich dem Kloster die Besitzungen und die Immunität.RI II,4 n. 1917. Am 2. September des Jahres 1018 war Kaiser Heinrich wieder in Zürich. auch dieses Mal suchte ihn Abt Wirunt dort auf. Heinrich schenkt dem Kloster Einsiedeln auf Bitten des Abtes
Wirunt den um die Abtei gelegenen unwegsamen und unkultivierten Wald mit allen Nutzungsrechten innerhalb angeführter Grenzen RI II,4 n. 1936. Dieses Gebiet umfasste das Sihl-und Alpthal. Allerdings hatten die Schwyzer in diesem Gebiet
nördlich der Wasserscheide der Mythen schon vor 1100 den Landesausbau voran getrieben. Daraus entwickelte sich der Marchenstreit 100 Jahre später, auf den noch einzugehen ist.
Heinrich II. starb am 13. Juli 1024 in Grone. Ihm folgte mit Konrad II. der erste Salier nach, der 1027 zum Kaiser gekrönt wurde. Das gute Verhältnis zum Herrscherhaus blieb auch unter dem Nachfolger erhalten. Konrad schenkt dem Kloster Einsiedeln unter Abt Wirunt
auf Intervention der Königin Gisela und des Erzbischofs Aribo von Mainz zwölf Hufen zu Steinbrunn im Sundgau in der Grafschaft Ottos samt allem Zubehör zu freiem Eigen. Die Schenkungsurkunde wurde am 25. Juli 1025 in Speyer ausgestellt. RI III,1 n. 43
Während der Amtszeit von Abt Wirunt stellte Kloster Einsiedeln immer wieder Äbte anderer Klöster aber auch Bischöfe. 995 wurde Otker Abt in Disentis. Er soll ein Bruder Wirunts gewesen sein. Um 1000 gibt es auch eine Schenkungsurkunde dieses Abtes von
zwei Prädien in Lenzikon an das Kloster Einsiedeln. Er regierte von 995-1012. Auch der Nachfolger Otkers kam aus Einsiedeln, nämlich Adalgott I., der als Seliger verehrt wird. Dieser regierte von 1012-1031. 1020 schenkte Heinrich II. dem Bischof
Heriward von Brixen und dessen bischöflicher Kirche die Abtei Disentis mit allem Zubehör zu freiem Verfügungsrecht der Kirche. Die Abtei verlor damit unter dem zweiten aus Einsiedeln stammenden Abt ihre Selbstständigkeit. Das hängt wohl mit der Lage der
Abtei am Lukmanierpass zusammen die wegen der kaiserlichen Interessen in Italien bedeutsam wurde. Auch für das Kloster Pfäfers, das 731 aus der Reichenau heraus gegründet worden ist, werden Äbte aus Einsiedeln angeführt und zwar Gebene , Eberhard und
Hartmann. Allerdings kollidiert die Einsiedler Überlieferung mit der Pfäferser Klosterüberlieferung.
Hartmann war erst Mönch in Einsiedeln, dann als Abt nach Pfäfers postuliert und war schließlich ab 1026 Bischof von Chur und als solcher mehrmals für Kaiser Konrad II. tätig. Er schenkte dem Kloster Einsiedeln um 1026 seine Prädien in Wagen und Eschenbach.
In Sankt Blasien wurde Bernhard als Probst eingesetzt. Das wird gestützt durch die Tatsache, dass bis St. Blasien die Gewohnheiten der Abtei Fruttuaria übernahm, die von Einsiedeln Geltung hatten. Auf dem Hohentwiel bestand ein kleines Kloster, das
Heinrich II. um 1005 nach Stein am Rhein übertrug. Da ein aus Einsiedeln stammender Abt Florat noch Abt “von Twyel” genannt wird, müsste er in der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts gelebt haben.
1026 –1034 war Wartmann Bischof von Konstanz. Er stammte aus der Familie Grafen von Kyburg- Dillingen. Hermann der Lahme erwähnt in seinem Chronicon, dass dieser Mönch in Einsiedeln gewesen ist.
Auch das Bistum Como hatte einen Einsiedler Mönch auf dem Bischofsstuhl, nämlich Eberhard, der 1004 von Heinrich II. zum Bischof berufen wurde. (1004-1006)
Abt Wirunt verstarb nach 30-jähriger Amtszeit am 11. Februar 1026. Zu seinem Nachfolger wird Embrich am 26. Februar 1026 gewählt. Bonstetten, von dem die erste gedruckte Geschichte des Klosters Einsiedeln (1494) stammt, macht aus ihm einen Freiherren von
Abensberg. Das ist allerdings nicht belegt, genauso wenig wie die Tatsache, dass er Kanoniker in Freising war, ehe er ins Kloster Einsiedeln eintrat. Ganz so abwegig ist dies aber gar nicht. Als Ahnherr der Abensberger gilt Graf Babo, der 32 Söhne gehabt haben soll.
Als Burggraf von Regensburg hatte dieser auch Beziehungen zu Wolfgang, der damals Bischof von Regenburg war und ja seine kirchliche Karriere als Mönch in Einsiedeln begonnen hat. Und Babo war auch Vogt in Freising.
Es gibt also durchaus Berührungspunkte. In Embrichs Amtszeit fallen zwei wichtige Ereignisse. Das eine ist die Klostergründung von Muri, das andere der Klosterbrand von Einsiedeln im Jahre 1029.
Am 19. August 1027 bestätigte Konrad in Zürich dem Kloster Einsiedeln seine Besitzungen, die namentlich aufgeführt waren samt allem Zubehör und die Immunität.RI III,1 n. 112. Auch sein Nachfolger Heinrich III. tat dies und zwar am 04.02.1040 auf der
Reichenau. König Heinrich III. bestätigt dem Kloster Einsiedeln seine Besitzungen, unter andern im Zürichgau: Uerikon, Meilen, Oetwil, Stäfa, Lindau, Rüti, Männedorf, Esslingen, Adlikon, Turbenthal, Rickenbach, Hittnau.
Auch unter Abt Emrich wurden weiterhin Mönche aus Einsiedeln zu Äbten anderer Klöster berufen oder besetzten Bischofstühle.Warmann von Dillingen,der aus der Familie der Grafen von Kyburg-Dillingen stammte, wurde 1026 Bischof von Konstanz und
war das bis 1034. Dass Hartmann von Einsiedeln nach Pfäfers als Abt postuliert wurde und auch 1026 Bischof von Chur, ist oben schon gesagt worden. Zu Embrichs Zeit lebte auch ein Mönch im Kloster, Ethicho. Er war wie Embrich zunächst Weltkleriker und ein Verwandter des Ebersberger
Grafen Adalbero, der das von Eberhard gegründete Chorherrenstift in ein Benediktinerstift umwandelte. 1045 wurde Ethicho gegen den Willen der Mönche, die bereits Gerwich gewählt hatten, als Abt in Ebersberg eingesetzt. Er regierte dort anderthalb Jahre.
Wichtigstes Ereignis in der Amtszeit aber war die Gründung von Muri.
1027 gründete Graf Radbot von der Habsburg (um 985 bis etwa 1045) und seine Gemahlin Ita von Lothringen das Kloster Muri im Kanton Aargau.
5 Jahre später wurden Mönche aus Einsiedeln gesandt, die die Abtei aufbauen sollten. Abt Embrich hatte den aus Solothurn stammenden Mönch Reginbold damit betraut. Noch andere Mitbrüder folgten. Sie erhielten
Bücher und Kirchengeräte, sowie Kleider und Hausgeräte aus Einsiedeln. Bischof Warmann aus Konstanz übertrug der jungen Abtei die bereits bestehende Kirche und deren Einkünfte. Reginbold ließ die Kirche abtragen und erbaute
für das Volk eine neue, die er St. Goar weihte. Dann ließ er das eigentliche Kloster und eine Kapelle, die Michael geweiht war, erbauen. Auch eine Schule und ein Scriptorium wurde errichtet. Vor Vollendung des Klosters aber verstarb Reginbold.
Er wurde in der Klosterkirche bestattet. Werner (1025-1096), Radbots Sohn, bat den Einsiedler Abt, auch hier gab es mittlerweile einen Nachfolger, nämlich Hermann, um einen Nachfolger für die Hausstiftung. Abt Hermann entsandte
Burkhard der aus Gossau stammte und schon von klein auf im Kloster war. Er vollendet den Kirchen-und Klosterbau. Damit Einsiedeln keine Ansprüche auf die junge Abtei erheben konnte, ließ Werner Burkhard zum Abt wählen. Dieses Amt hatte er noch
sieben Jahre inne. Er starb im Jahre 1073. Werner verzichtete 1082 auf die Herrschaft über das Kloster Muri. Er ließ Mönche aus St. Blasien kommen und die Einsiedler Bräuche abschaffen. Muri wurde in eine Schutzvogtei umgewandelt.
Nicht nur vom Wachsen des Klosters ist aus Embrichs Amtszeit zu berichten. In seiner Regierungszeit brannte das Kloster zum ersten Mal. Nach dem Liber Heremi hatte ein gewisser Eppo das Kloster in Brand gesteckt. Er stammte aus der Familie
der Nellenburger, war ein Sohn Mangolds und hatte wohl aus Rache den Brand gelegt, weil ihm die Vogtei über das Gotteshaus entzogen worden war, die sein Vater innegehabt hatte. Zur Sühne stiftet er später Stetten bei Bremgarten.
Abt Embrich baute wohl zuerst die Wohnräume wieder auf.1031 legte er den Grundstein zur neuen Kirche, die 1039 geweiht wurde. Acht Tage vor der Weihe waren Reliquien von der Reichenau nach Einsiedeln gebracht worden.
Embrich verstarb am 8. Februar 1051. Ihm folgte am 15. Februar 1051 Hermann I. als Abt. Er stammte aus der Familie der Udalrichinger, einem fränkisch-alemannisches Adelsgeschlecht, das in Bregenz und Winterthur ansässig war. Hermanns Vater
war Werner von Winterthur. Er starb zusammen mit seinem Sohn Liutfried 1040 als Bannerträger Heinrichs III. auf einem Feldzug gegen Bretislav von Böhmen bei Neumark. Auch Hermanns andere Brüder nämlich Adalbert II. von Winterthur
und Werner der II. fielen in einer Schlacht und zwar in der Normannenschlacht von Civitate am 18. Juni 1053, bei der das Herr von Papst Leo IX. vernichtend geschlagen wurde. Und damit wären wir bei der Mutter des Abtes. Werner war mit
Irmgard von Nellenburg verheiratet, einer Schwester des Grafen Eppo von Nellenburg. Dieser war mit Hedwig von Egisheim verheiratet und Hedwig war eine Nichte von Papst Leo. Die Verwandtschaft des Abtes mit dem Papst wird auch im Liber heremi
erwähnt und die gleiche Quelle sagt, dass der Papst deshalb dem Abt 1055 das Recht der Pontifikalien verlieh. Graf Eppo und Hedwig stifteten 1049 das Kloster Allerheiligen in Schaffhausen. Es ist nicht sicher aber ziemlich wahrscheinlich, dass Mönche aus
Einsiedeln die Gründung besiedelten. Sicher ist aber, dass Hermann bei der Klosterkirche am 3. November 1064 in Schaffhausen dabei war. Die Weihe nahm Bischof Rumold von Konstanz (1051-1069), der nach Bonstetten auch Mönch in Einsiedeln war, was
allerdings ziemlich unsicher ist.
Am 23. 2. 1064 verlieh König Heinrich IV. den Dienstleuten der Abtei das Recht der Dienstleute der Abtei St. Gallen. Dienstleute oder Ministeriale waren Königsfreie, die sich der Reichskirche zur Verfügung stellten um so dem vom König
geforderten Kriegsdienst zu entkommen. Da sie aber nun der Kirche zu Dienst verpflichtet waren, mussten sie dennoch in den Krieg ziehen, wenn wie z. B. bei Italienzug Ottos II. die Abteien Reichenau und St. Gallen dem Kaiser
Panzerreiter zur Verfügung stellten. Da die Äbte diese Ministerialen für ihr Reiterei ausbilden ließen, lässt die Verleihung des Rechts von St. Gallen an die Dienstleute von Einsiedeln dass es zu mindestens von diesem Zeitpunkt an
auch Pferdezucht und einen Marstall im Kloster Einsiedeln gab. Am 8. April 1065 starb Abt Hermann. Ihm folgte Heinrich I. Dieser Abt ist allerdings in den Urkunden nicht belegt. Überliefert ist in den Annales Einsidlens und im Liber Heremi
lediglich das Jahr seiner Wahl sowie sein Todesjahr 1070. Nach dem badischen Geschlechterbuch gehörte er zur Familie Lupfen-Stühlingen. An diesen Abt wandte sich 1065 Graf Adalbert von Calw. Dieser war ein Neffe von Papst Leo.
Adalberts Vorfahren hatten um 830 das Kloster Hirsau gestiftet. Das Kloster war allerdings stark heruntergekommen, weswegen ihn Leo bat, sich um das Kloster zu kümmern. Da, wie wir gesehen haben, der Papst ja verwandtschaftliche Beziehungen zum Kloster
Einsiedeln hatte, ist es durchaus denkbar, dass Leo Graf Adalbert an Einsiedeln verwies.
Abt Heinrich schickte den Mönch Friedrich zusammen mit 12 Brüdern nach Hirsau. Friedrich stammte aus schwäbischem Adel. Friedrich führte ein vorbildliches Leben und zeichnete sich durch seine Frömmigkeit aus. Gerade das aber
machte ihn zur Zielscheibe von Neid und Missgunst. Ihm wurde ein sittliches Vergehen angedichtet, worauf ihn die Grafen von Calw seines Amtes enthoben. Sie beriefen dafür den Mönch Wilhelm aus dem Kloster St.
Emmeran in Regensburg. Bei allen verfingen die Verleumdungen nicht. Abt Ulrich von Lorsch (1056-1075) wies ihm das Michaelskloster auf dem Heidelberger Heiligenberg zu. Dort lebte Friedrich bis zu seinem Tode 1071. Wilhelm ließ sich in Hirsau erst nach
Friedrichs Tod zum Abt weihen. Friedrich wir als Seliger verehrt und sein Gedenktag wird auch heute noch im Stift Einsiedeln am 8. Mai begangen.
Unter den nach Hirsau entsandten Mönchen war auch Noker.Vor seinem Eintritt in Einsiedeln war er Weltpriester. In Hirsau schrieb er um 1070 ein “Memento Mori” die wohl erste frühhochdeutsche Bußpredigt im Paarreim. 1090 schickte ihn Abt Wilhelm nach
Zwiefalten das 1089 von den Grafen Kuno und Liutold von Achalm gestiftete Kloster (siehe Blog Zwiefalten). In Zwiefalten betrieb er den Aufbau seines jungen Klosters und erreichte, dass der apostolische Stuhl das Kloster in seinen Schutz nahm.
Vor 1070 war Seliger von Wolhusen ins Kloster eingetreten. Die Freiherren von Wolhusen besaßen zu dieser Zeit fast ein Drittel des Kanton Luzerns, auch die Hoch-und Blutgerichtsbarkeit hatten sie inne. Sie waren wohl burgundischer Abstammung
auch der ungewöhnliche Namen Seliger deutet darauf hin. 1070 tätigte er eine große Stiftung für das Kloster. Nach Bonstetten war er ins Kloster eingetreten, weil drei seiner Kinder ertrunken waren. Auch seine Frau Hedwig tat es ihm gleich.
1080 ist eine Hedwig von Wolhusen Äbtissin der Fraumünsterabtei. 1070 wurde Seliger Abt. 1073 schickte er Mönche zu Kaiser Heinrich, der gerade in Augsburg weilte. Am 24. Mai 1073 bestätigte Heinrich IV. die Freiheiten Einsiedelns von jeglicher
königlicher Einmischung und die freie Abtswahl.RI III,2,3 n. 633. Wichtig ist diese Urkunde auch, weil sich hier zum ersten Mal der deutsche Name Einsiedeln findet. (Quod (scil. Monasterium) solitarium vocatur, teu-tonice Einsiedelen).
1090 ging Kloster Einsiedeln mit St. Blasien eine Gebetsverbrüderung ein, ähnlich der, die schon vorher mit St. Gallen eingegangen wurde. Im St. Gallener Liber confraternitalum wird Einsiedeln erwähnt. Die Verbrüderung mit St. Blasien wurde später
erneuert und als die Mönche aus St. Blasien im Zuge der Säkularisation nach St. Paul im Lavanttal gingen, wurde die Verbrüderung wohl beibehalten, denn mit St. Paul besteht sie heute noch. Abt Seliger war schwer krank, was dazu führte, dass er 1090 resignierte.
Er bestimmte Rudolf zu seinem Nachfolger. Dieser war bis dahin Novizenmeister und Kämmerer des Klosters. Rudolf war von 1090 bis 1101 Abt. In seiner Amtszeit war Noker in Zwiefalten Abt geworden und nach Bonstetten gab es auch in Kempten
einen Abt, der aus Einsiedeln stammte, nämlich Eberhard.
Mit dem Tode von Papst Gregor VII. 1073-1085) hatte der Investiturstreit an Schärfe verloren. Dem Kloster Einsiedeln war es gelungen, sich weitgehend aus dem Streit heraus zu halten, anders als z. B. St. Gallen und Reichenau (siehe jeweils dort)
wo es sogar zu Feldzügen der Klöster untereinander gekommen war. St. Gallen, Fulda oder die Reichenau hatten berühmte Klosterschulen, Scriptorien, die für ihre Buchmalereien bekannt waren. Das war in Einsiedeln nicht in dem Maße der Fall,
aber wie gezeigt wurde, hatte Einsiedeln enormen Einfluss über Mönche, die an vielen Klöstern Abtsstühle einnahmen oder Bischöfe wurden.
Auf Rudolf folgte Gero(1101-1022). Nach Bonstetten stammte er aus dem Geschlecht derer von Altbüron, das schon Mitte des 12. Jahrhunderts ausgestorben war nach dem Liber Heremi war er ein Bruder des Grafen Ludwig von Froburg.
Am 2.10.1111 bestätigt der letzte Salier, Kaiser Heinrich V., dem Kloster Einsiedeln das Privileg seines Vaters vom 24. Mai 1073, das aus Freiheit von jeder königlichen Einmischung für seinen Besitz, es sei denn gegen räuberische Minderung, und aus dem Recht der
freien Abtwahl besteht.
Wie oben ausgeführt hatte das Kloster 1018 von Kaiser Heinrich II.größere Gebiete geschenkt bekommen. Dieses Geschenk entwickelte sich allerdings allmählich zum Danaergeschenk für das Kloster. Das Kloster hatte bereits eine intensive Rodungstätigkeit
entwickelt. Aber auch die Schwyzer hatten ihren Landesausbau vorangetrieben. Im Quellgebiet von Sihl, Alp und Biber wurde im 11. Jahrhundert vermehrt Großviehhaltung betrieben. Dazu war aber mehr Weideland und Alpen erforderlich und dies war auf
Klostergebiet reichlich vorhanden. Der Konflikt war somit vorprogrammiert. Bäuerliche Rodungen aber auch Mönchsentführungen sorgten für Zündstoff. Abt Gero und sein Vogt Ulrich von Rapperswil klagte in Basel vor Kaiser Henrich V. Am 10.3.1114 erhielt das
Kloster Recht. Die Grafen Ulrich und Arnolf von Lenzburg sowie die Dorfleute von Schwyz wurden durch Spruch der Fürsten nach alemannischen Recht verurteilt. Sie mussten das Weggenommene zurückgeben und dem Kaiser 100 Pfund Busse erlegen.
Der Kaiser bestätigte die Immunität des Klosters, verlieh ihm den Boden der Zelle mit dem gesamten umliegenden Wald und die gesamte umliegende Mark.
Das war aber erst der Anfang einer fast 250 Jahre dauernden Auseinandersetzung, die erst nach dem Friedensschluss nach der Schlacht am Morgarten ihr Ende fand.
Abt Gero war auch als Bauherr tätig. Er ließ die Brücke über die Sihl bauen, die auch Teufelsbrücke geheißen wird. Gleich bei der Brücke in Egg wurde Paracelsus wohl 1493 geboren. Außerdem ließ er die Kapelle der beiden
heiligen Johannes erbauen. Bischof Ulrich I. (1111-1127) weihte sie.
Mit dem Kloster Gengenbach im Kinzigtal ging Abt Gero eine geistliche Verbrüderung ein. Weniger harmonisch verliefen die Beziehungen zu Alpirsbach. Aus nicht mehr bekannten Gründen sollen sich Mönche aus Alpirsbach
in Einsiedeln aufgehalten haben. Bei ihrem Weggang sollen sie das Haupt des Heiligen Justus mitgenommen haben. Erst 1143 kam es nach Einsiedeln zurück. Gero starb im Jahr 1122.
Auf ihn folgte Werner von Lenzburg. Über seine Herkunft gibt es verschiedene Meinungen. Das Liber Heremi bezeichnet ihn als Sohn des Arnulf von Altbüron und der Chuonza, bemerkt aber, dass andere ihn als Sohn
des Grafen Arnold von Lenzburg und der Chuonza von Altbüron sehen. 1130 schenkte Lütold von Regensberg, der zur Familie der Freiherren von Regensberg gehörte, einem Schweizer Adelsgeschlecht im Zürichgau, das wahrscheinlich von den burgundischen Grafen
von Mömpelgard-Mâcon abstammte, zusammen mit seiner Gattin Judenta und seinem Sohn Lütold ihren Besitz in Fahr an das Kloster Einsiedeln, verbunden mit der Auflage, dass das Kloster dort ein Frauenkloster errichten und unterhalten
müsse. Am 15. Juli 1133 bestätigte Kaiser Lothar dem Kloster der hl. Maria und Mauritius zu Einsiedeln den von Ludolf von Regensberg, dessen Gemahlin Judenta und Sohn Ludolf zur Gründung eines Frauenklosters nach dem Ordo von Muri und Berau (in modum
sanctimonialium in Murensi vel Peraugiensi [coenobio ]) nebst Kapelle übertragenen Ort Fahr, die Regelung der Vogteiverhältnisse, wonach der jeweils Älteste aus der Stifterfamilie, der zugleich Besitzer (possessor) der Burg Regensberg ist, Vogt sein soll, und
bekräftigt die von Ludolf dessen familia erteilte Erlaubnis, daß sie der Kirche in Fahr Schenkungen aus Eigenbesitz zuwenden darf. – RI IV,1,1 n. 490 . Am selben Tag lässt sich der Abt in Königslutter die Verleihungen Ottos I. und seines Sohnes an die Kirche von
Einsiedeln bestätigen. Auch lässt sich der Abt die Kompetenzen des Vogtes genau umschreiben. War das weise Voraussicht oder gaben bereits bestehende Spannungen Anlass zu solchen Vorkehrungen? Der Kaiser setzte fest, dass der Vogt über das Gesinde
des Abtes in dessen Hoheitsgebiet nur soviel Gewalt hatte, wie der Abt zu ließ. Untervögte und Verwalter durfte der Vogt nicht anstellen. Bei Zuwiderhandlung hatte er 100 Pfund Gold zu zahlen, wovon die Hälfte an die kaiserliche Kammer, die andere Hälfte an das
Kloster gehen sollte. Außerhalb des Hoheitsgebietes hatte der Vogt den Klerus nicht zu behelligen.Am Anfang lag die Vogtei bei den Herzögen von Schwaben. Im 10. Jahrhundert ging sie an die Nellenburger über. Abt Embrich entzog Ebbo von Nellenburg die
Vogtei, worauf wie oben berichtet dieser das Kloster anzündete. 1114 lag die Vogtei bei den Herren von Rapperswil.
Auf Lothar III., der 1137 bei Breitenwang starb, folgte Konrad III. (1138-1152). “Konrad erneuert und bestätigt ([renovamus et inn]ovando confirmamus) Abt Werner und den Mönchen des Klosters Einsiedeln (monasterio sanctę dei genitricis et virginis Mariae et sancti
Meginradi, Mavricii quoque sociorumque eius, quod Solitarium vocatur theutonice Einsidellon) auf deren Bitten und mit Zustimmung der anwesenden Reichsfürsten (astipulatione … regni principum), nämlich des päpstlichen Legaten und Erzbischofs Albero von Trier,
Erzbischofs (Humbert) von Besançon, der Bischöfe Stefan von Metz, Albero von Lüttich, Ortlieb von Basel, Bucco von Worms, Embricho von Würzburg und Werner von Münster, der Herzöge Friedrich (II. von Schwaben), Konrad (von Zähringen) und Matthäus (von
Oberlothringen), Markgraf Hermanns (von Baden), Graf Bertolfs (von Nimburg) und Graf Friedrichs (von Pfirt) die bereits früher gewährte Freiheit, daß von keinem seiner Nachfolger in den Besitz des Klosters eingegriffen werden darf. Des weiteren verbietet er
widerrechtliche Eingriffe jedweder weltlichen Person in das Kloster, bestimmt, daß nur der Abt über die familia und die Ministerialen Herrschaft ausübt (interdicimus, ut nulla secularis potestas, dux vel marchio, comes aut vicecomes, advocatus vel sub advocatus
aliquam in eadem abbatia iniustam vel violentam exerceat potestatem, sed tota eiusdem ęcclesię familia intus et exterius specialiter autem illi ministeriales ęcclesię, qui abbati fratribusque cotidiano servitio assistunt, quadam familiaritatis libertate de omni forisfacto
abbati tantum respondeant) und gewährt den Mönchen das Recht der freien Wahl eines Abtes aus ihrem Konvent.“ Das geschah am 28. Mai 1139 in Straßburg. RI IV,1,2 n. 134 Konrad bestätigte vor Weinsberg eine Schenkung von Gütern in Rümlang und Riet.
1141 war der päpstliche Legat Dietwein in Deutschland. Er stammte aus Schwaben, war Prior in Maursmünster, später Kardinal von Santa Rufina und Porto. Er weihte 1141 die neuerbaute oder restaurierte Kirche auf der Ufnau. Bei dieser Gelegenheit wurden
die Gebeine des Heiligen Adelrich erhoben und seine Heiligsprechung vollzogen. Das erste erhaltene Abtssiegel von Einsiedeln stammt von Abt Werner. Er verstarb am 5.oder 6. März 1142. Sein Nachfolger wurde Rudolf II. Das Liber Heremi und auch das
Badische Geschlechterbuch sehen in ihm ein Familienmitglied der Grafen von Lupfen. Bei seiner Wahl zeigte sich, dass die Vorkehrungen Abt Werners durchaus sinnvoll waren, als er sich von Konrad die freie Abtwahl bestätigen ließ. Die Mönche wählten
den neuen Abt. Doch der Klostervogt Rudolf von Rapperswil (Vogt von 1142-1144) sowie Ministeriale erkannten die Wahl nicht an, da sie nicht gehört worden waren. Sie überfielen das Stift, verwundeten einige Mönche und auch den neugewählten Abt.
Diese flohen nach Konstanz zu Konrad, der gerade in Konstanz (oder auf der Reichenau) weilte und dort einen Hoftag abhielt.Er setzt Rudolf, der von den Mönchen rechtmäßig erwählt wurde, als Abt der Abtei Einsiedeln ein und ordnet dessen Weihe durch den
päpstlichen Legaten und Kardinalbischof Dietwin (von S. Rufina) an. RI IV,1,2 n. 233 4 Der päpstliche Legat und vier Bischöfe, nämlich Embricho von Würzburg, Otto von Freising, Hermann von Konstanz und Konrad von Chur, sowie die Äbte Fridelo von Reichenau
und Werner von St. Gallen waren zugegen. An weltlichen Größen waren die Herzögen Friedrich (II.) von Schwaben und sein Sohn Friedrich, Konrad (von Zähringen) (Burgundionum dux), Matthäus von (Ober-)Lothringen und Welf (VI.), die Grafen Rudolf von
Bregenz, Rudolf von Ramsberg, der Markgrafen Hermann von Baden, die Grafen Friedrich und Burchard von Zollern, Markward von Veringen, Eberhard von (Ober-)Kirchberg und Werner von Habsburg vertreten. Am 12.4.1142, das war der Palmsonntag,
weihte der päpstliche Legat Dietwein Rudolf auf der Reichenau zum Abt von Einsiedeln. Auf Geheiß des Legaten wurde auch der Streit um das geraubte Haupt des heiligen Justus beendet. Er wies die Mönche von Alpirsbach 1143 an, das Haupt zurück zu geben.
Zu Beginn der Amtszeit des neuen Abtes flammte auch der Streit mit den Schwyzern und den Grafen von Lenzburg wegen der Alpen und Weiden wieder auf. In Straßburg wurde am 8. Juli 1143 “auf Intervention und Bitten Königin Gertruds der Streit zwischen Graf
Ulrich von Lenzburg (Ǒthelricum de Lenzenbůrg), dessen Miterben und den Einwohnern von Schwyz (cives de Suites) einerseits und Abt Rudolf von Einsiedeln (monasterii Megenradescella dicti, quod consecratum est in honorem sanctę dei genitricis Marię sanctique
Mauricii martyris) andererseits zur Entscheidung durch das Gericht seines Hofes (finali iudicio curię nostrę) vorgelegt. Er läßt zu diesem Zweck auf dem Hoftag in Gegenwart des Einsiedler Vogtes Rudolf von Rapperswil eine Urkunde Kaiser Heinrichs V. verlesen, mit
der aufgrund eines Urteils der örtlich zuständigen Schwaben dieselbe Angelegenheit zugunsten des damaligen Abtes Ger und dessen Vogtes Ulrich (von Rapperswil) entschieden wurde: Die Grafen Rudolf und Arnulf (von Lenzburg) und die Einwohner von Schwyz,
welche ein an ihre eigenen Felder angrenzendes Waldgebiet, das dem Kloster von den Kaisern Otto II., Otto III., Heinrich III. und Heinrich IV. als Reichsgut überlassen worden war, gewaltsam an sich gebracht hatten, wurden zu einer Buße verurteilt. Konrad verhängt
über den Grafen Ulrich und seine Streitgenossen, die dieses Urteil nicht akzeptiert hatten, eine weitere Geldstrafe und bestätigt den Besitzstand Einsiedelns innerhalb genannter Grenzen nach dem Vorbild von in seiner Gegenwart und mit Zustimmung des Hofes
anerkannten, von früheren Königen und Kaisern ausgestellten Privilegien des Klosters” . Die Liste der Zeugen war wieder beindruckend nämlich die Bischöfe Embricho von Würzburg, Burchard von Straßburg und Ortlieb von Basel, die Äbte Berthold von Murbach,
Wibald von Stablo, Fridelo von Reichenau und Walter von Selz, Herzog Friedrich (II.) von Schwaben, Herzog Konrad (von Zähringen), Markgraf Hermann (von Baden), Rudolf von Hohenberg, Volkmar von Froburg, Graf Ulrich von Gammertingen, Graf Eberhard von
Kirchberg, Berthold von Kalden, Ludwig von Öttingen, Graf Dietrich von Mömpelgard, Graf Ulrich von Egisheim, Graf Siegfried von Boyneburg in Sachsen, Graf Adolf von Berg in Westfalen, Graf Simon von Saarbrücken, Graf Sigibert (von Frankenburg), Heinrich von
Rheinau, Marquard von Grumbach, Konrad von Schwarzenberg, Graf Berthold von Nimburg, Sigebodo von Hohweiler, Marquard von Rothenburg, Berthold von Tannegg, Heinrich von Rheinfelden, Konrad von Krenkingen, Heinrich von Küssaberg, Burchard von
Herznach, Hugo von Teufen. – RI IV,1,2 n. 277
1155 verkaufte Rudolf das am Bodensee gelegen Landgut Maurach an das Kloster Salem (heute direkt unter der Birnau) und kaufte dafür ein günstiger gelegenes Gut. Am 18.3. 1161 bestätigte Papst Viktor IV. dem Kloster die Schenkung des Kloster
Fahr und erklärte dieses als unveräußerliches Eigentum von Kloster Einsiedeln.Viktor IV. war der von Barbarossa gestützte Gegenpapst zu dem am 18. September 1159 gewählten Papst Alexander III. Aus der von Viktor ausgestellten Urkunde lässt sich schließen,
dass Einsiedeln auf Seite der Staufer stand. Rudolf starb am 15. November 1171. Und es wiederholten sich die Vorgänge der Wahl von Rudolf. Die Mönche wählten einen Abt aus ihrer Mitte
aber auch diesmal erkannte ihn der Vogt Rudolf von Rapperswil nicht an. Sein Name ist nicht näher bekannt. Der Vogt verlangte, dass sein Bruder, der Mönch in St. Gallen war Abt in Einsiedeln werden sollte. Nach dem Liber Heremi und Bonstetten war es Warin.
Der Vogt hatte den Mönchen so zugesetzt, dass sie sich fügten. Einige gelangten allerdings nach Säckingen, wo sich Friedrich gerade aufhielt. Er setzte am 28. Februar oder 1. März beide Äbte ab RI IV,2,3 n. 2011 und ernannte Werner II. zum Abt von Einsiedeln.Er war
erst Diakon, als er zum Abt bestimmt wurde. Deswegen wurde er im Fraumünster in Zürich zu Priester geweiht. Am 5. März kehrte er nach Einsiedeln zurück. Er suchte die Misswirtschaft der vergangenen Jahre wieder gut zu machen. Ob sich das nur auf die beiden
Jahre mit zwei Äbten oder einen längeren Zeitraum bezieht, kann ich nicht ersehen. Auf jeden Fall erwarb er versetzt Kirchengüter für 200 Mark zurück. In Einsiedeln und auf Stiftsgütern ließ er neue Bauten erstellen. Er vermehrte den Grundbesitz. In einigen Orten,
so in Riegel, Pfäffikon, Brütten und Erlenbach zog er die Meierämter wieder an sich. Die Meier waren oft zu mächtig geworden und nützten ihr Amt zum Schaden des Klosters aus. Werner ersetzte sie durch Amtmänner, die man beliebig ihrer Stelle entheben
konnte.
Wahrscheinlich stammen von ihm auch die Konstitutionen, “ordo ad faciendum monachum”. Diese geben einen guten Einblick, was Brüder und Schüler das Jahr über Wäsche, Kleidern, Pelzen und Schuhwerk zu bekommen hatten. Zu Lebzeiten
Friedrich Barbarassos hatte der Abt keine Schwierigkeiten mehr mit seinem Vogt. Ab 1190 änderte sich dieses, so sehr dass er 1192 gegen den Willen seiner Mitbrüder resignierte. Dem Kloster blieb er aber noch als Dekan erhalten. Er mehrte noch den Klosterschatz
Werner war zugleich Bibliothekar und kümmerte sich um Bücher. Das Werk “abedecarius” ließ er in zwei Bänden binden.
Werner verstarb 1210. Der genaue Todestag ist nicht bekannt.
Nach der Resignation Werners scheint Rudolf von Rapperswil im 3. Anlauf an seinem Ziel angekommen. Die Mönche wählten wahrscheinlich auf erheblichen Druck seinen Bruder oder Sohn zum Nachfolger.Seine schlechte Regierung wird hervorgehoben, ja
er wird als “Flagellum quoddam iracundiae Dei” also als wahre Gottesgeissel bezeichnet. Doch nachdem, was wir wissen, scheint es doch, dass er den Nutzen des Stiftes zu wahren suchte. Er verteidigte das Präsentationsrecht gegenüber Bischof
Lütold von Basel (1192-1213) auf die Kirche von Hohenkirch im Oberelsass. Auch das Patronat über die Kirche von Stetten, auch im Oberelsass und die Leonhardskirche in Basel wurde anerkannt. Das Patronat über die Kirche in Weiningen, dass Judenta an Fahr
geschenkt hatte, musste er gegenüber Bischof Diethelm von Konstanz aber aufgeben. 1206 musste er aber die Abtei abgeben, warum ist nicht mehr bekannt, wie die Einsiedler Annalen vermerken. Die selbe Quelle gibt auch an, das Ulrich im selben Jahr verstorben
ist. Der Einfluss der Rapperswiler Schutzvögte scheint nun gebrochen zu sein.Später wird das Verhältnis sogar freundschaftlich.
Nachdem Ulrich abgetreten war, nahm Berthold den Einsiedler Abtsstuhl ein, nach Bonstetten und dem Liber heremi ein Freiherr von Waldsee und aus der Familie der Grafen von Heiligenberg. Von Bonstetten wird er hochgerühmt, was sich ebenso wenig
belegen lässt, wie die Vorwürfe der Mißwirtschaft seines Vorgängers. Dass er aber von Papst Innozenz III. zusammen mit dem Bischof Reinherr von Chur (1194-1209), der für den Papst öfters in Streitsachen als Schiedsrichter tätig war, in der Streitsache des Grafen
Rudolf von Montfort und dem Abt Konrad von Alt-St. Johann, das ist ein Mitte des 12. Jahrhunderts im oberen Thurtal gegründetes Benediktinerkloster, als Schiedsrichter eingesetzt wurde, spricht durchaus für seinen Ruf. Auch für den Erzbischof von
Mainz, Siegfried von Eppstein, schlichtete er 1210 zusammen mit Abt Heinrich II. von Rheinau (1206-1233) in einer Streitsache der Äbtissin von Fraumünster in Zürich und ihrem Meier in Horgen. Der Spruch erging am 20. Juli 1210. Um diese Zeit brach auch der
Marchenstreit aufs Neue aus. Abt Bertold weilte am 31. März 1213 am Hoflager des jungen Stauferherrschers Friedrich II, der von dort aus den Kampf um sein Reich aufnahm. Möglicherweise wollte er sich Hilfe bei Friedrich in der Streitigkeit
mit den Schwyzern holen. Aber sicher hatte Friedrich zu derzeit andere Sorgen. Es ist auch möglich, dass diese alte Streitigkeit den Abt zur Resignation veranlasste. Der genaue Grund ist nicht bekannt, auch nicht sein Todesdatum. 1216 hat er wohl noch gelebt,
denn er wird in einer Urkunde über einen Güteraustausch im Jahre 1216 aufgeführt: “dominus Covnradus abbas, Bertholdusa prior abbas,”1213 .
Konrad stammte, wie das Liber Heremi und Bonstetten berichten aus der Familie der Grafen von Kiburg –Thun. Aus seiner Familie kennen wir neben Konrad noch Heinrich von 1216 bis 1238 Bischof von Basel sowie Burkhard von Unspunnen. Mit ihm, der zwischen
1232 und 1237 starb, erlosch die Familie im Mannesstamm. Als Konrad an die Regierung kam, war die Auseinandersetzung zwischen dem Staufer Friedrich und dem Welfen Otto noch in vollem Gange. Erst die Niederlage des Welfen in der Schlacht bei
Bouvines 1214 entschied den Machtkampf zugunsten Friedrichs, weil sein Gegenspieler Otto jetzt die Unterstützung vieler Reichsfürsten verlor. Den Kampf um das Königtum nutzten die Schwyzer um ihre Vorstöße auf das Stiftsgebiet wieder
aufzunehmen. Diesmal ging es vor allem um die Gegend des oberen Sihltals. Sowohl das Stift als auch die Schwyzer rodeten in diesem Gebiet. Das führte zwangsläufig wieder zu Konflikten. Der Abt wandte sich an seine Schutzvögte Rudolf und Heinrich von
Rapperswil. Diese griffen wohl brachial durch. Sie brannten die Hütten und Ställe nieder, die die Schwyzer auf Klostergebiet errichtet hatten, nahmen Vieh und Werkzeug weg und wer sich zur Wehr setzte, wurde getötet. Die Sache wurde vor den
Landvogt im Zürichgau, Rudolf II. von Habsburg, gebracht,der im Amt auf die Grafen von Lenzburg gefolgt war. Am 11.6.1217 entscheidet Graf Rudolf II. von Habsburg den dreijährigen Streit zwischen Abt Konrad I. von Einsiedeln und den Vögten des Klosters Rudolf
und Heinrich von Rapperswil einerseits und den Landleuten von Schwyz anderseits um den Wald, in dem das Gotteshaus gelegen ist, als von beiden Teilen angerufener Richter unter Zuziehung von adeligen Herren und Dienstleuten, indem er die Urkunden und
Ansprachen beider Teile als abgetan erklärt und eine neue Grenzlinie festsetzt. Die Schwyzer bekamen das hintere Sihltal, sowie die Täler der Waag und Minster und das obere Alptal zugesprochen. Beide Parteien hatten vorher zugesagt, sich der Entscheidung des
Landgrafen des Zürichgaus zu fügen. Der Kompromiss, den Rudolf erreichte, fiel zwar zu Lasten des Stiftes aus, aber er beendete auch einen langen Streit. Er flammte zwar später nochmals aus, aber waren es bisher vor allem wirtschaftliche Gründe, so waren bei
seinem späteren Wiederaufleben vor allem politische Fragen im Spiel.
Weiteres Ungemach folgte. Nur 10 Jahre nach diesem für das Kloster unglücklichen Entscheid fiel, brannte es am 5. Mai 1226 wieder im Kloster. Die Kirche fiel dem Feuer zum Opfer, wurde aber noch im gleichen Jahr wieder aufgebaut. Bischof Konrad weihte die
Kirche und Abtskapelle wieder ein.
Am 8.5.1219 erneuert Bischof Konrad II. von Konstanz eine Urkunde seines Vorgängers Diethelm, wonach die Kirche Weiningen gemäss Stiftung der Judenta von Regensberg dem Kloster Fahr zustehen soll und der frühere Abt Ulrich I. von Einsiedeln dieses Recht
anerkannt hat. Dies geschah auf Bitten des Erzbischofs Eberhard von Salzburg. Damit war der Streit, der zwischen Abt Ulrich und dem Konstanzer Bischof Diethelm über das Patronat der Kirche von Weinigen bestanden hatte, endgültig beigelegt. Der päpstliche
Legat Konrad, Bischof von Porto bestätigte dies den Frauen von Fahr am 11. Januar 1224. 1230 gestattet Abt Konrad Rudolf von Rapperswil zum Dank für die Hilfe im Marchenstreit, sich auf der Landzunge Endingen anzusiedeln, die dem Stift gehörte. Dort enstanden
Stadt und Schloss Rapperswil.
Auch Konrad war im Auftrag des Papstes tätig. So hatte er im März 1217 einen Streit zwischen Diakon Heinrich und dem Konstanzer Propst Heinrich von Tanne um eine Kirche zu schlichten, zusammen mit Abt Cuno vom Kloster Marienberg und dem Propst des
Augustinerchorherrenstifts Öhningen auf der Höri.
Wahrscheinlich in der Amtszeit dieses Abts stammt das älteste Urbar von Kloster Einsiedeln. Es ist zwar nicht vollständig, gibt aber wertvolle Aufschlüsse über die Besitzungen des Klosters und dessen Einkünfte, aber auch über wirtschaftliche und kulturelle
Zustände.
Wie seine Vorgänger verzichtete auch Konrad auf die Abtei. Nach den Annalen geschah dies im Jahr 1234. Im gleichen Jahr ist auch sein Todesjahr.Nach der Resignation Konrads wurde Anselm von Schwanden zum Abt gewählt. Er entstammte dem
Geschlecht der Freiherren von Schwanden, die ihren Sitz in der Pfarrei Schupfen im Bezirk Aarberg hatten.Urkundlich fassbar wird Anselm erstmals am 25.1.1239. Da wird ein Gütertausch zwischen dem Zisterzienserkloster Kappel und dem Stift Einsiedeln
beurkundet. Kloster Kappel hatte 1228 von den Habsburgern den Hof in Baar im Kanton Zug erworben. Die Urkunde wird heute noch im Pfarrarchiv der Gemeinde Baar aufbewahrt und ist das älteste Schriftdokument der Gemeinde.
In Baar hatte das Kloster Einsiedeln am Mühlbach, einem Seitenarm der Lorze seine Klostermühle erbaut. Es ist dies die älteste Mühle im Kanton Zug. Das Kloster Kappel wollte wohl seinen Besitz in Baar ausweiten. Ein Gütertausch mit Kloster Einsiedeln bot sich an.
Für seine Besitzungen in Finstersee tauschte es die Mühle und einen Hof in Baar ein. Abt Heinrich von Kappel und Anselm vom Kloster Einsiedeln nahmen den Tausch vor. In der Folge taucht Anselm noch mehrere Male in Urkunden auf. Er nimmt Schenkungen
entgegen, die er oft gleich wieder als Lehen an den Schenkenden vergibt. So 1244 an den Bürger Anton von Rapperswil, der wohl derselbe ist, der am 25.1.1252 von Anselm den Zehnten der Pfarrei Meilen verliehen bekommt. Mit den Grafen von Rapperswil stand
er wohl auf gutem Fuße, den er tritt öfters als Zeuge in Urkunden des Grafen auf. Daneben gibt es kleinere Geschäfte, die Leibeigene betrafen.
Wie oben ausgeführt hatte Otto I. ja den Hof in Pfäffikon geschenkt. Das Kloster errichtete dort einen Speicher zur Lagerung des Zehnten. Abt Anselm ließ dort einen Turm errichten zur Abwehr feindlicher Angriffe und zum Schutz der Klosterländereien.
Wohl unter Abt Johannes I. von Schwanden wurde die Anlage mit Mauern, Wällen und Wassergräben weiter verstärkt. Auch in der Folgezeit war die Anlage wichtig. Sie diente öfters als Abtsresidenz. 1480 fand hier die Abtswahl statt und nach dem großen
Klosterbrand von 1577 kamen die Mönche hier für 7 Monate unter.
Auch in Diensten des Papstes finden wir den Abt öfters. In Rom war seit 1243 Innozenz IV. Papst.In St. Gallen war Burchard von Falkenstein 1244 Abt geworden (siehe Blog St.Gallen) Das Kloster stand bisher fest auf Seiten des Kaisers.
Der neue Abt aber schwenkte ins päpstliche Lage über. Der St. Gallener Abt wurde für seinen Positionswechsel schnell belohnt.Das Kloster Rheinau war durch seine Vögte, die Herren von Krenkingen in missliche Lage gebracht worden. Papst Innozenz hatte
die Verwaltung des Stifts dem Konstanzer Bischof Heinrich von Tanne übertragen. Doch dieser verstarb 1248. Der Papst übertrug am 7. September 1248 Abt Burchard die Verwaltung des vakanten Klosters. Allerdings stieß auf heftigen Widerstands des Nachfolgers
des verstorbenen Bischofs von Konstanz, Eberhard II. ein Neffe von Bischof Heinrich. Er erhob ebenfalls seinen Anspruch auf das Kloster. Der Papst befahl am Tag der Übertragung auf den St. Gallener Abt dem Rheinauer Konvent dem als Verwalter eingesetzten
Abt zu gehorchen und Abt Anselm aus Einsiedeln den Konvent nötigenfalls mit Gewalt zum Gehorsam zwingen. Am 30.5. 1250 beauftragte er Abt Anselm, das Kloster St. Gallen mit der Abtei Rheinau zu vereinigen und erst am 1.7.1250 gelangte der St. Gallener Abt in
den Besitz des ihm vom Papst zugesprochenen Klosters.
Auch Einsiedeln hatte sich nicht aus den Streitigkeiten zwischen Papst und Kaiser heraushalten können. Innozenz hatte nach seiner Wahl das Konzil 1245 abgehalten. Dort hatte er Kaiser Friedrich des Eidbruchs, der Häresie, des Sakrilegs und
der Unterdrückung der kirchlichen Freiheiten angeklagt. Der Kaiser wurde in allen Punkten schuldig gesprochen und erneut gebannt und der Gehorsam gegen ihn wurde verboten. Über alle Gebiete, die dem Staufer anhingen, wurde das Interdikt ausgesprochen.
Der Bischof von Konstanz wurde am 10. Juni 1247 bevollmächtig, die Durchführung mit schwersten Strafen zu erzwingen. Das Kloster Einsiedeln erwirkte sich, wie auch andere Klöster, die Erlaubnis, das Interdikt milder beobachten zu dürfen, also ohne
Glockenläuten Gottesdienst hinter verschlossenen Türen feiern zu dürfen, vorausgesetzt man habe nicht selbst zum Interdikt Anlass gegeben (16.12.1247).Auch Kremsmünster (21.1.1247), Pfäfers (23.5.1248), und Mehrerau (27.5.1248) erreichten diese
Vergünstigung. Weitere Gnadenerweise waren der 40 tägige Ablass für alle Gläubigen, die Einsiedeln an an Weihnachten, Ostern, Pfingsten, an den Festen der Jungfrau Maria und am Fest der Kirchweihe besuchen.
Der Papst war also durchaus freigiebig mit Gnadenerweisen auch wenn es darum ging, Parteigängern mit Pfründen zu versorgen. Nachdem sich solche Ansinnen häuften, wandte sich Anselm an den Bischof von Sitten, Heinrich von Raron und den St. Gallener Abt um
Vermittlung. Darauf bestimmte Innozenz am 31.8.1250, dass das Kloster von solchen Belästigungen verschont blieb. Der Propst von Interlaken wurde beauftragt, dafür zu sorgen. Am 16.2.1251 erlaubte der Papst dem Abt den Gebrauch des Siegelrings und Mitra auf
Lebenszeit.
Auch der Nachfolger von Innozenz, Papst Alexander IV. (Papst von 1254-1261) setzte Abt Anselm ein. Auf der Reichenau war Burkhard von Hewen von 1253-1259 (siehe Reichenau)Abt. Das Kloster war ziemlich heruntergekommen. Die Mehrheit der Mönche
wandte sich an Papst Alexander. Dem Abt wurde Verschleuderung der Klostergüter, Simonie und Zerstörung des Ordensleben vorgeworfen. Darauf hin setzte der Papst den Abt von Ottobeuren Heinrich, Anselm von Einsiedeln und den Abt von Neuwiller im Elsass
zur Untersuchung der Vorwürfe ein. Außerdem sollten sie auch eine Reform des Klosters voranbringen. Am 6. Februar 1258 übertrug Papst Alexander den St. Gallener Abt Berchtold die geistliche und weltliche Verwaltung Kloster Reichenaus. Das wieder rief den
Konstanzer Bischof auf den Plan, der an die päpstliche Kurie berichtete, der Bericht Burchards sei reine Erfindung. Daraufhin wurde Anselm wieder mit der Untersuchung der Vorfälle betraut. Am 7. März 1258 befahl der Papst, Abt Anselm bei er Untersuchung
zu unterstützen. Außerdem nahm er die ”erschlichene Bestellung des Abts von St. Gallen zum Koadjutor des Reichenauer Abts” zurück. Burkhard verzichtete auf die Reichenau und schlug Albrecht von Ramstein als Abt für die Reichenau vor.
Dieser war Pförtner und Konventuale in St. Gallen, außerdem ein Vetter und Vertrauten Burchards. Der Papst berief nun die beiden streitenden Parteien nach Viterbo. Dort gelang es dem Papst, Abt und Bischof zu versöhnen. Albrecht wurde1259 zum
Reichenauer Abt gewählt.
Die im Züricher Urkundenbuch abgedruckte Urkunde Nr. 1325 ist die letzte, die uns von Anselm überliefert ist. Es handelt sich um eine Schenkung Anselms eines Guts in Killwangen an das Kloster Wettingen.
Am 30. Dezember 1266 verstarb Abt Anselm.
Als sein Nachfolger wurde Ulrich II. von Winneden gewählt. Das Liber Heremi sagt, dass er vorher Kustos gewesen sei und in einer Urkunde (Züricher Urkundenbuch III Nr. 1214) erscheint auch ein Kustos Ulrich als Zeuge.
Er stammte aus der Familien der Edlen von Winneden, das heutige Wennedach, Gemeinde Reinstetten im Kreis Biberach/Riss. Er hatte wohl drei Brüder, einen namens Heinrich, der die Herrschaft Wennedach innehatte,
einen, dessen Namen wir nicht mehr kennen und Konrad, der Mönch in Augsburg war. Heinrich hatte drei Kinder, Mechthild, die Klosterfrau in Fahr wurde, Diethoh, der uns noch begegnen wird und ein drittes, dessen Name uns nicht bekannt ist.
In Urkunden tritt der Abt erstmals am 25. Oktober 1268 auf (Züricher Urkundenbuch Nr.1397) Es geht hierbei um einen Streit über Eigentumsrechte um eine Mauer zwischen einem Hof des Klosters Einsiedeln und dem Fraumünsterkirchhof in
Zürich. Am 13. Januar 1275 gibt der Abt und der Konvent Güter in Laupheim, Wennedach und Simmisweiler an den Edlen Diethoh von Winnenden zurück, die dieser dem Kloster geschenkt und zu Lehen zurückerhalten habe, zurück,
da sie, so die Begründung, mehr Kosten verursache, als das Kloster daraus je erwirtschaften könne. Der Bauhistoriker Stefan Uhl aus Warthausen meint, dass es sich dabei auch um eine Verschleierung der tatsächlichen Besitzverhältnisse
gehandelt haben kann. Möglicherweise hat es sich ursprünglich um Reichsgut gehandelt. Und wenn es nun aus Einsiedeln unter der Vorspieglung wirtschaftlicher Erwägungen zurückgegeben wurde, konnte es faktisch in den Eigenbesitz Diethohs übergehen.
1270 erwarb Ulrich die Vogtei über die Kirchengüter in Erendingen im Kanton Aargau zurück.
Am 29. September 1273 wurde Rudolf von Habsburg zum deutschen König gewählt. Damit endete das Interregnum und es kehrte allmählich wieder Rechtssicherheit im deutschen Reich ein. Im Januar kam der neugewählte König nach Zürich.
Auch Abt Ulrich kam nach Zürich. Dort wurde am 26.1.1274 folgende Urkunde ausgestellt: “König Rudolf I. erklärt, dass er Abt Ulrich II. von Winneden zu Einsiedeln in der Konstanzer Diözese durch das königliche Zepter mit der fürstlichen Würde bekleidet und ihn
unter die Zahl seiner Fürsten aufgenommen habe, allen Dienstmannen, Rittern und Untertanen der gedachten Abtei gebietend, demselben als solchem in der Verwaltung der Temporalien Gehorsam zu leisten.” Damit wurde erstmals diese Würde an
den Einsiedler Abt verliehen, wobei Rudolf ausdrücklich bezeugt, dass schon frühere Äbte diese Würde besessen hätten.
1275 wurde das Zehntbuch für die Einziehung des Kreuzzugszehnt, der 1274 auf dem beschlossen worden war, angelegt. Dieser wurde dann von 1274-1280 von allen Beziehern geistiger Pfründen erhoben. Dazu mussten sie eine eidliche Selbstangabe abgeben.
Der Einsiedler Abt gab 761 Pfund an Damit hat man ein schönen Einblick in die Vermögenslage des Stiftes.Oft hatten Eigenleute verschiedener Herren Stifte geheiratet. Das hatte immer wieder zu Schwierigkeiten geführt. Nun einigten sich Stifte, dass Eigenleute
untereinander heiraten konnten, als ob sie demselben Herrn gehörten. 1276 gab es eine solche Genossame zwischen den Stiften Pfäfers, Disentis, Chur, Schänis, St. Gallen, Reichenau,Luzern, Säckingen Zürich und Einsiedeln.
1277 begab sich Abt wohl auf eine Romfahrt. Am 11.8. 1277 verstarb er in Como und ist dort wahrscheinlich auch begraben.
In seiner Amtszeit besetzte der Konvent auch einen Abtsstuhl. Dietrich von Rodt aus der Familie der Edelfreien von Rodt in der Nähe von Illertissen wurde 1266 nach Augsburg ins Kloster St. Ulrich und St. Afra berufen.Er folgte dem verstorbenen Abt
Gebwin von Thierheim und war dort Abt bis 1288. Seine Regierung galt als gut. Er war ein Bruder von Wolfhard, der von 1288-1302 Bischof von Augsburg war.
Zu seinem Nachfolger wählen die Mönchen Peter I. von Schwanden. Er stammte wie sein Vor-Vorgänger aus der Familie von Schwanden. Dass er dieser Familie angehörte, belegt dasselbe Epitaph, das auch Auskunft über Anselm gibt.
Das einzige Mal, an dem er urkundlich fest zu machen ist, ist der 27. Oktober 1275. Dort erscheint er als Zeuge und wird Kustos genannt. Es ist nicht verwunderlich, dass er sonst nicht in Urkunden auftaucht, denn seine Regierungszeit endete schon am
19. Juni 1280. Wie uns die Annalen berichten, wurde Peter an diesem Tag in der Liebfrauenkapelle in Zug vom Blitz erschlagen. Von Abt Johannes I. wissen wir, dass Peter die Vogteien an den nachgeborenen Sohn Rudolfs IV. von Rapperswil, Rudolf V. übertragen
hatte.
Auf ihn folgte Heinrich II. von Güttingen. Es ist dies der erste Abt in Einsiedeln, dessen Geschlechtsnamen in gleichzeitigen Urkunden genannt wird. Seine Familie, die Freiherren von Güttingen hatten ihren Stammsitz in dem kleinen Dorf am Bodenseeufer.
Diese Familie stellte mit Rudolf, der von 1220 bis 1223 die Abtswürde bekleidete, bevor er 1223 Bischof von Chur (bis 1226) wurde und Ulrich (1272-1277) zwei Äbte in St. Gallen. Der Bruder Ulrichs, Albrecht ist im St. Gallener Professbuch als Diakon
aufgeführt. Später wurde Albrecht Barfüsser. Am 15. Januar 1283 verstarb der letzte Rapperswiler Graf Rudolf V. noch minderjährig. Wie wir oben gesehen haben, hatte Abt Peter diesem die Vogtei übertragen. Diese ging nun an seine Tante Elisabeth und deren
Gemahl von Homberg über. Die beiden kamen aber nicht um das Lehen ein. Deshalb übertrug Abt Heinrich die Vogtei an seinen eigenen Bruder Rudolf von Güttingen. Damit war allerdings König Rudolf nicht einverstanden. Gegen eine Entschädigung von 200
musste der Güttinger verzichten. König Rudolf ließ die Lehen, die eigentlich nur in männlicher Linie vererbbar waren, durch den Schultheißen Dietrich von Winterthur einziehen. Im Laufe dieser Auseinandersetzung überfiel der Schultheiss sogar
das Kloster. Daraufhin erwirkte er bei Bischof Rudolf (1274-1293) die Exkommunikation des Schultheissen. Der Bischof entstammte auch dem Hause Habsburg und war ein Vetter Rudolfs.Allerdings geriet er wegen dessen Landerwerbungen
in Gegensatz zu seinem königlichen Verwandten. Im Einverständnis mit dem König wurde der Leutpriester der Ufnau mit der Durchführung der Exkommunikation beauftragt. Der Graf von Homberg verstarb 1289. Elisabeth suchte nun nach nach einem
Vergleich. Dieser kam am 21. 1289 in Basel zustande. Die Witwe bekam die Höfe Stäfa, Pfäffikon, Erlenbach und Wollerau, dazu noch die Höfe von Männedorf und Tuggen die Pfäfers gehörten. Die Vogtei aber blieb bei den Herzögen von Österreich.Nun aber
flammte der Marchenstreit wieder auf, diesmal wohl politisch motiviert. Nachdem Rudolf König geworden war, baute er rücksichtslos seinen Territorialstaat aus und versuchte die Vogteien, wie die von Einsiedeln an sich zu bringen. Von den Waldstätten und den
Schwyzern wurde dies mit großem Misstrauen beobachtet. Zwar gibt es eine Bulle aus dem Jahre 1282 In dieser erteilt Papst Martin IV.dem Abt von Pfäfers infolge Klage des Abtes und Konventes von Einsiedeln über Bedrückung und Schädigung den Auftrag, Abt und
Konvent gegen Räuber und Angreifer zu schützen und die Fehlbaren mit Kirchenstrafen ohne Appellation in Schranken zu halten. Wahrscheinlich sind die Auseinandersetzungen aber in den letzten Regierungsjahren Rudolfs an zusetzen, wo die Spannungen
zwischenden Eidgenossen und Habsburg auf ihrem Höhepunkt angelangt waren. Im August 1291 hatten die Eidgenossen ja ihren Bund erneuert.
Die Schwyzer gingen nun gegen das Kloster vor, wollten aber eigentlich dessen Vögte, also die Habsburger treffen. Es war also eine Freiheitsbewegung und kein Klosterstreit, der sich hier auftat.
Papst Nikolaus IV. (1288-1292) bestätigte am 23. 8 1290 bei Orvieto “dem Abt und Konvent von Einsiedeln auf ihre Bitte alle Freiheiten, die ihnen von seinen Vorgängern, und ebenso die Freiheiten und Befreiungen von weltlichen Abgaben, die ihnen von
Königen, Fürsten und andern Christgläubigen gewährt worden sind.” Heinrich bemühte sich sehr um die Verwaltung des Klosterbesitzes, was die Hofrechte von Fahr und Eschenz und Einkunftsverzeichnisse von Riegel,Brütten, Walahusin und Winterberg belegen,
die er aufzeichnen ließ. 1288 erreichte er auch ein Ablassbrief von zwölf Erzbischöfen und Bischöfen, die am päpstlichen Hof in Rieti weilten einen Ablassbrief für die St. Gangulf-Kapelle in Einsiedeln.
Laut dem Liber Heremi stirbt Heinrich 1298 in Pfäffikon. Der verstorbene Abt war, wie es scheint, auch ein Förderer von Kunst. Auf ihn bezieht sich wohl der Züricher Minnesänger Johannes Hadlaub, der ihn als seinen Gönner bezeichnet. Hadlaub lebte in der 2.
Häfte des 13. Jahrhunderts und Anfang des 14. Jahrhunderts in Zürich. Von ihm sind 51 Lieder und drei Leichs in der Manessischen Handschrift überliefert.
Mit Johannes I. von Schwanden tritt das letzte Familienmitglied der Familie von Schwanden sein Amt als Abt an. Im Reich war inzwischen Albrecht König, der älteste Sohn Rudolfs von Habsburg. Nachdem Rudolfs Nachfolger Adolf von Nassau 1298
abgesetzt worden war und am 2. Juli 1298 bei der Schlacht von Göllheim ums Leben kam, wurde der am 23. Juni als Nachfolger gewählte Albrecht am 25. Juli 1298 in Aachen zum deutschen König gekrönt. Am 1.4.1299 war Albrecht in Konstanz. Dort
verlieh er Abt Johannes die Reichsfürstenwürde und übergab ihm das Zepter. Während seiner Regierungszeit war Rudolf von Radeg Schulmeister in Einsiedeln. Dieser ist von 1311-1327 bezeugt. Er war ein Sohn des Freiherren Rudolf von Radegg
und hatte wahrscheinlich die Klosterschule in Rheinau besucht. Vor 1311 war er in Einsiedeln an der Schule, aber nicht Konventuale. Durch ihn sind wir so gut wie sonst keinen mittelalterlichen Abt Einsiedelns über Johannes unterrichtet.
Rudolf schrieb die “Capella Heremitana” , ein Preisgedicht auf das Kloster Einsiedeln in 854 lateinischen Distichen. Es gliedert sich in Prolog und drei Bücher. Buch I preist die Abtei, Buch II die Person und die Leistungen von Abt Johannes und Buch III
berichtet vom Überfall der Schwyzer auf das Kloster. Es gilt auch als wichtige Geschichtsquelle aus der Zeit der Entstehung des Schweizer Bundes. Die einzige Handschrift, die 1444 geschrieben worden ist, steht im Kloster Einsiedeln. Sie ist mit einem Kommentar
versehen, der darauf schließen lässt, dass das Gedicht beim Unterricht in der Poetik und Rhetorik verwendet wurde. 7 Konventuale lebten zur Zeit Rudolfs im Kloster. Auch unter Abt Johannes stellte das Kloster wieder auswärtige Äbte und zwar Hermann von Arbon
in Pfäfers (1330-1361). Er ist wohl erst nach 1314 ins Kloster Einsiedeln eingetreten. Hermann von Bonstetten wurde von Papst Johannes XXII. 1333 zum Abt von St. Gallen berufen und war dies bis 1360. Er geriet allerdings in die Streitigkeiten zwischen Papst und
Kaiser Ludwig den Bayern. Thüring von Attinghausen war von 1333-1345 Abt in Disentis. Er und Heinrich von Bonstetten waren auch unter den Gefangenen beim Überfall der Schwyzer auf das Kloster.
Am 1.8.1314 trafen Abt Johannes und der Konvent von Einsiedeln “ Bestimmungen über sichere Aufbewahrung des Konventssiegels, dass es in der Kiste (arca) der Sakristei aufzubewahren und mit zwei Schlüsseln zu verschliessen sei, wovon der eine in der Hand
des Abts, der andere in der eines Konventualen liegen soll; bei Meinungsverschiedenheiten über den Gebrauch des Siegels zwischen Abt und Konvent soll Albrecht von Uerikon [Albertus de Uirinkon] als Schiedsrichter entscheiden” Abt Hermann von Disentis
traf am 25. März 1343 eine ähnliche Übereinkunft mit seinem Konvent. Unter Abt Johannes wurden eine Reihe frommer Stiftungen für das Kloster getätigt. Auch als Bauherr trat er in Erscheinung. Die Verstärkung des Turms von Pfäffikon wurde oben schon erwähnt.
Um das Kloster ließ er eine Umfassungsmauer errichten, der Konvent erhielt neue Wohngebäude, der Vorhof der Kirche wurde neu erstellt, Krambuden gemacht und der schon bestehende Frauenbrunnen verschönert. Die Johanneskapelle im Kreuzgang wurde
umgebaut. Auch um weltliche Dinge kümmerte sich der Abt. Die Vogtei wurde an Gräfin Elisabeth von Rapperswil vergeben, die in zweiter Ehe mit Rudolf von Habsburg-Laufenburg verheiratet war. Den verschuldeten und verpfändeten Hof in Riegel löste er wieder
ein. Weit entlegenen Besitz tauschte er gegen günstig gelegeneren ein. In Höngg und Erlenbach ließ er Weinberge anlegen.
Gravierendstes Ereignis aber war der erneute Ausbruch des Marchenstreits. Am 1. Mai 1308 hatte Johann von Schwaben seinen Onkel, König Albrecht in Windisch an der Reuss erschlagen. Es war um die Herausgabe seines väterlichen Erbes, vor allem aber
der Entschädigung, die er wegen seines Verzichts auf Mitherrschaft nach den Bestimmungen der Rheinfeldener Hausordnung von 1283 zu beanspruchen hatte. Dies enthielt die Erbfolge Rudolfs I. von Habsburg und war das erste Hausgesetz des Hauses Habsburg.
Albrecht hatte seinen Neffen immer vertröstet und die Auslieferung des Erbes verweigert mit den für ihn tödlichen Konsequenzen. Nach dem gewaltsamen Tod des Königs begannen die Übergriffe der Schwyzer. Sie trieben im Sihl-,Alp- und Bibergebiet
Viehherden auf Stiftsgebiet und griffen auch sonst in die Rechte des Stiftes ein. Auch bewaffnete Überfälle in diesem Gebiet und auch auf Stiftsbesitzungen im Zuger Land erfolgten. Das Kloster klagte beim Bischof von Konstanz Gerhard von Bevar (1307-1318)
und König Heinrich VII. Der Bischof entschied, dass die Schwyzer das Geraubte zurück zu geben hätten und den Schaden ersetzen müssten. Dagegen erhoben die Schwyzer beim Apostolischen Stuhl Einspruch. Der Bischof verhängte die Exkommunikation der
Schwyzer, darunter der Landamman Konrad ab Yberg, seine Söhne Konrad und Ulrich sowie Rudolf Staufacher, der ehemalige Schwyzer Landamman und seine Söhne Heinrich und Werner, der wohl beim Rütlischwur dabei war, sowie andere. Die Schwyzer
klagten dagegen in Avignon. Clemens V. beauftragte den Abt von Weingarten Friedrich Heller von Hellersberg und den von Engelberg sowie den Konstanzer Domherrn Lütold von Röteln mit der Untersuchung der Angelegenheit. Sollte die Exkommunikation nach
erfolgter Appellation erfolgt sein, so sei sie aufzuheben. In der Tat wurde die Exkommunikation am 20.Juli 1310 zurückgenommen. Einsiedeln hatte auch bei König Heinrich geklagt. Dieser war im Mai 1309 in Zürich und bald darauf in Konstanz. Heinrich verbot jede
weitere Schädigung. Er bestellte auch einen Obmann für ein Schiedsgericht. Wie aus dem Klagerodel hervorgeht, kam es aber zu weiteren Überfällen. Am 14.3.1311 trafen sich die Parteien im Letzikloster in Zürich. Die Schwyzer bestimmten ihren Landamman
Konrad ab Yberg und den Amman Werner Tiring als Schiedsleute. Für das Kloster wirkten Jakob von Wart und Ritter Rudolf der Jüngere Mülner. Als Obmann wurde von beiden Seiten Ritter Rudolf der Ältere Mülner gewählt. Die Mülners waren ein einflussreiches
Rittergeschlecht. Beide saßen im Rat der Stadt Zürich und Rudolf der Jüngere war 1318 Schultheiss in Zürich.Bemerkenswert, dass Jakob von Warth der Bruder des Königsmörders von 1308, Rudolf von Warth war. Der Spruch sollte bis Johanni ergehen, also 24.6. Beide Seiten
die für die Einhaltung des Richtsspruchs bürgen sollten, stellten 10 Geiseln. Die Schwyzer sollten die geraubten Güter zurückgeben und Schadenersatz leisten. Sie hielten sich aber nicht daran. Die Streitereien gingen weiter. Am 24. Mai 1312 schloss Zürich
auf Geheiß König Heinrichs mit den Städten Konstanz,Schaffhausen und St. Gallen ein auf 4 Jahre befristetes Schutzbündnis ab. Die Städte mahnten die Schwyzer, einzulenken.
Inzwischen ging Heinrich auf die Habsburger zu und sicherte ihnen die Wahrung ihrer Rechte in den Waldstätten zu. Die Schwyzer mussten nun nachgeben. Die Sache wurde nun vor den Landvogt im Thurgau Eberhard von Bürglen gebracht. Die Mißhelligkeiten
zwischen Zürich und der Schwyz wurden beigelegt. Der Landvogt opferte aber die Ansprüche des Klosters. Dagegen ging das Kloster natürlich vor. Von weltlicher Seite war keine Unterstützung mehr zu erwarten. Also wandte sich das Kloster an den Offizialen des
Konstanzer Bischofs. Dieser ließ die Sache vor einem bischöflichen Gericht untersuchen. Darauf erfolgte wieder die Exkommunikation der Landammänner. Die Schwyzer klagten in der nächsten Instanz, das war der Metropolit von Mainz, also
die dem Konstanzer Bischof vorgesetzte Stufe. In Mainz war zu derzeit Peter von Aspelt (1306-1320) Erzbischof. Bis 1306 war er Bischof von Basel. Er war Parteigänger der Luxemburger und als Heinrich in Italien war, auch Reichsverweser. Mainz wies die
Appellanten aber an Konstanz zurück. Konstanz ermahnte die Schwyzer wieder zu Schadenersatz und Genugtuung. Die Schwyzer kümmerte das nicht. In der Diözese wurde nun Bann und Interdikt verkündet. Um das auch in Schwyz zu verkünden, wagte sich
niemand da hin. Die Lage spitzte sich weiter zu. Die Schwyzer setzten sogar ein Kopfgeld auf Abt Johannes aus. Auf dem oben erwähnten Italienzug erkrankte Heinrich an Malaria und starb am 24. August 1314 in Siena. Es kam nun zur Doppelwahl . In Aachen krönte
Peter von Aspelt Ludwig den Bayern zum König. In Bonn wurde der Habsburger Friedrich der Schöne vom Kölner Erzbischof Heinrich von Virneburg (1304-1332) am 25. November 1314 zum deutschen König gekrönt. Die Lage im Reich nützten die Schwyzer nun aus.
Vom 6.auf 7. Januar 1314 überfielen die Schwyzer das Kloster. Abt Johannes weilte in Pfäffikon und hatte dahin wohl auch die Einsiedler Urkunden in Sicherheit gebracht. Die Mönche wurden gefangengenommen und bis auf Johannes von Hasenburg und
Konrad von Buwenburg, die zu schwach waren, weggeführt. Auch der Schulmeister Rudolf von Radegg wurde mitgeschleppt. Er berichtet dies alles in seinen “Capella” Kirche und Kloster wurden geplündert, Vieh und Fuhrwerke wurden geraubt.
Bis auf Thüring von Attinghausen, für den sich mächtige Verwandte einsetzten, vor allem Werner von Attinghausen von 1294-1321 Landamman in Uri, der schon nach 10 Tagen frei kam , blieben alle bis zum 29. März 1314 in Gefangenschaft.
Der Habsburger Friedrich verhängte die Reichsacht über die Schwyzer, kam aber nicht dazu, sie zu vollziehen. Die Schwyzer nützten natürlich die unklare Lage im Reich und wandten sich an seinen Gegenspieler Ludwig. Dieser hob die Acht wieder auf und setzte sich
auch in Mainz dafür ein, dass die Konstanzer Maßnahmen wieder aufgehoben wurden. Das machte natürlich längere Untersuchungen notwendig.
Die Habsburger, waren zum einen die Schutzvögte von Kloster Einsiedeln und hatte zum anderen gerade in diesem Gebiet große Besitzungen und sahen natürlich ihre Interessen gefährdet. Friedrich beauftragte nun
seine jüngeren Bruder Herzog Leopold von Österreich gegen die Waldstätte vor zu gehen. Leopold plante wohl über Morgarten nach Schwyz vor zu stoßen. Er hatte auch die Vorstellung, dass Ritter gegen Ritter kämpfe. Den Rittern schwebte wahrscheinlich eine
Strafaktion gegen aufmüpfige Bauern vor. Es dürften wohl um die 5000 auf der Habsburger Seite gewesen sein. Am Morgarten gerieten sie in einen Hinterhalt und wurden geschlagen.
Die Schlacht fand am 15. November 1315 statt und das Habsburgische Heer erlitt eine vernichtende Niederlage. Zwischen den Amtleuten und Landleuten in den Waldstätten und den Herzögen von Habsburg kam ein Waffenstillstand am 19. Juli 1318 zustande,der immer wieder verlängert wurde. Erst in den Waffenstillstand am 6. November 1320 wird das Kloster ausdrücklich einbezogen und das auch für rückwirkend geltend erklärt. Das verhalf dem Kloster allerdings nicht zu seinem Recht. Auch kirchlicherseits kamen sie nicht
weiter. Sie hatten zwar am 17. November 1318 eine Bannbulle von Papst Johannes XXII erwirkt, musste aber auch auf Bitten des Vogtes darauf verzichten. Bischof Johannes von Straßburg war in der Bulle zum Richter ernannt worden und lud beide Parteien
am 26. März 1319 zu sich. Die Schwyzer erklärten aber, dass sie “wegen schwerer Gefährdung nicht in Strassburg erscheinen könnten”. Der Bischof bestätigte nun die verhängten Strafen. Durch den Verzicht des Klosters aber war alles hinfällig.
War die gesamte wirtschaftliche Lage in dieser Zeit ohnehin schwierig genug, so machte das alles natürlich noch schlimmer. Das Kloster geriet immer stärker in Schulden. Güter mussten verkauft werden, der Zehnte versetzt. Dennoch
hinterließ der Abt seinem Nachfolger 590 Pfund und 40 Gulden Schulden. Am 11. März 1327 starb Johannes und wurde im Grab seines Verwandten Anselm von Schwanden beigesetzt.
Auf ihn folgte Johannes II. von Hasenburg. Er war 1314 beim Überfall auf das Kloster dabei und wurde wie Konrad von Buwenburg nicht weggeführt. Er gehörte wahrscheinlich dem Willisauer Zweig der Freiherren von Hasenburg an, die ihren Stammsitz in Asuel im
Kanton Jura hatten. 1302 und 1303 errichteten die Herren einen befestigtes Zentrum anstelle des bisherigen Pfarrdorfs. In Urkunden von 1322 und 1326 tritt er als Zeuge auf und erscheint als Propst. Er wird, wie Bonstetten berichtet in Pfäffikon
zum Abt gewählt. Er tritt erstmals in einer Urkunde von 1327 auf, die ein Heymo zu Hasenburg, Kirchherr zu Willisau, siegelt. Für die Benediktion hatte er dem Bischof von Konstanz 10 Pfund und dessen Diener 3 Pfund zu zahlen. Vordringlichste Aufgabe war, die durch den
Marchenstreit und seine Folgen verursachten Schulden einzudämmen. Er ließ die Urbare erneuern. Das Große Urbar von 1331 ist noch erhalten, er ließ Hofrechte neu verzeichnen. Er rechnete mit den Gotteshausamtmännern ab, was in vielen Urkunden
dokumentiert ist. Die Stiftsgüter visitierte er persönlich. Er ließ Inventarien aufnehmen. Er konnte die Schulden seines Vorgängers und seine eigenen bezahlen. Den Hof in Illnau, den sein Vorgänger verkaufen musste, konnte er zurückkaufen und noch einige Güter
zurückkaufen. Er scheint eine glückliche Hand in weltlichen Dingen gehabt zu haben. Von 1330 bis 1331 wurde ihm die Verwaltung von Engelberg übertragen. In Engelberg hatte es 1306 einen Klosterbrand gegeben und auch dieses Stift war durch einen
Marchenstreit mit Uri stark beeinträchtig. Hier ging es um die Alpweiden jenseits des Surenpasses. Der Engelberger Abt Walter III. Amstutz war in dieser Zeit im Kloster Einsiedeln.
Am 13.08.1330 verpfändete Kaiser Ludwig für “20000 Mark Silber Konstanzer Gewichts die Städte und Burgen Zürich, Schaffhausen, St. Gallen und Rheinfelden mit Leuten, Gütern, Ehren, Rechten, Kirchensätzen, Gülten, Judensteuern, Nutzungen, [guten]
Gewohnheiten und Zubehör”. Dagegen wehrten sich Zürich und St. Gallen. In St. Gallen half der Abt. in Zürich setzten sich die Waldstätte ein, nach Ausweis seines Rechnungsbuchs auch Abt Johannes. Dass der Abt eine guten Ruf genoss zeigt, auch, dass er
von Werner von Batzenberg, einem Toggenburger Ministerialen mit der Vollstreckung seines Testaments betraut wurde. Um seine Gesundheit scheint es aber nicht gut gestanden zu haben. Er war ja schon 1314 nicht mitverschleppt worden
und nach ausweis seines Rechnungsbuch weilte er in den Jahren 1330 und 1332 in Baden zur Kur, würde man heute wohl sagen. Das Nekrologium von Fahr gibt den 21. Juli 1334 als Todestag an.
Sein Nachfolger wurde Konrad II. von Gösgen. Er stammte aus der Freiherrenfamilie Gösgen, die zwischen 1161 und 1400 bezeugt ist. Sein Vater war wohl Gerhard von Gösgen. Konrad begegnet uns ebenfalls bei dem Überfall der Schwyzer.
Er entkam bei dem Überfall als einziger und ging wahrscheinlich nach Pfäffikon zu seinem Abt.
Hatte das Stift unter Abt Johannes II.wieder ruhiger Zeiten gehabt, so konnte es sich nach den wenigen Jahre der Ruhe nicht aus den Streitigkeiten in seinem Umfeld heraushalten. An Kirchweih kam es in Einsiedeln zu einem Streit zwischen
Schwyzern und Dienstleuten der Grafen von Habsburg-Laufenburg-Rapperswil. Dabei wurden zwei Leute der Habsburger erschlagen. Möglicherweise ist das im Zusammenhang zu sehen mit dem Konflikt, den Bern mit einer breiten Koalition von Gegnern und den
Habsburgern hatte und der 1339 zum Laupenkrieg führte. Bern war mit den Waldstätten verbündet. Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg versöhnten sich mit den Leuten von Schwyz und ihren Verbündeten am 1.12. 1338. Das berührte das Kloster
aber nur soweit, als die Tat auf Klostergebiet stattgefunden hat. Es muss aber auch direkter Zwist zwischen Schwyzern und dem Kloster geherrscht haben. Die Landleute der Schwyz müssen wohl von Abt Johannes nach wie vor im Banne gehalten worden sein.
Der Konventuale Markwart von Bechburg, Kammerer des Stifts, wurde von Schwyzern gefangen genommen. Aus einer Urkunde vom 9.1.1342, die im Staatsarchiv Schwyz verwahrt wird (Urkunde 118) erfahren wir folgendes:
“Bruder Markwart von Bechburg, Kämmerer und Klosterherr zu Einsiedeln, gelobt beim Eide dem Landammann Konrad ab Jberg, Ammann Thiringer, Wernher Johanser, Johans an dem Velde, Ulrich Weidmann, Konrad Hug, Wernher Linsinger, Wernher von Stoufacher und Heinrich dem Schmid, dahin zu werben, dass zwischen dem Lande Schwyz und dem Gotteshause Einsiedeln eine Richtung geschehe“.
Gegeben zu Schwyz „in Heintzen Trütschen Hus an dem Sattel“ , am Mittwoch, „nach dem zwölf Tage“. Zwei Jahre später wurde das Kloster möglicherweise von den Schwyzern überfallen. Abt und Konvent befanden sich wohl in Pfäffikon.
Nur Rudolf von Zimmern befand sich allein im Stift. Er gab am 24. November 1344 das gleiche Versprechen wie Markwart ab. Schwerwiegendere Folgen vor allem für den Abt selbst, hatte die politische Umwälzung in der Stadt Zürich.
In Zürich stürzte Rudolf Brun, der Sohn von Jakob (von 1305-1309 Schultheiss in Zürich und Mitglied des “Sommerrats” der Stadt, in dem die einflussreichsten Familien Zürichs vertreten waren) am 7. Juni 1336 den im Rathaus versammelten Stadtrat.
Am nächsten Tag wurde Rudolf zum Bürgermeister auf Lebenszeit ernannt. Er setzte eine neue Verfassung, die “Brunsche Zunftverfassung” durch. Wer sich nicht beugte, wurde aus der Stadt vertrieben. Der Sohn Brunos, der die Einsiedler Pfarrei Rued im Aargau
innehatte, bat unter anderem Abt Konrad, die Verbannungsurkunde zu siegeln. Auch hatte er zusammen mit anderen Herren die getroffen Änderungen anerkannt.Die Verbannten flohen zu Graf Johannes von Rapperswil. Dieser fiel in der Schlacht bei Grynau.
Sein Sohn Johannes II. führte die Fehde fort. Um 1340 herrschte für kurze Zeit Frieden zwischen dem Grafen und Zürich. Die Fehde brach aber erneut aus. Im Sommer überfiel der Graf Pfäffikon, raubte es aus und führte auch den Abt gefangen weg.
Wie lange er in den Händen von Johannes II. war, lässt sich nicht genau sagen, aber am 26. Juni 1348 war sicher wieder frei, denn an diesem Tag wurde die Versöhnung zwischen Abt, Graf und der Stadt Raperswil in Zürich besiegelt. Am selben Tag
nahmen die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg nehmen das Kloster Einsiedeln in ihren Schutz und bestätigen ihm alle Rechte in ihrem Herrschaftsgebiet. (Chartularium Sangallense VII, Nr. 4091, S. 23 (Quellenwerk I/3, 781.)
Der Graf musste den angerichteten Schaden ersetzen. Dafür wollte der Abt sich verwenden, dass der Bann, der offenbar über den Grafen verhängt worden war, gelöst wurde.
Unter Abt Konrad wechselten mehrere Vogteien den Besitzer, auch über das Kloster selbst. Die Herzöge von Österreich hatten sie an die Markgräfin gegeben. Diese verlieh die Einkünfte daraus für vier Jahre an Abt Konrad.
Ähnlich wie für seinen Vorgänger sind auch für Konrad viele Abrechnungen mit Ammännern erhalten. Er schaffte es ebenfalls, einige Schulden zu tilgen. Die Ereignisse mit Graf Johannes, vor allem seine Gefangennahme, scheinen
seine Gesundheit untergraben zu haben. Er verstarb am 4. November 1348.
Für ihn wurde Heinrich III. von Brandis gewählt, aus einem hochfreien Geschlecht im oberen Emmental stammend. Wie er selbst sagte, suchte der Adel zu seiner Zeit nachgeborene Söhne in Klöstern zu versorgen. Seine Familie ist
dafür ein gutes Beispiel. Sein Bruder Eberhard war von 1349-1379 Abt der Reichenau, wobei er allerdings nach K. Beyerle die Aufbauarbeit seines Vorgängers Diethelms zunichte machte.
„Sinkende Klosterzucht, kaum zu überbietende Verweltlichung und zunehmende Mißwirtschaft kennzeichnen ihre Regierung“ . Das gilt auch für den Neffen Heinrichs, Mangold, der von 1382 bis 1385 Abt der Reichenau war und Heinrich
auch auf dem Konstanzer Bischofsstuhl nachfolgte.Mangold II ( gest.1372)war Landkomtur der Ballei Elsass-Burgund des Deutschordens und Werner II (gest. 1390) Landkomtur der Ballei Elsass-Burgund sowie Schwaben und des Aargaus.
Die Schwester von Heinrich war von 1330-1349 Äbtissin des Damenstifts Säckingen und eine Nichte, sie hieß auch Agnes, war 1367 Äbtissin in Masmünster (Masevaux.Haut-Rhin) Elsass.
Heinrichs Wahl erfolgte wohl noch 1348, war aber möglicherweise nicht unstrittig, denn am 1.1.1349 bezeugt Thüring von Attinghausen, der ja Abt in Disentis war, dem Bischof von Konstanz Ulrich Pfefferhard (1345-1351), dass in Einsiedeln nie
ein Subdiakon zur Abtwahl zugelassen worden war.
1349 ging in der der Schweiz die Pest um und forderte viele Opfer. Die Schwyzer waren ja immer noch im Kirchenbann. Außerdem stand für 1350 das große Jubiläum an. Die Zeit war also reif, einen Schlusstrich unter den Marchenstreit zu ziehen.
Auch der geeignete Vermittler stand bereit. Thüring von Attinghausen, er war Bruder von Johann von Attinghausen und gehörte also zu einer der einflussreichsten Familien der Innerschweiz. Im November brachte er einen Frieden zwischen dem
Kloster Disentis, Uri, Schwyz und Unterwalden zustande und auch an einem anderen Frieden der drei Länder, den Johann bewerkstelligte, war der Abt von Disentis vermittelnd tätig. Im Juni 1343 erreichte er einen Vergleich seines Klosters mit dem
dem österreichischen Landvogt von Glarus Walter von Stadion wegen der Landmarch.Thüring war ja 1314 Subdiakon in Einsiedeln. Am 8. Februar 1350 kam schließlich der Vergleich zwischen dem Kloster und den Landleuten von Schwyz zustande.
Eine neue Grenzlinie wurde gezogen und das Stift musste auf auf 110 Quadratkilometer Besitz verzichten, das war etwas mehr als sein bisheriger Besitz. Im Sihl und Alptal deckten sich die Grenzen größtenteils mit den 1217 gezogenen. Im Bibertal
wurde der größte Teil den Schwyzern zugesprochen. Die Urkunde wurde in Einsiedeln ausgefertigt. Als Zeugen waren der Abt von Pfäfers Hermann von Arbon, der ja bis zu seiner Abtswahl auch dem Konvent Einsiedeln angehörte, dann für den Johanniterorden
Herdegen von Rechberg. Die Johanniter hatten seit 1192 eine kommende in Bubikon. Dann war Peter von Stoffeln zugegen, Ritter des Deutschordens in der Ballei Elsass-Burgund, die vor kurzem auf Tanneburg in Nottwill eine Kommende errichtet hatte.
Aus Zürich war Ritter Heinrich Biber zugegen, der in Zürich Schultheiss war. Von den Waldstätten war Rudolf anwesend.
Die 1350 gezogenen Grenzen sind heute noch die Bezirksgrenzen zwischen Schwyz und Einsiedeln. Um zukünftigen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, bemühte sich das Kloster Güter und Gefälle
im Schwyzerland abzustoßen. Das Kloster bemühte sich auch um Lösung der kirchlichen Strafen.
Mit dem Vergleich zwischen dem Kloster und Schwyz, ging ein Streit zu Ende, der rund 250 Jahre gedauert hat. Das Kloster kam aber nicht zur Ruhe.
Am 4.10.1349 hatte Abt Heinrich in Wien mit Herzog Albrecht ein Burgrecht abgeschlossen. Der Herzog durfte die Veste Pfäffikon in Kriegszeiten “ohne Kosten und Schaden” nutzen und versicherte, sie nach dem Krieg wieder
unversehrt zurück zu geben. Dafür nahm der Herzog den Abt, seinen Nachfolger und die Leute des Klosters in seinen Schirm. Wie wir oben gesehen haben, waren nachdem Rudolf von Brun in Zürich Bürgermeister geworden war,
seine Gegner aus Zürich vertrieben worden. Viele von ihnen waren nach Rapperswil geflüchtet, da einige von ihnen Ministeriale des Grafen Johann I. von Habsburg-Laufenburg waren. Unter seinem Schutz hatten sie eine Gegenregierung des
“äußeren Zürich” (1336-1350) gegründet, warben Söldner an und suchten mit Streifzügen im Gebiet Zürichs die Lage zu destabilisieren. Gegen die in Zürich verbliebenen Gegner der neuen Stadtregierung wurde hart durchgegriffen.
Für die Nacht vom 23.auf 24. Februar war ein Handstreich auf die Stadt vorbereitet worden, der allerdings wohl durch Verrat dem Bürgermeister bekannt war. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, 15 Verschworene fielen, 35 wurden gefangengenommen und
dann zum Tode verurteilt. Auch der Rapperswiler Graf war in Gefangenschaft geraten und blieb zwei Jahre im Züricher Stadtgefängnis eingekerkert. Brun war mit seinen Truppen vor Rapperswil gezogen. In der Nacht vom 24. Februar wurde Rapperswil
gebrandschatzt, die Burg zerstört und die Mauern von Rapperswil geschleift. Die Züricher besetzten auch Gebiete in der unteren March. Damit hatten sie die Kontrolle über die Bündner Pässe. Nun waren auch die Interessen Herzog Albrechts
von Österreich direkt berührt und Habsburg-Österreich griff ein. Zürich brauchte nun neue Bundesgenossen und schloss am 1. Mai 1351 mit Luzern und den drei Waldstätten ein Bündnis. Es folgte nun ein regelrechter Kleinkrieg, der erst 1355
mit dem Regensburger Frieden zu Ende kam. Die Einsiedler Besitzungen am Zürichsee wurden im Laufe der Auseinandersetzungen schwer mitgenommen, ohne dass das Stift dafür je entschädigt wurde. Um die Schäden zu decken, griff Abt Heinrich zum einen zur
Kircheninkorporation, das ist die Zuweisung der Pfründe einer Pfarrkirche an das Kloster. Am 4.10.1349 wurde Brütten (zwischen Winterthur und Zürich)und am 3.12.1350 Riegel und Ettiswil (Kanton Luzern) inkorporiert. Das reichte nicht und so mussten
auch noch Güter verkauft werden. 1349 wurde der Dinghof in Untererlinsbach verkauft, 1353 folgte der Hof in Riegel und die Höfe in Ebnet, Schelingen und Eschbach.
Am 2.10.1253 bestätigte König Karl IV.(1346-1355, ab 1355 Kaiser bis 1378) auf Bitten des Abtes den Brief König Rudolfs über die Fürstenwürde des Abtes. Mit gleichem Datum verlieh er dem Abt die Regalien und setzte ihn in die Reichslehen ein.
Am 10.8.1353 stiftete Abt Heinrich zusammen mit dem Züricher Chorherren Heinrich Martin das Pilgerhospital in Einsiedeln. Es erhielt auch hohen Besuch durch Karl IV. als dieser wegen der Belagerung von Zürich in der Gegend war. Doch musste er dabei einige
Reliquien so einen Teil des Arms des heiligen Mauritius dem Veitsdom in Prag überlassen.
Es ist nun an der Zeit, einen Blick auf den Bischofstuhl in Konstanz zu werfen. Seit Gerhard von Bevar in Konstanz von Clemens V. zum Bischof ernannt worden war, weil sich das Kapitel nach dem Tod Bischof Heinrichs von Klingenberg nicht auf einen Kandidaten
einigen konnte und es zu einer Doppelwahl gekommen war, gewann der Papst in Avignon entscheidenden Einfluss auf die Besetzung des Stuhls in Konstanz. Die Servitien, die zu zahlen waren, das war die Bestätigungsgebühr für den Bischofsstuhl und betrug in der
Regel ein Drittel des Jahreseinkommens der Pfründe, schwächten die Finanzen des Bistums. Dazu kamen die Auseinandersetzungen zwischen Papst und Kaiser Ludwig dem Bayern. Auch 1334 war es wieder zu einer Doppelwahl gekommen. Der Zustand des Bistums
war desolat. 1352 wurde schließlich Johann Windlock Bischof in Konstanz. Ab 1449 war er Kanzler Herzog Albrechts von Habsburg. Der Herzog war der mächtigste Landesherr im Bistum und Johann Windlock wurde am 29. November 1351 zum Konstanzer Bischof
gewählt und am 9. Juli 1352 durch Papst Clemens VI. bestätigt.Bischof Johann versuchte durch Reformen und hartem Durchgreifen den beklagenswerten Zustand des Bistums zu ändern. Er scheute sich nicht, Widerstrebende, auch die mächtigsten und
einflussreichsten Geistlichen mit Interdikt zu belegen oder sogar zu verhaften. Natürlich schaffte er sich damit nicht nur Freunde. Am 21. Januar 1356 wurde er Opfer eines Attentats in seiner Residenz beim Münster. Inzwischen war Karl IV. deutscher König und
in Bamberg war Lupold von Bebenburg Bischof. Wegen der Territorialpolitik in Böhmen war das Verhältnis wohl nicht konfliktfrei und er sollte nach Konstanz transferiert werden. Doch Lupold lehnte ab. Da ernannte Innozenz VI. (1352-1362) den Einsiedler Abt Heinrich
zum Bischof von Konstanz, wo er keine allzu glückliche Regierungszeit hatte. Die gesamte Zeit war von harten Auseinandersetzungen überschattet. Er wurde sogar mal kurz des Amtes enthoben, aber nachdem sich Bischof und Stadt geeinigt hatten, wurde er 1372 ins
Amt eingesetzt. Kurz vor seinem Tod setzte ihn Gregor IX. 1382 ab. Heinrich starb am 22. November 1383 auf seinem Schloss in Klingnau im Aargau.
Nachdem Heinrich Bischof in Konstanz geworden war, hatte der Heilige Stuhl das Recht der Neubesetzung der Abtei. Nikolaus von Gutenburg wurde Nachfolger Heinrichs, wobei es möglich ist,
dass dieses auf Vorschlag von Heinrich geschah. Er war von 1357 bis 1364 Abt. Er stammte aus dem edelfreien Ministerialengeschlecht derer von Gutenburg, die möglicherweise aus Aarwangen im Kanton Bern stammten und jetzt ihren Sitz auf der
Gutenburg in Aichen, heute ein Stadtteil von Waldshut-Tiengen, hatten. Nikolaus ist seit 1328 auf der Reichenau nachweisbar und war dort Propst, nach Oehem war er auch Thesaurar. Auch für den Abtsstuhl waren Servitien zu entrichten. Abt Nikolaus
konnte dies aber innerhalb der Frist nicht zahlen. So verfiel er der Suspension, Exkommunikation und Irregularität, das Stift aber dem Interdikt. Erst am 3.12. 1359 quittiert der Erzbischof von Toulouse Stephanus den Empfang von
194 Florentiner Gulden, 39 Schilling und 6 Denaren, also die Annaten, die für den Einsiedler Abtsstuhl geschuldet waren. Dann erst wird er freigesprochen und ist rechtmäßig im Amt. In seiner Regierungszeit wurde eine Brücke zwischen Rapperswil und Hürden
gebaut, die für die Wallfahrt nach Einsiedeln bedeutend war. Herzog Rudolf IV. übertrug dem Vogt in Rapperswil Johann von Langenhart, der dieses Amt von 1347-1377 innehatte, die Baukosten von 1205 Gulden und verpfründet ihm dafür
die Nutzungsrechte über Rapperswil, Kempraten, Jona, die Mittelmarch, Altendorf, das Wägital sowie die Vogtei Einsiedeln. Auch Nikolaus inkorporierte Pfarreien, nämlich 1362 Stäfa, Ufnau, Eschenz. Dabei war ihm sein Amtsvorgänger Heinrich behilflich.
Auch weiter Verkäufe waren notwendig. Abt Nikolaus regierte nur 7 Jahre. Er starb am 5. März 1364. Mit seinem Nachfolger Markwart von Grünenberg besetzte wieder ein Mönch aus Einsiedeln den Abtsstuhl. Seine Abstammung ist nicht ganz sicher.
Sein Vater war wahrscheinlich Johann I. von Grünenberg genannt der Grimme und seine Mutter Freifrau Clementia von Signau. Die Freiherren von Grünenberg waren eine weitverzweigte Adelsfamilie im Oberaargau, im Elsass, im Markgräflerland und im Breisgau.
Markwart war in einem Burgenkomplex von drei Burgen in der Gemeinde Melchnau im Kanton Bern zuhause. Er war wohl schon unter Abt Johannes I. ins Stift Einsiedeln eingetreten. Auch sein Bruder Peter findet sich unter den Mönchen. Markwart wird schon am
31. Mai 1330 als Propst von Fahr erwähnt. Er erscheint auch 1339 bei einem Tausch von Leibeigenen mit Kloster St. Blasien. Bis 1356 erscheint er immer wieder in Urkunden. Die Bestätigung einer Stiftung am 21.1. 1356 ist seine letzte Amtshandlung als Propst.
Dann erscheint erst wieder 1364 als Abt.Erst sehr spät stellte Kaiser Karl dem Abt einen Schutzbrief aus, nämlich erst am 5. August 1375 in Prag. Möglicherweise spielte für diese späte Ausstellung die große Entfernung eine Rolle.
In diesem Brief nimmt der Kaiser den Abt und das Kloster in seinen Schutz und verfügt, dass dessen Leute vor kein fremdes Landgericht gezogen werden sollen. Diesen Brief ließ der Abt am 2. Oktober 1375 vor dem thurgauischen Landgericht zur
Vidimation und Anerkennung vorlegen. Der Friede von Regensburg 1355 und der Friede von Thorberg, den Peter von Thorberg zwischen Habsburg und Eidgenossen 1368 vermittelt hatte, brachte Abt und Stift wieder ruhigere Jahre. Auch eine
finanzielle Erholung ist zu verzeichnen, was daraus zu ersehen ist, dass das Kloster die Herrschaft Reichenberg in der March für 1200 Gulden erwerben konnte. Verkäufer war der Rapperswiler Bürger Rudolf Tumpter, der sie seinerseits von
Ulrich von Aspermont und dessen Sohn gekauft hatte. In eine Fehde konnte der Abt noch vermittelnd eingreifen. Heinrich und Johannes Scheitler aus Uri hatten Gottfried, den Bruder von Rudolf IV. von Habsburg-Laufenburg in Einsiedeln gefangen genommen
weil er den beiden wohl Kaufmannsgüter weggenommen hatte. Abt Markwart erreichte, dass der Gefangene in Einsiedeln verblieb, bis der Handel abgeschlossen war. Nachdem er für sich und seine Brüder Urfehde geschworen hatte, wurde er
am 1. Oktober 1370 wieder in Freiheit gesetzt.
Die Wallfahrt blühte. Um 1370 hört man von Pilgern aus Lübeck und Nürnberg und zwar solchen, die die Wallfahrt stellvertretend für andere unternahmen. 1376 wird die Pilgerschiffswallfahrt auf dem Vierwaldstätter See zum ersten Mal erwähnt.
Am 18.Oktober 1376 starb Abt Markwart in Fahr, wie dem Totenbuch von Fahr zu entnehmen ist.
Auf ihn folgte Peter II. von Wolhusen, der zweite Einsiedler Abt aus dem Geschlecht der Freiherren von Wolhusen. Er war wohl schon 1356 im Kloster, denn er erscheint in dem von Heinrich von Ligerz aufgestellten Katalog. Aber schon 1360 bekleidete er drei
Klosterämter, nämlich Kantor, Kustos und Kämmerer zugleich. Das muss nichts mit den Talenten des noch jungen Mönchs zu tu haben, sondern weist auf ein anderes großes Problem, mit dem das Kloster zu kämpfen hatte, dem Nachwuchsproblem.
Schon zu Zeiten des Überfalls der Schwyzer auf das Stift zählte der Konvent gerade mal 6 Mitglieder und 1356 waren es zehn. Das hing natürlich damit zusammen, das seit etwa 1200 nur Hochadelige ins Stift aufgenommen wurden,
ähnlich wie in St. Gallen oder auf der Reichenau. Logische Folge war zum Beispiel auf der Reichenau 1427, dass gerade noch zwei Mönche im Kloster waren, nämlich Neffe und Onkel und dieser hochbetagt. Auch Einsiedeln schien gegen Ende des 14.
Jahrhunderts vom Aussterben bedroht. So war eigentlich in Einsiedeln nicht allzu viel vom Aufschwung zu spüren, den die Benediktiner in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wieder verspürten. Startsignal war sozusagen die Bulle “summi magistri
dignatio” von 1336, die Papst Benedikt XII. (1334-1342) erlassen hatte, und die nach ihm auch einfach “Benedictina” genannt wird. Vor Benedikt Papst wurde, war er Zisterziensermönch. Die Bulle schärfte den Benediktineräbten eine geordnete Güterverwaltung ein.
Er verpflichtete die Äbte zu einer soliden Ausbildung der Novizen und ermutigte zum Hochschulstudium der Mönche. Alle zwei Jahre sollten Provinzkapitel stattfinden, die sich mit wirtschaftlichen, religiösen und disziplinären Fragen der Reform,
mit deren Durchführung und langfristigen Sicherung befassen sollten. Konkret wurde das in Kastl, Melk und Bursfelde im deutschsprachigen Raum. Abt Peter wurde schnell mit einem anderen großen kirchlichen Problem
konfrontiert, dem abendländischen Schisma, das 1378 ausbrach. Verschärft wurde das durch den Konflikt zwischen Habsburg und den Eidgenossen. Die Eidgenossen unterstützten den Papst in Rom Urban VI., der am 8.4. 1378 in Rom gewählt worden
war. In Fondi wurde am 20.9. Kardinal Robert von Genf gewählt, der sich dann Clemens VII. nannte. Dieser musste sich aber bald nach Avignon zurückziehen. Frankreich, Süditalien, Schottland und Spanien stützen Clemens VII., während der Papst in Rom
von Mittel-und Norditalien, dem Heiligen Römischen Reich und England anerkannt wurde. Herzog Leopold von Habsburg, der in den habsburgischen Stammlanden regierte, hatte sich für den Papst in Avignon ausgesprochen. Peter anerkannte den Papst in Rom.
Beginnen wir aber mit seinem Karrierestart. Um 1364 war er Stellvertreter des Propsts von Fahr, Rudolf von Pont. Dieser hatte auch gleichzeitig die Propstei von St. Gerold im Großen Walsertal inne. Als er 1372 oder 1373 starb, folgte ihm Peter als Propst nach.
Dort kümmerte sich vor allem um die Instandstellung der Gebäude. Die Mühle ließ er 1373 neu aufbauen. Er ließ auch ein neues Messbuch schreiben. Dort wurden auch dies Instandhaltungsarbeiten vermerkt. 1376 wurde er zum Abt von Einsiedeln gewählt.
Die Stellungnahme für den römischen Papst war sicher eher politischen als religiösen Überlegungen geschuldet. Schon um 1381 beauftragte ihn der Papst, für die Wahrung der Rechte der Abtei St. Gallen zu sorgen. Peter delegierte diesen
Auftrag an den Abt von Rüti, Heinrich. Schon vor Ausbruch des Schismas hatte Herzog Leopold von Österreich am 19. 3. 1377 “den Abt und das Gotteshaus von Einsiedeln, deren Leute und Güter und Diener in seinen Schirm genommen”.
Auch König Wenzel, der nach dem Tod Karls IV. 1378 deutscher König geworden war, bestätigte dem Abt am 25.6.1381 in Frankfurt “alle Rechte, Freiheiten, Gnaden und gute Gewohnheiten”. Am 10. Oktober 1386 stellte Papst Urban VI. das Gotteshaus Einsiedeln mit
allen Personen und Gütern unter den Schutz von St. Petrus und des apostolischen Stuhls und nur 6 Tage später am 16.10. bestätigte er dem Kloster alle Rechte und Freiheiten, wie sie 1291 von Papst Nikolaus IV. verliehen worden waren.
Schon 6 Jahre vorher hatte der Kardinallegat von Papst Urban Pileus kraft seines Amtes alle Schreiben der Bischöfe an den Abt und das Kloster Einsiedeln bestätigt.
Im politischen Umfeld des Klosters standen die Dinge nicht mehr so gut für die Habsburger. Abt Peter ging am 1. 10. 1386 ein Burgrecht mit Zürich ein. Der Bürgermeister und der Rat von Zürich bekundeten, dass sie Abt Peter und die Leute von Pfäffikon
als Bürger angenommen haben. Das war auf 10 Jahre befristet. Dafür durften sie die Veste Pfäffikon einnehmen. Das verhinderte allerdings nicht, dass die Stiftsgüter im Sempacher (9. Juli 1386)und Näfelser (9.April 1388) Krieg stark geschädigt wurden.
In der Schlacht von Sempach war Herzog Leopold gefallen. Die Schlacht von Näfels war die letzte bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Habsburg und Eidgenossen.Die erneuten Schäden zwangen auch Abt Peter zu Veräußerungen,
um sich der Schulden zu erwehren.
Das Todesdatum Abt Peters ist der 23. April. Das Jahr ist nicht sicher. Seine letzte Urkunde wurde am 10. Januar 1386 ausgestellt. Der neue Abt urkundete erstmals am 14. August 1387. Also muss Abt Peter entweder 1386 oder 1387 verstorben sein.
Ihm folgte Ludwig von Thierstein nach. Er gehörte zur Familie der Grafen von Thierstein und zwar zur Seitenlinie Thierstein-Farnsburg, die auf der Farnsburg von Ormalingen saßen. Sie hatten die Landgrafschaft Sisgau inne. Der genaue Amtsantritt von Abt Ludwig
steht nicht fest. Nach der Schlacht von Näfels kam es 1389 zu einem Friedenabschluss, der zunächst 7 Jahre gelten sollte, aber schon 1394 um zwanzig Jahre verlängert wurde. Die Habsburger verzichteten auf ihre Rechte in Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zürich,
Zug, Bern und Glarus. Abt Ludwig ging mit Zürich auf zehn Jahre ein Burgrecht ein. Zu seinem Amtsantritt übernahm Ludwig 2200 Gulden an Schulden. Doch die Schulden nahmen zu. Innerhalb von 4 Jahren erhöhte sich der Berg um weitere 3000 Gulden.
Alle entbehrlichen Güter und Kirchenschätze sollten veräußert werden. Nicht hilfreich war, dass die Päpste in dieser Zeit fremden Klerikern Anwartschaften auf Pfründe des Klosters erteilten. Auch die weltlichen Herrscher standen da nicht
zurück. Das erste was das Stift von Rupprecht von der Pfalz (1400 bis 1410 deutscher König) hörte, war das Gesuch um die Versorgung eines Klerikers aus der Diözese Konstanz. Die Schutzbulle, die Papst Bonifaz IX. am 11.4.1401 wie Papst Urban VI.
15 Jahre zuvor erteilte, schützte natürlich vor der finanziellen Bedrängnis nicht. Damit nicht genug hatte sich Abt Ludwig auch noch um den Straßburger Bischofsstuhl bemüht, um den im Jahre 1393 heftig gestritten wurde und wofür Ludwig
auch noch größere Summen aufwenden musste. Als die Lage ziemlich ausweglos geworden war, vereinbarte Ludwig 1396 mit seinem Konvent, der zu diesem Zeitpunkt gerade noch aus drei Mitgliedern bestand, dass er die Verwaltung des Klosters für 10 Jahre
niederlegte. Die Verwaltung wurde an Hugo von Rosenegg übertragen. Der Abt sollte, falls er im Lande blieb, 200 Gulden jährlich sowie eine Reihe festgelegter Naturalien erhalten. Der Text der darüber am 3.2.1396 in Zürich ausgestellten Urkunde klingt allerdings
recht schroff: “Vertrag des Kapitels zu Einsiedeln mit seinem übel haushaltenden Abte Ludwig von Thierstein, dass er 10 Jahre lang vom Lande fahren, und die Veste Pfäffikon weder besuchen noch bewohnen dürfe; einzig der Pfleger an seiner Statt, Hugo von
Rosenegg, darf Pfäffikon inne haben.”
Der Abt blieb nicht nur im Lande sondern mischte sich weiter in die Verwaltung der Stiftsgüter ein. Noch am 14.1.1402 stellte er eine Verleihungsurkunde aus. Er starb am 10. Oktober 1402.
Hugo stammte aus der Freiherrenfamilie von Rosenegg. Die Burg Rosenegg lag im Hegau in Der heutigen Gemeinde Rielasingen-Worblingen. Hugos Vater war Johann, der 1362 österreichischer Landrichter in Konstanz und von 1372-1376 im Thurgau war.
Hugo hatte drei Brüder. Werner war von 1385-1402 Abt auf der Reichenau. Heinrich war Hauptmann der Rittergesellschaft vom Jörgenschild. Er wohnte zusammen mit seinem Bruder Hans auf Wartenfels, das durch die Heirat ihres Vaters mit einer von Tengen in die
Familie gekommen war. Hugos beide Mitbrüder Werner von End, der mit ihm zusammen mit Abt Ludwig den Verzicht auf die Klosterverwaltung vereinbart hatte und Burkhard von Krenkingen wählten ihn zum neuen Abt.
Am 23.10. 1402 schloss er das Burgrecht mit Zürich auf 10 Jahre ab. Am 14. März 1408 bestätigte König Ruprecht in Konstanz Abt Hugo die Privilegien des Kloster “Rechte, Freiheiten, Gnade und gute Gewohnheiten, Privilegien, Handfesten und Briefe”.
Auch das Asylrecht bekräftigte er.
Aus zwei Päpsten waren mittlerweile drei geworden. Es gab verschieden Möglichkeiten, das Schisma zu beenden. Das eine wäre die militärische Gewalt gewesen. Dann wäre eine freiwillige Abdankung möglich gewesen oder der Weg eines Kompromisses und
schließlich ein Schiedsgericht, also die Unterwerfung unter die Entscheidung eines Konzils. Die Universität von Paris, die damals bedeutendste Bildungseinrichtung des Abendlandes hatte diese Wege vorgeschlagen. 1407 kam es in Savonna zu Verhandlungen
zwischen beiden Obödienzien. Das Kardinalskollegium trennte sich danach nicht. 17 Kardinäle riefen in Livorno am 35. März 1409 ein Konzil in Pisa einzuberufen. Über 600 Kleriker kamen nach Pisa. Die beiden im Moment regierenden Päpste
beriefen aber jeweils eigene Konzilien ein, die es aber bei weitem nicht auf so viele Teilnehmer brachten. Am 5. Juni 1409 setzte das Konzil in Pisa die beiden Päpste ab und wählte am 24. Juni 1409 den Mailänder Kardinal Pietro Philargi von Candia zum Papst.
Er nannte sich Alexander V. – nur die beiden anderen Päpste traten nicht ab. Nun gab es also drei Päpste. Alexander starb allerdings schon am 3. Mai 1410. Ihm folgte Baldassare Cossa als Johannes XXIII. nach. Die Obödienzen der
abgesetzten Päpste waren stark geschrumpft. Auch Einsiedeln hatte wohl die Obödienz in Pisa anerkannt, denn am 31. Mai 1410 bestätigte der Pisaner Papst Johannes XXIII. in Bologna alle Privilegien und Freiheiten des Klosters Einsiedeln.
Abt Hugo wahrte die Rechte des Stift. Er schaffte es, ausstehende Zinsen einzubringen. Zwar musste auch er noch zu Verkäufen greifen, doch die finanzielle Lage des Stifts war wieder konsolidiert wie Bonstetten vermerkt:
“verliess darzu an barschaft zway und dreissig tausent Gulden” Auch die Wallfahrt nahm unter Abt Hugo weiter Aufschwung. Pilger aus den Hansestädten und den Niederlanden kamen öfters nach Einsiedeln.
Auch König Sigismund, der ja auf dem Konzil anwesend war, war 1417 in Einsiedeln.
Eine große Wallfahrt wurde 1411 von Basel veranstaltet, als in Basel die Pest grassierte. Wichtiges Ereignis war natürlich das Konzil von Konstanz von 1414-1418, an dem wie wir wissen, auch Abt Hugo teilgenommen hatte. Ob Hugo an den von Papst
Benedikt XII. geforderten Provinzkapitel teilnahm, ist nicht nach zu weisen. Aber er hatte wohl auch andere Probleme. Es waren nur noch drei Konventualen im Stift und die Misswirtschaft seine Vorgängers war ja auch zu bewältigen.
Am großen Provinzkapitel in Peterhausen, das im Februar 1417 praktisch im Rahmen des Konzils stattfand, war er dabei. Die Konzilsversammlung hatte das Kapitel einberufen. Der Chronist des Konstanzer Konzils Ulrich Richental zählte
78 teilnehmende Äbte und 48 weitere Abgesandte anderer Abteien. Die Tagung dauerte drei Wochen und endete mit einer feierlichen Prozession.
Abt Hugo wird letztmals am 21.4.1418 urkundlich erwähnt, als Heinrich Eschli aus dem Euthal angibt, dass ihm von Abt Hugo eine Schweig geliehen worden sei. Am 16. Oktober 1418 starb er in Pfäffikon.
Auf ihn folgte Burkhard von Krenkingen-Weissenburg. Er war schon bei der Vereinbarung mit Hugo und Ludwig dabei und möglicherweise wurde er gar nicht gewählt, denn er war, was nicht ganz fest steht, vielleicht
sogar der einzige noch vorhandene Konventuale. Walter von End starb wahrscheinlich kurz nach 1416. Erst 1428 erfahren wir von 4 Herren. Ein gemeinsames Ordensleben nach der Ordensregeln gab es nicht mehr. Das Stiftsgut war in Pfründen
aufgeteilt.
Am 20.11. 1418 ging er mit Zürich ein Burgrecht ein und zwar auf Lebzeiten. Am 9. Februar 1424 verlieh König Sigismund in Ofen an Schwyz die Vogtei über Kloster Einsiedeln. Ital Reding, der Älter (1370-1447)Landamman von Schwyz
war deshalb eigens nach Ofen gereist.Ital Reding und Sigismund kannten sich ja bereits. In Konstanz war Reding eidgenössischer Gesandter an das Konzil. 1415 verlieh Sigismund in Konstanz die Blutgerichtsbarkeit für Schwyz.
Die Vogteiverleihung scheint nicht einvernehmlich mit dem Abt geschehen zu sein. Aber machen konnte er nichts.
Das Stiftsgut war in Pfründen aufgeteilt. 1428 nahm auch Burkhard eine solche Einteilung vor. Richard von Falkenstein erhielt die Kustorei, Rudolf von Sax die Kammerei, dessen Bruder, Gerold von Sax, die Kantorei und Franz von Rechberg die Propstei Fahr.
Er behielt sich aber vor, diese bei schlechter Verwaltung wieder an sich ziehen zu können.
Als der König im Dezember 1430 in Überlingen war, versuchte Abt Burkhard über seinen Onkel Hans von Lupfen, Hans von Klingenberg, der kaiserlicher Rat bei Sigismund nach dessen Kaiserkrönung war und Hauptmann der Rittergesellschaft vom Jörgenschild,
die Übertragung der Vogtei von 1424 rückgängig zu machen. Auch der Fürst von Braunschweig verwandte sich für den Abt. Zwar verlieh der König am 13.12.1430 die Regalien und übergab diese dem Bevollmächtigten des Abts, dem Leutepriester auf der Ufnau Kaplan Reinhard Stahler, da der Abt “wegen vielen Geschäften sich nicht persönlich vor dem Kaiser stellen konnte”. Einen Tag später, am 14. 12. bestägtite Kaiser Siegmund “auf Anhalten seines Fürsten, des Abts Burkard von Einsiedeln, alle Rechte, Freiheiten u.s.w. dieses Klosters, besonders die von Karl IV. ertheilten, dass man seine Leute vor kein fremdes Landgericht lade, und Aechter halten möge; auch nimmt er das Gotteshaus und dessen Leute in des Reiches besondern Schirm.”(nach Regesta imperii XI/2, Nr. 8012) In Sachen Vogtei
hatte der Abt aber keinen Erfolg. Am 9. 1.1433 bat der Abt erneut um Aufhebung der Bullen und verwies auf die Vermittlung der Herren von Lupfen, Klingenberg und Braunschweig in Überlingen. Erst am 22. Oktober 1431 in Feldkirch hatte der Abt Erfolg. Der König
nahm das Kloster erneut in des Reiches Schutz, widerrief den Brief, in dem er Schwyz die Vogtei verliehen hatte und verbot “bei Androhung seiner Ungnade” von diesem Recht Gebrauch zu machen. Das gefiel natürlich den Schwyzern nicht und sie unternahmen
Schritte dagegen.
In Basel tagte mittlerweile das Konzil von 1431-1449, das von dem in Konstanz gewählten Papst Martin V. einberufen worden war. Sorge um den Glauben, Herstellung des Friedens in der Christenheit und Reformen sollten auf der Tagesordnung stehen.
Auch Sigismund, seit März 1433 Kaiser, hatte zum Kaiserlichen Tag, also einem Reichstag auf den 30.11. 1433 nach Basel geladen. Abt Burkhard und Abgesandte der Schwyz waren natürlich in Basel vertreten. Am 11.12.1433 stand der Streit
zwischen Abt Burkhard und dem Lande Schwyz auf der Tagesordnung.Kaiser Sigismund erzählte ”den ganzen Hergang dieses Geschäfts. Dieses geschah in Beisein des Abts Burkard, des Ammann Itel Reding und einer Menge Reichsfürsten, Grafen, Herren und Doktoren, deren
viele genannt sind.” Zwar entkräftete er nochmals den Brief von 1424, in dem Schwyz die Vogtei zu gesprochen worden war, und er versicherte, dass er dem Abt und Konvent nie einen anderen Vogt setzen werde. Anderseits verfügte er, dass dem Lande Schwyz
die Vogte über Einsiedeln zugehöre, wie sie früher von der Herrschaft Österreich ausgeübt wurde. Die Schwyzer sollten dem Kaiser in einem besiegelten Brief bestätigen, dass sie das Gotteshaus bei seinen alten Rechten und Freiheiten lassen würden.
Am selben Tag bestätigte der Kaiser nochmals die Privilegien des Klosters Einsiedeln.
Am 14.3. 1434 gaben” Ammann, Rat und Gemeinde des Landes zu Schwyz“, dem Abt und Gotteshaus zu Einsiedeln die Versicherung, sie bei allen ihren Rechten und Freiheiten bleiben zu lassen, und sie hiebei zu schirmen, wie solches in einer goldenen Bulle des
Kaisers Sigmund verlangt wird. Am 19.3. legte der Abt vor dem kaiserlichen Notar Leonard Valk seinen Protest nieder. Als Zeugen traten unter anderem auf der Leutprister Stahler von der Ufnau, der ja schon in Überlingen für den
Abt tätig war und Abt Johann Schwarzmurer von der Zisterzienserabtei Wettingen. Der Abt ließ bekräftigen, dass die “Annehmung des Schirmbriefs dem Gotteshaus nicht solle schädlich sein”. Am 14.4.1434 bestätigte Sigmund den Schutzbrief der Schwyz.
Damit war die Vogtei endgültig an das Land Schwyz übergegangen, das es bis 1798, also bis die “Helvetische Republik” die Eidgenossenschaft ablöste, innehatte.
Im Frühjahr 1425 versammelten sich 41 Äbte und Pröpste ordensübergreifen aus Klöstern des Bistums Konstanz. Einer der Initiatoren war wohl Heinrich Merk, der von 1417-1430 Abt der Prämonstratenserabtei Rot an der Rot war. Nach dem Vorbild der Städte-und
Ritterbünde wurde eine Konfraternität geschlossen. Man wollte sich gegen ungebührliche Forderungen der päpstlichen und bischöflichen Kurie schützen und klösterliche Rechte gegen die Einmischung adliger Verwandten von Klosterangehörigen sollten gewahrt
werden. Aus jedem der 4 vertretenen Orden wurde ein Vertreter gewählt. Beiträge an eine gemeinsame Kasse wurden festgelegt, aus der die Reiseauslagen bestritten wurden. An die Beschlüsse der 4 Vertreter war die gesamte Konfraternität gebunden.
Die Bruderschaft war zunächst auf 12 Jahre geschlossen worden. Neben diesen praktischen Beschlüssen wurden auch eine Reihe geistliche Beschlüsse getroffen. Am St. Urbanstag, also dem 25. Mai 1425 wurde das Bündnis von allen Prälaten besiegelt.
Abt Burkhard stand an der Spitze der Brüderschaft.
Am 8.12.1426 bestätigte Papst Martin V. die Privilegien des Klosters Einsiedeln. Kurz danach stand der nächste Streit an. Der Konstanzer Bischof Otto III. von Hachberg (1410-1434)wollte verhindern, dass Pilger an der Gnadenstätte in Einsiedeln
die Sakramente einnehmen konnten und berief sich dabei auf ein Dekret der Lateransysnode von 1215, das bestimmte, dass kein Gläubiger ohne Erlaubnis seines Pfarrers bei einem fremden Priester beichten dürfe. Abt Burkhard bat die
Eidgenossen um Vermittlung. Am 11.3. 1432 erteilte Papst Eugen Abt Burkhard die Erlaubnis, den Pilgern der Marienkapelle die Sakramente der Busse und Eucharistie zu spenden. Die Erlaubnis war zunächst auf 10 Jahre beschränkt. Gegen diese
Verfügung beschwerte sich Otto vor dem Konzil. Abt Burkhard wurde nun vors Konzil geladen. Auch Rom ließ die Sache nochmals untersuchen und beauftragte die Bischöfe von Chur und Cervina damit. Da aber der Papst Otto 1434 von seinem Bistum entband,
erledigte sich dieser Fall. Die Wallfahrt nahm weiteren Aufschwung. Er hatte einige Rechtsstreitigkeiten.
Burkhard ließ den Kreuzgang neu erstellen und ließ ein neues Abteigebäude bauen. In Pfäffikon wurde die Weißenburg erbaut. Er ließ einen silbernen Reliquienschrein erstellen. Dann ließ er das nach ihm benannte Burkhardenbuch anlegen. Das war ein
Kopiebuch, in dem die wichtigsten Urkunden des Stifts eingetragen wurden. Am 21. Dezember 1438 verstarb er.
Am 31. Dezember 1438 wurde Rudolf III. von Sax zum neuen Abt gewählt. Er ist uns schon am 16.4. 1428 begegnet, als Abt Burkhard die Klosterämter von Einsiedeln unter den 4 verbliebenen Konventualen verteilt hatte.
Pater Rudolph Henggeler überschreibt diesen Abschnitt von rund 150 Jahren Einsiedler Klostergeschichte mit “Das Stift als Familienpfründe” und das ist es ja wohl, kurz und bündig. Rudolf war der 5. Sohn des Freiherren Ulrich Eberhard von Sax und seiner
Gemahlin der Gräfin Elisabeth von Werdenberg-Sargans. Die Familie von Sax stammte aus einem rätischen Hochadelsgeschlecht, das sich schon in staufischer Zeit in drei Linien geteilt hatte. Damals war Ulrich von Sax als Abt in St. Gallen tätig und reorganiserte
die Verwaltung des Klosters. Die Familie hatte die Vogteien über Disentis, Pfäfers und Clanx inne. Auch in Disentis regierte um 1330 mit Martin von Sax ein Abt aus dieser Familie.
Rudolf stammte aus der Linie Sax-Hohensax. Die Abtweihe fand wohl kurz nach seiner Wahl statt. Mit Bischof Heinrich IV. (1436-1462)hatte er sich auf die Zahlung der Servitien geeinigt. Sie sollten 800 Gulden betragen. Schon am 3.2.1439
ging er mit Bürgermeister und Rat der Stadt ein Burgrecht auf Lebzeiten ein. Er sollte seine Veste Pfäffikon öffnen und jährlich zum Martinstag 10 Goldgulden Burgrechtssteuer entrichten. Am 12.9.1442 verlieh ihm Friedrich III. (1440-1493)
die Regalien und bestätigte die Privilegien des Klosters.
Noch zu Lebzeiten von Abt Burkhard hatte sich der alte Zürichkrieg angebahnt. Zum einen ging es um die Vorherrschaft um die Vorherrschaft zwischen Schwyz und Zürich im Gebiet rund um den Zürichsee und das Linthgebiet. Der Züricher
Bürgermeister Rudolf Stüssi (Bürgermeister von 1430-1443) verfolgte eine klar expansionistische Politik. Ziel war die Beherrschung des gesamten Zugangs zu den Alpenpässen zwischen Baden und Sargans. Zunächst konnte der Streit friedlich
beigelegt worden. Am 14. April starb Graf Friedrich VII. von Toggenburg. Er hatte kein Testament hinterlassen, aber viele sich auch widersprechende Zusagen gemacht. Zürich besetzte gleich Pfäffikon während Schwyz seine Truppen nach Einsiedeln
in die March und nach Uznach legte. Die Gräfin Elisabeth von Matsch, die Witwe des verstorbenen Grafen hatte ihr Erbe im April 1437 an ihren Bruder Ulrich und ihren Vetter Ulrich von Matsch überschrieben mit der Auflage, es gerecht aufzuteilen.
Unter Vermittlung des Berner Schultheissen Rudolf Hofmeister und dem Schwyzer Landamman Ital Reding wurde das Erbe an verschieden Adelsherrschaften aufgeteilt. Zürich war leer ausgegangen. Als Reaktion verhängte Zürich eine Getreidesperre
gegen Schwyz und Glarus. Der Winter 1437/38 war sehr streng und zog ein Hungerjahr nach sich. Da wirkte sich so eine Getreidesperre natürlich hart aus. Die Situation eskalierte und im Mai 1439 kam es zu blutigen Zusammenstößen am Etzel.
Zürich wurde zurückgeschlagen und es kam zunächst zu einem Waffenstillstand. Im November 1440 kamen die Züricher mit 6000 Mann nach Pfäffikon. Inzwischen hatten sich die Truppen von Uri, Schwyz und Unterwalden vereint, was auch die Zürichern
erfuhren. Sie zogen sich aus Pfäffikon zurück. Die Schwyzer befragten nun die Hofleute unter Eid über die Hofrodel. Diese bejahten, dass dieser richtig sei. Daraufhin zogen die Schwyzer die Vogtei an sich.
Am 1.12. 1440 wurde der Kilchbergische Vertrag zwischen Zürich und Schwyz,den Graf Hugo von Montfort vermittelt hatte, in Luzern beurkundet. Am 1. Januar 1441 verhandelten Schwyz und Zürich erfolglos. Die Lage verkomplizierte sich weiter.
Am 2. Februar 1440 war Friedrich III. von den deutschen Kurfürsten zum König gewählt worden. Anlässlich der Krönung zum König schloss Zürich mit Friedrich in Aachen einen Vertrag ab. Zürich sollte Teile der Grafschaft
Kyburg an Friedrich zurückgeben. Dafür war Friedrich bereit, als König die Privilegien der Stadt Zürich zu erneuern und die restliche Herrschaft der Stadt anzuerkennen. Auch Rapperswil hatte sich mit Friedrich verbündet. Im September weilte Friedrich in
Zürich um die Huldigung der Stadt entgegen zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit waren auch die Regalien an Abt verliehen worden. Zwischen dem 1.und 4. Mai 1443 wurde in Einsiedeln nochmals erfolglos versucht, den Frieden wieder her zu stellen.
Am 22. Mai 1443 in Freienbach und am 24. Mai am Hirzel trafen die eidgenössischen und die Heere Friedrichs und Zürichs aufeinander. Beides Mal behielten die Eidgenossen die Oberhand. Da die Heuernte war, zogen sich Schwyz zurück, um nach der Ernte wieder zu
kommen. Sie waren aber nicht stark genug, um Zürich ein zu nehmen. Aber die Züricher erlitten am 23. Juli in der Schlacht bei St. Jakob an der Sihl eine vernichtende Niederlage. Bürgermeister Stüssi fiel auf der Sihlbrücke.
Auch Rapperswil konnte nicht eingenommen worden. Abt Rudolf und Bischof Heinrich IV. von Hewen vermittelten einen Waffenstillstand von acht Monaten. Niemand kümmerte sich aber darum. Auch Friedensverhandlungen in Baden kamen nicht voran.
Die Belagerung von Rapperswil dauerte von April 1444 bis Dezember 1445. Das stiftische Gebiet wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Besitzungen in Fahr hatten zu leiden. Die Kirche von Weiningen wurde sogar niedergebrannt.
Endlich kam es im Juni 1446 zu einem Waffenstillstand. Allerdings dauerten die Friedensverhandlungen noch 4 Jahre. Erst am 8. April 1450 kam es im Kloster Kappel zu einem Vergleich. Am 24. August 1450 erneuerten Zürich und die anderen Eidgenossen
auf einer Wiese bei Einsiedeln feierlich die alten Bünde und tauschten die im Krieg erbeuteten Fahnen aus.
Die Wallfahrt war in den Kriegszeiten zurückgegangen. Am 3.3. 1442 wurde das Privileg von fremden Pilgern Beichte hören zu dürfen, um fünf Jahre verlängert. In der Regierungszeit Abt Rudolfs wird auch das sogenannte Waldstattbuch aufgesetzt,
das die Rechte und Pflichten der Waldleute enthielt. In Eschenz wurde 1446 ein neues Verzeichnis der zehntpflichtigen Güter aufgenommen.
Die letzte Urkunde Abt Rudolfs ist am 11.11.1446 ausgestellt. es geht dabei um das Präsentationsrecht in der Pfarreikirche Wald. Sein Nachfolger erscheint bereits am 12. Februar 1447. Zwischenzeitlich muss Abt Rudolf also gestorben sein.
Franz von Hohenrechberg war ein Cousin mütterlicherseits des verstorbenen Abtes Rudolf. Auch er wird bei der Ämterverteilung durch Abt Burkhard im Jahr 1428 genannt. Er erhielt die Propstei Fahr. Als Abt erscheint er erstmals am 12.2. 1447.
Es geht um die Festlegung der ersten Früchte. Dies geschah zusammen mit seinem Cousin Konrad von Hohenrechberg, der Dompropst in Konstanz war. Da das Stift verarmt war, wurden nur 700 Gulden festgesetzt.
In seiner Regentschaft wurde der alte Zürichkrieg definitiv beendet. Die Verhandlungen hatten in Einsiedeln stattgefunden und der Entscheid wurde beim Abt hinterlegt.
Am 25. Oktober 1449 hatte Papst Nikolaus V. (1447-1455) den Abt von Kloster Reichenau Friedrich von Wartenberg (1427-1453) beauftragt, dem unter den Kriegsfolgen leidenden Kloster Einsiedeln zu helfen, wieder in den Besitz verlorener Güter
zu gelangen. Als Prokurator des Abtes beim Heiligen Stuhl ließ Abt Friedrich auch ein Transsumpt der Bulle Papst Leos VIII. aus dem Jahr 964, das 1383 von Heinrich von Brandis, Bischof von Konstanz, erstellt wurde, und nun von neuem
durchgesehen, abgeschrieben und für echt erklärt wird durch den Notar Johannes Vogelli vidimieren.Der Papst verlieh am 23. März 1452 allen Besuchern der Gnadenkapelle einen Ablass. Am 3.4. 1452 bestägtigte Papst Nikolaus V. Abt Franz von Hohenrechberg
und dem Konvent von Einsiedeln die Privilegien. Am 25. 4.verlängerte er die Vollmacht, Pilgern Beichte zu hören um weitere 15 Jahre, vor allem erklärte er das Kloster aber für exemt. Damit unterstand es nicht mehr der Gewalt des Bischofs von
Konstanz. Im weltlichen Bereich gab es noch einen Streit um die Weiden. Der Schwyzer Landammann Ital Reding und das Neunergericht entschieden aber im Rathaus zu Schwyz am 20. Oktober, dass diese Allgemeingut seien.
Die Regierungszeit von Abt Franz dauerte nur 5 Jahre. Er verstarb am 18. Juli 1452. Auf ihn folgte Gerold von Sax. Er war der Bruder seines Vorvorgängers Rudolf und ebenfalls 1428 mit einem Amt bedacht worden. Er erhielt damals
Kantorei und Kellerei. Mit ihm sind nun alle damals Genannten zu Abtswürden gekommen. Er übertrug Rudolf von Falkenstein, den ältesten Konventualen von Einsiedeln die Kantorei und Kellerei.
Am 15. November 1452 vidimierte der Konstanzer Bischof Heinrich IV. von Hewen (1436-1462) die Bulle, die Papst Nikolaus Abt Franz ausgestellt hatte. Sie wurde auch zur Veröffentlichung in der ganzen Diözese befohlen.
Am 13.8.1454 beauftragte Papst Nikolaus den Konstanzer Dompropst und den Domdekan sowie den Züricher Propst gegen Ulrich Tailer, einen Konstanzer Kleriker, sowie andere Kleriker und auch Laien in Konstanz vorzugehen, die dem Kloster “schwere Schäden”
zugefügt hätten. Worin diese bestanden, wird in der Urkunde nicht gesagt. Nur knapp sechs Wochen später beauftragte der Papst den Domdekan von Konstanz und den von Straßburg sowie den Züricher Propst Nachforschungen anzustellen über Entfremdung von
Klostergütern durch frühere Äbte und Konventualen. Möglicherweise war dies eine Retourkutsche der Kleriker, die angeblich das Stift geschädigt hätten. Was aus beiden Sachen geworden ist, ist nicht bekannt.
Papst Nikolaus starb am 24. März 1455. Auf ihn folgte Calixt III. (1455-1458).Dieser Papst verlieh Abt Gerold am 5.12.1457 das Privileg “sich einen Beichtvater zu wählen, der ihn von den Sünden freisprechen kann, ausgenommen die dem Papst vorbehaltenen, und
dazu Pflichten zu veräussern, ausser die Pflicht der Pilgerreise an die Grabstätten der heiligen Apostel Petrus und Paulus und des heiligen Jacobus” Der Nachfolger von Papst Calixt, Pius II. (1448-1464), der als
der als Enea Silvio Piccolomini ein bedeutender Humanist, Schriftsteller und Gelehrter war, zeigte sich als Gönner des Stifts.
Am 6.7.1462 erneuert Abt Gerold das Burgrecht mit Zürich, wobei auf Grund der geänderten politischen Lage die Veste Pfäffikon keine Rolle mehr spielt. Die übrigen Bedingungen von beiden Seiten bleiben dieselben.
Vertragspartner waren der Rat der Stadt Zürich und Bürgermeister Rudolf von Cham einerseits und Abt Gerold andrerseits.
Am 29. Mai 1463 bestätigte der Papst dem Kloster den den apostolischen Schutz und die Privilegien des Stiftes.
Nur 4 Tage später nämlich am 02.06. 1463 bestätigte er dem Kloster das Privileg, nur Adlige oder “hervorragende Männer” Männer ins Kloster auf nehmen zu müssen. Wenn dafür extra eine päpstliche Bulle ausgestellt wird, scheint es wohl
Bestrebungen gegeben zu haben, diese “alte, streng befolgte Übung” auszuhebeln. Anfang des 15. Jahrhunderts scheinen viele Klöster enorme Probleme gehabt zu haben. Bei vielen war die adlige Exklusivität vielleicht nicht die
Ursache aber eben doch mit schuldig am schlechten Zustand der Nachwuchsprobleme. Das Kloster Reichenau hatte um 1400 noch zwei Mönche in Steingaden lebte sogar nur noch ein Konventuale im Kloster. Die Klöster, die sich für alle
öffnete, erlebten dann immer einen neuen Aufschwung. In Amorbach öffnete Abt Dietrich von Kunnich (1406-1428) das Kloster für Nichtadelige. In Rot gilt Heinrich Merk (14-15-1420) als 2. Gründer. Er kümmerte sich auch um das Filialkloster
Steingaden. Auf der Reichenau wurde Friedrich von Wartenberg (1427-1458) von Papst Martin eingesetzt. Er hob die Beschränkung für den Hochadel auf. In St. Gallen wurde mit Ulrich Rösch ein Bäckersohn der erste Abt, der nicht adelig war.
Er war dies von 1463-1491.Auch er wird gerne 2. Klostergründer genannt. Bei all diesen Klöstern hatte die Öffnung eine große Wirkung. Die Ordensdisziplin wurde wieder gestärkt, zumal alle Äbte großen Wert auf die Bildung ihrer Mönche legten.
Die wirtschaftlichen Probleme schwanden auch. Einsiedeln hielt aber noch, so wie es aussieht, am alten Herkommen fest.
Auch unter Abt Gerold gab es Neuzugänge im Kloster. Aber es waren eben nur enge Familienangehörige. Konrad von Rechberg wurde aufgenommen. Er war Vetter von Abt Gerold und Sohn des Bruders von Abt Franz. Um 1454 trat Albrecht von Bonstetten ins Kloster
ein.Er war der Sohn der Schwester der beiden Äbte Gerold und Rudolf Elisabeth von Sax. Aus dieser Familie waren schon zwei Mitglieder Kanoniker in Einsiedeln. Burkhard von Bonstetten ist 1244 in Einsiedeln erwähnt und Hermann von Bonstetten war bei dem
Überfall Schwyzer auf das Kloster dabei. Er war später erst Pfleger in St. Gallen und von 1333-1360 dort Abt. Auch Barnabas von Misox trat in Einsiedeln ein. Er stammte aus dem Familienzweig der Sax-Misox, also auch ein Verwandter.
Am 18.12. 1463 befiehlt der Papst den Dompröpsten von Chur,Basel und Zürich, dafür zu sorgen, dass entfremdetes Klostergut zurück gegeben wird.
Am 25. Februar verkaufte Abt Gerold Güter und Rechte im Zugerland. Er bekam dafür 3000 Gulden. Für die Eidgenossen waren informiert worden für Zürich Heinrich von Cham, für Luzern Kaspar von Hertenstein, der in Luzern ab 1468 Schultheiß war und Hans
Reding für Schwyz. Zum einen war das eine gute Gelegenheit, sich von etwas freimachen zu können, was ihm immer wieder Schwierigkeiten bereitet hatte. Zum andern brauchte er Geld für seinen Italienreise. Später auftauchende Schwierigkeiten
waren damals noch nicht absehbar.
Am 1.2.1464 erlaubte Papst Pius dem Kloster, die Beichte von Pilgern zu hören und er bestätigte die Ablässe. Im März machte sich der Abt mit größerem Gefolge und 22 Pferden auf den Weg nach Rom. Am 11. März legte er einen Aufenthalt in Chur ein,
wo es um Streitigkeiten zwischen seinem Vetter, dem Grafen Georg von Werdenberg-Sargans und den Herren von Brandis um die Grafschaft Vaduz ging. Dabei verwies Graf Hugo XIII. von Montfort (+ 1491) im Beisein mehrerer Äbte die Sache an ein Schiedsgericht
bestehend aus den Vertretern von Bern, Schwyz und Glarus.Als der Abt auf das Gebiet des Herzogs von Mailand Francesco Sforza I.(1401-1466)kam, erhielt er durch das gesamte Gebiet das herzogliche Ehrengeleit und hielt ihn auch gastfrei.
Er scheint auch vorher schon ziemlich Aufsehen erregt zu haben. Bei Firenzuola, einem kleinen Dorf in der Nähe von Florenz, kam es zu einem Auflauf, weil viele Leute herbeidrängten, um die schönen Pferde des Abtes zu besichtigen. Dabei wurden sogar zwei
Knechte festgesetzt, die die Leute zurückdrängten. Es wirkt nicht unbedingt so, dass hier ein Abt unterwegs war, der eigentlich auf die erschütterten Finanzen seines Stiftes achten musste. In einem Bericht des Mailänder Gesandten an Herzog Francesco
ist die Rede davon, dass der Abt als Beauftragter für den Bund von Deutschland zum Papst gehe.Möglicherweise handelt es sich um die 1425 gegründete Konfraternität, bei der damalige Einsiedler Abt Burkhard den Vorsitz übertragen bekam.
Die Reise zum Papst scheint durchaus erfolgreich gewesen zu sein. Denn am 10.4. 1264 erlaubte der Papst in Pietrolo wo sich damals der päpstliche Hof in den Bädern aufhielt, “Abt Gerold von Sax zu Einsiedeln und seinen Nachfolgern, päpstliche Briefe ohne
Erlaubnis des Ordinarius auszuführen. Damit der Abt in seinem Recht nicht behindert wird, schreibt der Papst den Bischöfen von Basel und Chur sowie dem Propst von Zürich”. Am selben Tag bestätigte er die Bullen von Papst Eugen IV., Papst Nikolaus V. und Papst
Leo VIII. In Siena erhält er noch einen Ablassbrief für die Kirche von Freienbach aus, der ihm von sieben Kardinälen ausgestellt worden war. Über Zürich geht er nach Einsiedeln zurück. In Zürich siegelt er am 1. Juni nochmals in der Streitsache seines Vetter, die von
Chur am 11. März 1464 nach Zürich verwiesen worden ist. In Konstanz bemühte er sich gleich beim Bischof um die Vidimierung der erhalten Bullen. Dort war inzwischen Burkhard II. von Randegg (1462-1466) auf Heinrich IV. als Bischof gefolgt. Mit der
Sakramentenspendung für Pilger gab es keine Probleme. Dafür erklärte er sogar die Synodalstatuten für aufgehoben. Probleme gab es aber bei der Exemtion. Das war eigentlich immer und überall ein Zankapfel zwischen Bischof und Abt.
Am 18. Januar 1465 einigten sich Bischof und Abt auf die Anerkennung der Bullen zur Sakramentenspendung, den Engelweihablass und die Ernennung der Konservatoren. Verzichten musste auf die Exemtionsbulle vom 2. Juni 1463 und auch für seine Nachfolger
versprechen, sich dieser Exemtion nicht zu bedienen.
In der Nacht vom 21. April 1465 brach in der Gnadenkapelle ein Feuer aus, dem diese zum Opfer fiel und der das Münster bis zum Fronaltar zerstörte. Auch zehn Glocken, die Orgel, Paramente und Bücher wurden ein Raub der Flammen. Schuld hatte angeblich der
Mesner, der die Kerzen nicht sorgfältig genug gelöscht hatte. Die Schwyzer setzten nun den Ratsherren Josef Stadler zum Baumeister. Außerdem verlangten sie den Klosterschatz, um die Kirche wieder aufbauen zu können. Die Sache eskalierte nun. Der Abt sagte,
es sei kein Geld vorhanden. Das habe er auf seiner Italienreise verbraucht. Außerdem erkenne er die Schwyzer als Kastvögte nicht an. diese hätten sich den Entscheid Kaiser Sigismunds erschlichen. Aber er fand es geraten, nach Zürich zu gehen und sich an die
Eidgenossen zu wenden. In der Zeit führte Richard von Falkenstein die Verwaltung des Stifts. Er nahm am 17.12.1465 ein Darlehen von 800 Gulden auf wohl zur Wiederherstellung von Kirche und Kapelle. Dafür verpfändete er den Weinzehnten und Güter in Meilen.
Im November trafen sich eidgenössische Boten, der Bischof von Konstanz und der Abt in Einsiedeln. Doch eine Einigung kam nicht zustande. Die Schwyzer warfen Abt Gerold vor, in Pfäffikon und an anderen Orten Stiftsgut entfremdet zu haben. Wohl Anfang 1466
erklärten die Schwyzer mit Hilfe des Konstanzer Bischofs und Richard von Falkenstein den Abt für abgesetzt. Die Kirche war inzwischen wieder eingewölbt, was auf Anordnung von Bischof Burkhard von Konstanz geschehen war. Eine neue Weihe war nicht
nötig, wie der Bischof entschied, da die Kirchenmauern intakt geblieben waren.
Der Abt hatte sich mittlerweile an den Papst gewandt. Paul II. (1464-1471) der Nachfolger von Papst Pius II. beauftragte am31.5. 1466 “den Erzbischof von Mainz sowie die Bischöfe von Strassburg und Basel, Abt Gerold von Sax zu Einsiedeln, den Bischof Burkhard von
Konstanz und die Herren von Schwyz aus dem Amt vertrieben haben, wieder einzusetzen und zwischen den Parteien Recht zu üben”. Appellation war nicht gestattet. Am 28. Juni 1466 ermahnte der Domprobst von Chur, Johannes Hopper, den Papst Pius II. zum Konservator des
Stifts ernannt hatte, Richard von Falkenstein sowie den Ammann und die Leute von Schwyz, Abt Gerold von Sax seine Abtwürde zuzusprechen. Er berief auch einen Beschwerdetag nach Wil ein. Auf Ersuchen der Eidgenossen wurde der Tag dann in
Zürich abgehalten. Am 5.9. 1466 wurde eine Einigung erzielt. auch die Verteilung der Opfer wurde geregelt. Die Einigung hatte allerdings keinen bestand. Aber Abt Gerold konnte zurückkehren, rechtzeitig zum Fest der Engelweihe. Schon im April hatten die
7 alten Orte der Eidgenossenschaft zu diesem Fest in einem Geleitbrief für die Hin-und Rückreise Sicherheit versprochen. Das Fest von 1466 wurde die glanzvollste Engelweihfeier des Mittelalters, die uns bekannt ist.
Über 130 000 Menschen waren in 14 Tagen gekommen. Auch die drei Einsiedler Madonnen wurden vom Meister E S zu diesem Termin geschaffen.
Die Sache mit dem Verkauf der Güter und Rechte im Zugerland schwebte aber immer noch. Erst 14.3 1468 erklärte Rudolf Schiffmann, Bürger und des Rats von Luzern, als Obmann in einem Streit zwischen Schwyz und Zug den Verkauf für ungültig.
Die Finanznot des Abtes war nicht geringer geworden. Als er im April 1468 bei der Fraumünsterabtei in Zürich 260 Gulden aufnehmen musste, ärgerte das die Schwyzer so, dass sie den Abt gefangen setzten. Das brachte ihnen den Bann ein.
Sie wurden durch die Vollmacht des Generalvikars von Konstanz im Oktober wieder gelöst. Schließlich einigte man sich auf einen Handel. Die Schwyzer waren bei der letzten Geldaufnahme des Abtes in Höhe von 1000 Gulden behilflich.
Im Gegenzug trat er zurück. Seinen Abtstitel behielt er bei. Nach seiner Resignation im Spätherbst 1469 war er noch zwei Mal als Vermittler tätig. Er starb am 15.10.1480.
Konrad von Hohenrechberg ist 1440 geboren und war wohl schon seit 1454 im Kloster. Am 27.10.1469, Schwyz in der minderern Ratstube hatte Abt Gerold eidlich auf das Amt des Abtes gegen eine Rente von 200 Florin jährlich verzichtet. Nach der Resignation Gerolds
von Sax wurde Konrad die Verwaltung der Abtei übertragen, von wem ist nicht bekannt.Das Stift lag darnieder und die Zeit war reif für Reformen. Bischof Hermann III. (1466-1474)gibt dem Pfleger und Konvent von Einsiedeln Satzungen und Ordnungen, um die
zerfallene Zucht und Regel wieder herzustellen, will aber damit keinen Eingriff in die Ordensregeln tun, und behält sich und seinen Nachkommen Änderung dieser Satzungen vor. Die Verordnungen scheinen die Beobachtung der Gelübde und Disziplin, den
Gottesdienst und die Verwaltung betroffen zu haben. Ein Dekan und ein Kustos wurden ernannt und auch Abrechnung mit den Stiftsammännern wurden gemacht. Das lässt darauf schließen, dass man versuchte, den Vorgaben des Bischofs nachzukommen.
Dringlich war aber auch die bauliche Wiederherstellung des Stifts. Zunächst hatte man sich vor allem auf die Gnadenkapelle konzentriert, da das fest der Engelweihe ja bevorstand. Nun bemühte man sich um die Herstellung der Kirche und der
Stiftskirche. Als Baumeister fungierte weiter Jos Stadler aus Schwyz und nach 1480 der Ratsherr Gilg Mettler aus Schwyz. Aber 1471 bis 1473 leitete Hans Niesenberger aus Graz die Bauarbeiten. Er ist erstmals 1459 anlässlich einer Versammlung süddeutscher
Steinmetzmeister in Regensburg genannt. Er war dann wohl in der Bauhütte des Klosters Weissenau tätig, was wir aus einer Weissenauer Urkunde von 1477 wissen. 1471 schloss er in Freiburg einen Vertrag für die Tätigkeit am Münster ab.
Dieser erlaubte auch Nebentätigkeiten. aus Baurechnungen in Freiburg von 1472 und 1473 wissen wir, dass er auch in Einsiedeln tätig war. Er hatte einen Sohn, der ebenfalls Hans hieß und mit ihm arbeitete. Der Sohn lässt sich noch 1505 in Einsiedeln
nachweisen. Von Freiburg wurde Niesenberger 1483 nach Mailand berufen und arbeitete dort bis 1486 am Dom. Er hatte also durchaus einen Ruf. Erste Schwierigkeiten für den Pfleger tauchten auf, als die Schwyzer als Vögte ebenfalls einen Schlüssel für die
Opferstöcke verlangten.Es ging ja nicht nur um die Opferstöcke sondern vor allem um deren Inhalt. Abt Ulrich Rösch aus St. Gallen erreichte am 29.3. 1470 einen Vergleich im Streit zwischen Konrad von Hohenrechberg, dem Pfleger von Einsiedeln, und denen von
Schwyz wegen der Schlüssel zum Opferstock dahin, dass so lange Konrad Pfleger ist, denen von Schwyz auch einer der drei Schlüssel zum Opferstock gegeben werde und sie über den dritten Teil des Opfers zu Tilgung der Schulden des Gotteshauses und an dessen
Baukosten verwenden mögen, jedoch unvorgreiflich der Rechte des Gotteshauses. Ein weiterer Streit konnte ebenfalls mit einem Schlichter beigelegt werden. 1370 hatte das Kloster Einsiedeln die Herrschaft Reichenburg von Rudolf Tumpter genannt Keller
für 1200 Gulden erworben. Nun beanspruchte Schwyz die hohe Gerichtsbarkeit für sich. Am 22. 2. 1472 entschied der Rapperswiler Schultheiß Bilgeri Steiner, dass die hohen Gerichte und der Blutbann Schwyz zusteht, die niedere Gerichtsbarkeit aber beim Kloster
Einsiedeln verbleibt.Auch von Unbillen der Natur blieb das Stift nicht verschont. 1475 und 1477 ging schwerer Hagelschlag über Einsiedeln und Zürich nieder und in den Jahren 1478 und 1481 litten die Stiftsbesitzungen in der March schwer.
Nachdem Abt Gerold 1480 verstorben war, erfolgte die Wahl des Nachfolgers am 29. Oktober 1480. Es war eine kleine Wahlversammlung. Der Konvent bestand ja nur noch aus drei Mitgliedern. Als Stimmenzähler fungierten der Dompropst Hopper sowie der Abt von
Rüti Markus Wiler (1477-1502). Zunächst wollte der bisher als Pfleger wirkende Konrad das Amt gar nicht annehmen. Er wusste ja nach 10 Jahren in dieser Funktion, was auf ihn zukommen würde. Erst Abt Ulrich Rösch, die Schwyzer und andere Leute brachten ihn
nach langem Zureden dazu, das Amt anzunehmen. Am 29.10.1480 wurde die Wahl in Pfäffikon beurkundet. Der Notar Johannes Jörger aus Buchhorn fertigte auch ein Protokoll angefertigt. Es ist das erste dieser Art, das erhalten ist.
Am 8.12. 1480 veröffentlichte der Konstanzer Bischof die Wahl und als sich kein Einspruch erhob, erklärte sie am 15.1. 1481 als rechtlich vollzogen. Die Eidgenossen ersuchten um geringere Gebühr. Die zu zahlende Taxe wurde dann auf
650 Gulden statt 800 festgesetzt. Am 28. März 1881 bezahlte Abt Konrad die Gebühr. Allerdings meldete sich nun Rom. Abt Gerold hatte ja 1465 die Exemtion der Abtei erreicht und gemäß dieser Bulle wären nun 333 1/3 Goldgulden an die päpstliche
Kanzlei zahlen müssen. Aber noch Gerold hatte ja auf die Exemtion verzichtet und so zahlte Konrad natürlich nicht auch noch an Rom. Die päpstliche Kanzlei reklamierte aber und beauftragte den Propst des Benediktinerinnenklosters in
Feldbach im Oberelsass, gegen Konrad, sowie die Äbte von Weingarten ,Kaspar Schiegg (1477-1491), St. Blasien, Eberhard von Reischach (1482-1491) und Kempten, Johann von Rietheim (1481-1507)vor zu gehen. Sie waren alle in derselben Zeitspanne zu Äbten
gewählt worden und hatten dasselbe Problem.Konrad wandte sich an seinen Diözesanbischof, das war inzwischen Otto IV. von Sonnenberg (1474-1491). Dieser setzt sich für Konrad ein und erledigte das Problem.
Die Lage des Stifts war nach wie vor nicht rosig. Aber Schwyz übernahm 1. Juni 1482 eine vom Stift in Bern eingegangene Schuld von 700 Gulden und kurz danach lieh es dem Abt 400 Gulden, die die Stiftshöfe von Niderwil bei Bremgarten verzinsen mussten.
Doch das Stift musste weiter zu Verkäufen greifen. Am 15.4.1483 verkaufte Abt Konrad alles, was das Stift in Riegel im Breisgau noch besaß an das Stift Ettenheimmünster. Damit endeten die Einsiedler Beziehungen zum Breisgau, die seit dem 10. Jahrhundert
bestanden hatten.
1490 zog sich Abt Konrad weitgehend nach St. Gerold zurück, wo er die Propstei innehatte. In Einsiedeln bestellte er mit Barnabas von Mosax einen Pfleger. Das kann auch daran liegen, dass er sich mit den Schwyzern überworfen hatte. Das heißt aber nicht,
dass er resignierte. Papst Innozenz VIII. (1484-1492) beauftragte ihn zusammen mit den Äbten von Rüti und Fischingen, dass in Rapperswil Amt und Vesper gesungen wurden. Auch der Nachfolger von Papst Innozenz, Alexander VI. (1492-1503)
bedachte den Abt mit Aufträgen. Zusammen mit den Pröpsten von Zürich und Luzern wurde er am 28. Juli 1493 zum Verteidiger der kirchlichen Rechte des Klosters Disentis bestellt. Mit der Verwaltung der Propstei St. Gerold gab es immer wieder Probleme, so dass
Konrad am 29. März 1498 diese auch dem Pfleger Barnabas von Misox übertrug. Er bedingte sich dafür die Entrichtung von 100 Gulden jährlich aus. Allerdings wurde das hinfällig. Denn Barnabas verstarb am 31. August 1501 in Einsiedeln. Nun musste der Abt wieder
die Verwaltung von Einsiedeln und St. Gerold übernehmen. Außer Abt Konrad lebten jetzt nur noch zwei Konventualen im Kloster, nämlich Johann Baptist von Mosax. Dieser war ein Neffe des Pflegers Barnabas. Er war 1498 ins Kloster eingetreten. Er war wohl ohne
Beruf ins Kloster gekommen. Da er stolz, jähzornig und pflichtvergessen war, wollte ihn Konrad nicht zum Priester weihen lassen. Er überwarf sich mit dem Abt. Er bat die Schwyzer, ihm entweder auf eine Höhere Schule oder in der Fastenzeit zur Priesterweihe zu
verhelfen. Sie taten weder das eine noch das andere.Erst als der Abt ihn einsperren ließ, verwandten sich für ihn. Darauf kam er frei. Er bedankte sich bei den Schwyzern. Sie mussten ihn aber bald auch einsperren. Im August und September 1510
lässt er sich in Luzern nachweisen. Kurz danach ist er wohl gestorben. Eine wesentlich rühmlichere Erscheinung im Kloster stellt Albrecht von Bonstetten dar. Er war der Sohn von Kaspar von Bonstetten und der Elisabeth von Sax, der Schwester der beiden Äbte
Rudolf und Gerold. Um 1454 ist er ins Kloster Einsiedeln eingetreten. Möglicherweise war er 1464 bei der Italienreise von Abt Gerold dabei. 1466 wurde er die in die junge, gerade 9 Jahre vorher gegründete Universität Freiburg immatrikuliert.
In den Universitätsmatrikeln von Freiburg findet man da folgenden Vermerk “Albertus de Bonstetten monasterii Heremitarum professus sub forma nobilis, tredeeima Maij.” In Freiburg hatte er sich für die sieben freien Künste eingeschrieben, den damals üblichen
Start eines Studiums. In Basel setzte er sein Studium bis 1468 fort. In Freiburg lernte er den Mönch und späteren Abt der Reichenau Martin von Weißenburg kennen. In Basel freundet er sich mit dem Basler Kanoniker Arnold Truchsess von Wolhusen an, der ihn dazu
ermuntert, in Pavia zu studieren. Zunächst ist er aber wieder in Einsiedeln. Dort erscheint er am 9. März 1469 als Dekan. 1471 ging er schließlich nach Pavia, versehen mit einem Empfehlungsbrief der eidgenössischen Boten an den Herzog Galeazzo Maria Sforza.
Ohne akademischen Grad kehrte er 1474 nach Einsiedeln zurück. Dort empfing er die Priesterweihe. Er brachte auch Handschriften unter anderem eine der Werke des Petrarca mit. Er machte sich einen Namen als Frühhumanist. Er führte mit vielen
seiner gelehrten Zeitgenossen einen ausführlichen Briefwechsel. Die wichtigsten seiner erhaltenen lateinischen und z. T. selbst ins Deutsche übersetzten Abhandlungen sind: die älteste Beschreibung der Schweiz (1479), Darstellungen der Burgunderkriege (1477),
der Lebensgeschichte der Schweizer Heiligen Nikolaus von der Flüe (1479), Meinrad (1480) und Ida (1481); ferner der Geschichte des Klosters Einsiedeln (1480) und des Hauses Österreich (1499), sowie ein Marienbrevier (1493).
Bald genoss er auch das Ansehen der Großen seiner Zeit. Am 20.10.1482 ernannte ihn Kaiser Friedrich zum Pfalzgrafen und Hofkaplan und stattete ihn mit verschiedenen Privilegien aus. 1491 ernannte ihn Maximilian zu seinem Hofkaplan
und der Kaiser verlieh ihm 1492 das Privileg 10 Wappenbriefe zu verleihen und zehn Doktoren zu Rittern zu schlagen. Als Maximilian mittlerweile Kaiser geworden (1493-1519) in Freiburg weilte, besuchte er Albrecht persönlich. Er bestätigte die Ernennung zum
Hofkaplan und promovierte ihn zum Doktor beider Rechte. Außerdem änderte er das Recht 10 Ritter zu schlagen um in das Recht zehn Doktoren beider Rechte, der freien Künste und der Medizin ernennen zu können. Er vermittelte für sich und Abt Konrad das Privileg,
sich einen beliebigen Beichtvater suchen zu dürfen, der ihm einmal im Leben und im Augenblick des Todes einen vollkommenen Ablass gewähren zu können. Auch für die Wallfahrt vermittelte er einen Ablass und das Brevierprivileg für Priester.
Er hatte noch einen Rechtstreit mit einem Memminger Drucker zu führen, war für die Abtei wohl noch vermittelnd tätig. Dann erfahren wir nichts mehr von ihm. Wir wissen nur, dass er vor dem 11. Januar 1505 gestorben sein muss.
Um 1499 trat Diebold von Geroldseck ins Kloster Einsiedeln ein. Er war der Sohn von Gandold I. von Geroldseck und der Kunigunde von Montfort. Der Stammsitz war Hohengeroldseck nahe Seelbach bei Lahr hatten. Er hatte 4 Schwestern und zwei Brüder.
Seine Schwestern waren in Klöstern untergebracht und zwar in Zürich in Fraumünster, im Damenstift in Säckingen und im Kanonissenstift in Bad Buchau. Seine Brüder hatten die obere Herrschaft von Geroldseck inne. Diebold legte um 1505 seine Profess ab.
Am 10. Januar 1503 erwarb Abt Konrad vom Schwyzer Landamman das hintere Sihltal. Dem Verkäufer oder seinen männlichen Nackommen wurde das Recht eingeräumt, “wegen der vielen Dienste, die sein Vater und Bruder und er selbst dem Gotteshaus bewiesen”
dieses innerhalb von 32 Jahren zum Verkaufspreis zurück zu erwerben. Abt Konrad nutzte dieses Gut hauptsächlich zur Pferdezucht. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Pferdezucht im Kloster wohl schon 500 Jahre und der Marstall Einsiedeln ist das älteste
Gestüt Europas. Die oben erwähnte Urkunde von Heinrich IV. von 1064, indem er den Dienstleuten Einsiedelns das Recht, lässt auf einen Marstall und auch indirekt auf Pferdezucht schließen. Im 15. Jahrhundert gab es auch das weltliche Hofamt des
Marschalls, dem der Marstall und das Gestüt unterstanden und der den Abt auf seien Reisen zu begleiten hatte und dabei auch für die Unterkunft sorgen mussten.
Bei dem Überfall der Schwyzer auf das Kloster 1314 nahmen die Schwyzer neben Kühe auch Pferde als wertvolle Beute mit. Erinnert sei auch an den Auflauf, der auf der Italienreise von Abt Gerold entstand, weil die Menge sich drängte, um die schönen Pferde des
Abtes zu bewundern. Unter Abt Konrad nun begann die Pferdezucht in größerem Masse. Er belieferte unter anderem den Markgrafen von Mantua Francesco Gonzaga (1486 –1519). er war Oberbefehlshaber der päpstliche Truppen unter Papst Julius II.
und Bannerträger der Kirche. Erste Rechnungen aus dem Jahre 1513 belegen den Handel mit den “Cavalli della Madonna” Allerdings hat es ab dem Jahr 1518 Probleme mit der Bezahlung. Noch im Jahre 1598 schuldete das Haus Mantua dem Stift
600 Gulden. Im Jahre 1684 standen 94 Pferde, darunter 14 Füllen im klösterlichen Gestüt. Eine gewichtige Rolle spielten die Einsiedler Pferde beim Bau der neuen Klosteranlage zwischen 1704 und 1734. Sie besorgten den Transport des Sandsteins vom
Steinbruch am Etzel zum Kloster. 1764-1766 wurde der barocke Marstall nach den Plänen des Einsiedler Klosterbruders Kaspar Braun aus Bregenz errichtet. Bauherr war Abt Nikolaus Imfeld. 1763 wurde in England das General Stud Book angelegt.
Als aber 1798 die französischen Revolutionsheere unter General Schauenburg nach Einsiedeln kamen, nahmen die Offiziere die Pferde an sich.
Heute stehen wieder 11 Stuten, 4 Wallache und Junghengste in Einsiedeln.
Zurück zu Abt Konrad. Die Folgen des letzten Klosterbrandes waren noch nicht beseitigt. Da brach 1509 jetzt erneut ein Brand, der 4. aus. Im Dorf hatte es in einer Bäckerei zu brennen begonnen. Nur 16 Häuser blieben verschont. Im Kloster wurde das
Münster schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nur die Gnadenkapelle, die Abtei und das Haus der Kapitularen blieben unbeschädigt. Alles andere fiel den Flammen zum Opfer. Es flossen zwar viele Spenden, aber trotzdem mussten neue Schulden aufgenommen
werden. Zur Engelweihfeier von 1511 war alles wieder einigermaßen instand gesetzt.
In der Schweiz versuchten die Eidgenossen allmählich , den Einfluss des bischöflichen Kurie in Konstanz immer stärker zurück zu drängen. So ermunterten wohl auch die Schwyzer den Abt, in Rom einen neuen Anlauf in Sachen Exemtion zu nehmen.
Die Zeit war günstig. Den Julius II. (1503-1513) war auf die Unterstützung der Eidgenossen angewiesen,wenn er seine politischen Ziele durchsetzen wollte. Er hatte die Wiedergewinnung der Gebiete, die unter seinem Vor-vorgänger Alexander VI. verloren gegangen waren,
im Auge. Am Rande bemerkt, dieser Papst war es auch, der die Schweizergarde als päpstliche Leibwache gründete. 1506 zog eine Truppe von 150 Mann erstmals in den Vatikan ein. Unterstützt von den 12 Orten ersuchte der Abt um die Bestätigung des
Engelweihablasses, die Genehmigung Pilgern die Beichte abzunehmen und vor allem um die erneute Verleihung der Exemtion. Am 2.1. 1512 bestätigte Papst Julius II. auf Bitte der Gesandten der XII Kantone die Privilegien von Papst Leo VIII., Papst Nikolaus V. und
Papst Pius II. Der Bischof von Chur Paul Ziegler (1505-1541), der Abt von St. Gallen Franz von Gaisberg (1504-1529) und der Propst von Zürich wurden zu Exekutoren und Protektoren dieser Sache ernannt.
Inzwischen kränkelte der Abt immer mehr. Auch zeigte er sich seinem Amt nicht mehr gewachsen. Er wandte sich deshalb an die Schwyzer Schirmherren, einen Verwalter für das Stift zu bestellen. Am 18. Dezember 1513 wurde ein Vertrag mit dem
Abt geschlossen. Er bezog eine jährliche Pension von 240 Gulden. Er durfte einige Güter des Stiftes behalten. Auch Pferde und Vieh durfte er behalten bzw. ankaufen. Zum Pfleger wurde Diebold von Geroldseck bestimmt. Der Abt zog sich nicht von allen Geschäften
zurück. Sein großes Abteisiegel hatte er zerbrochen, sein kleines aber behalten. Damit erledigte er immer noch kleine Privatgeschäfte. Diebold nahm erst mal den Wiederaufbau der beim Brand erneut geschädigten Kirche auf. Einen der beiden Türme ließ er
abtragen, weil er stark beschädigt war und neu aufbauen. Die Meister Egenmüller und Augustin schufen einen neuen Hochaltar. Von dem Einsiedler Goldschmied Meister Lienhard ließ er die Reliquien neu fassen und ein Kreuz machen. Der Chor wurde
ausgemalt und die Sakristei hergestellt. Im Kloster wurde der Marstall, eine Fleischkammer und eine Schleife neu gebaut. In Pfäffikon wurde ein neues Kornhaus erstellt, die Teufelsbrücke restauriert und der Weg über den Etzel verbessert.
Den Exemtionsstreit mit Konstanz brachte er mit Hilfe der Schwyzer und Kardinal Schinners, Bischof in Sitten seit 1499, zu einem glücklichen Ende. Am 10.12. 1518 bestätigte Leo X. (1513-1521) das Privileg der Exemtion “auf ewige Zeiten”.
Auch das Privileg Pilgern Beichte zu hören und den Engelweihablass verlängerte er auf ewige Zeiten. Mit der Durchführung des Privilegs wurde der Bischof von Pistoia Antonio Pucci, sowie die Pröbste von Basel und Zürich betraut.
Das wohl einschneidendste Erlebnis für Diebold war die Berufung Zwinglis als Leutpriester nach Einsiedeln. Zwingli kam 1519 nach Zürich. In Einsiedeln folgte Leo Jud auf ihn, der später neben Zwingli der bedeutendste Züricher Reformer wurde.
Eine Reihe von Stiftspfarreien war allmählich von Gefolgsleuten Zwinglis besetzt. Auf der Ufnau hatte Ulrich von Hutten Zuflucht gefunden.Dort hatte dieser seine letzten Tage verbracht.
Gegen 1525 überwarf sich Diebold mit den Schwyzern. Die Schwyzer warfen ihm schlechte Verwaltung vor. Hauptgrund dürfte aber das enge Verhältnis zu Zwingli gewesen sein, der spätestens seit der Züricher Disputation für die Schwyzer nicht mehr tragbar
war. Man verhandelte noch, aber ohne Ergebnis. Anfang Januar legte Diebold sein Amt nieder, zerschnitt seien Bestallungsbrief und zerbrach sein Siegel. Zunächst ging er zu seinen Brüdern. Diebold war wohl eine Abfindung in Aussicht gestellt worden, die
er aber nicht erhalten hatte. Er kam deswegen 1527 nach Zürich, setzte sich dort im Einsiedlerhof fest und begann die Gefälle des Klosters im Zürcher Amt einzuziehen. Obwohl frühere Zusagen Zürichs an Schwyz vorlagen, schützte Zürich Diebold. Es kam
zum sogenannten Geroldseckischen Handel, der erst 1529 vertraglich beigelegt wurde. Diebold heiratete wie Zwingli auch. Diebold starb am 11.Oktober 1531 in der Schlacht bei Kappel. Zwingli fiel in die Hände der katholischen Innerschweizer und wurde getötet.
Abt Konrad wurde am 9.2.1518 von Kaiser Maximilian aufgefordert, am Reichstag zu erscheinen. Am 2.5.1518 bestätigte Maximilian auf Ansuchen des Abts Konrad III. von Hohenrechberg zu Einsiedeln, welcher deshalb Botschaft zu ihm schickte, alle Freiheiten,
Gnaden, Rechte u.s.w. des Gottshauses Einsiedeln, insbesondere die goldene Bulle Kaiser Karls IV., und nimmt dasselbe in seinen besondern Schirm. Einen Tag später verlieh er ihm die Regalien. Am 20. Januar 1526 war Abt Konrad nicht mehr in der Lage, die
Geschäfte zu führen. Schwyz setzte deshalb seinen Ratsherrn und Altvogt zu Einsiedeln Martin von Kriens zum Schaffner des Gotteshaus ein. Am 20. Juli 1526 verzichtete er auf die Abtei und nur wenig später, am 1. September 1526 verstarb er.
Kurz vorher am 8. August hatten die Schwyzer den Sankt Gallener Konventualen Ludwig Blarer geholt und ihn am 14.8. 1426 in den Besitz der Abtei gesetzt.Wie Pater Rudolph Henggeler in seinem Typoskript auf Seite 436 vermerkt entstammte
Ludwig nicht dem St. Gallener Zweig der Familie Blarer. Die Familie ist um 1228 in St. Gallen erwähnt. Ab 1330 verlagerte sich das Tätigkeitsgebiet der Familie nach Konstanz, wo sie vor allem im Leinwandhandel tätig war und zu großem Reichtum kam.
Sie stellte immer wieder Bürgermeister und Ratsherren der Stadt Konstanz. Sein Vater war nach Henggeler Bartholomäus Blarer, auch Bürgermeister in Konstanz. Ludwig ist um 1485 geboren und kam schon früh ins Stift Sankt Gallen, wo er 1504 zum ersten Mal
erwähnt wird. Dort ist der Jüngste der Konventualen auf der Liste zur Abtswahl. er war Ökonom in Rorschach. 1515 ist er Cellerar und Ökonom in St. Gallen. 1516 bestellte ihn Abt Franz Gaisberg zum Dekan. Ganz klösterlich scheint er bis dahin nicht gelebt zu haben,
den er hatte nachweislich einen Sohn namens Wolfgang. Am 8. August 1526 war der Schwyzer Josef Amberg in St. Gallen bei Abt Franz, um ihn zu bitten, seinen Dekan nach Einsiedeln als Abt zu entsenden. Dieser gab der Bitte statt. Ludwig gab seine St.
Gallener Pfründen ab. Er nahm die Berufung an allerdings vorbehaltlich der päpstlichen Bestätigung und kirchenrechtlich war das ja nicht unproblematisch. Abt und Konvent von St. Gallen versprachen,ihn wieder als gleichberechtigten Konventualen
auf zu nehmen, wenn er Einsiedeln ohne Pension wieder aufgebe.Am 10.08 verließ Ludwig St. Gallen. Am Vorabend von Mariä Himmelfahrt führte ihn der regierende Landamman Martin Andermatt in die Kirche. Das Te Deum erklang
und die Untergebenen huldigten dem neuen Abt. Amselben Tag wurde die Einsetzung beurkundet. In der Urkunde wurde der Landamman Martin Andermatt genannt, der Altamman Martin zu Bachi,die Vögte Josef Amberg, Martin von Kriens und Heinrich Lilie.
Der erst Einspruch kam allerdings aus anderer Richtung. Am 16. November 1526 waren die süddeutschen Grafen und Freiherren in Tübingen versammelt und wandten sich an Schwyz.
“ Die zu Tübingen versammelten Grafen und Herren an Schwyz. Das Gotteshaus sei von Kaisern und Königen mit der Freiheit begabt, dass der Abt vom Konvent erwählt werde und von Fürsten, Grafen oder Herrenstammen soll. Nun höre
man, dass ein Abt erwählt sei, der diese Eigenschaften nicht besitze was den Rechten der Herren einen Abbruch tue. Da nun Schwyz als Kastvogt das Gotteshaus bei seinen Freiheiten handhaben sollte, so ersuche man es, dafür zu sorgen, dass dasselbe bei seinem
alten Recht und Herkommen bleibe und den Grafen und Herren im Reich und ihren Nachkommen ihre Rechte nicht entzogen werden” (Eidgenössische Abschiede IV, 1a. S.1125)Doch die Zeiten, dass der süddeutsche Adel solche Ansprüche stellen konnte,
waren vorbei. Zudem hatte ja gerade das Stift eindringlich bewiesen, wohin es führte, wenn Klöster zu Versorgungsinstrumenten der Nachkommen des Adels verkamen. Das Kloster war verschuldet, die klösterliche Disziplin war dahin.
Kaiser Karl V. ließ sich mit der Anerkennung des Abtes nicht ganz so viel Zeit. Am 3.7. 1532 verlieh der Kaiser dem Abt und dem Kloster die Regalien. Seit dem Reichstag zu Speyer 1529 hatte der neue Glaube immer mehr Anhänger. Längst war es nicht mehr nur eine
Glaubensfrage sondern einfach auch ein Machtfrage, was sich ja auch in den entstehenden Bünden zeigte, so der Schmalkaldische Bund von 1531 der protestantischen Stände oder der Katholisch Liga von 1538. Natürlich lag es im Interesse des Kaisers,
die katholische Seite zu stützen. Nicht so einfach war es mit Rom. Die Einsetzung des neuen Abtes war ja ohne jegliche kirchliche Erlaubnis geschehen. In seinem Breve vom 8.1. 1528 bestätigte Papst Clemens VII. (1523-1534) Ludwig als Administrator von
Einsiedeln. Bedingung war allerdings ein apostolisches Indult, das natürlich nicht vorlag. Es wurde aber auch keine Bulle ausgefertigt. Zwar war eine Frist von 6 Monaten gesetzt. Aber die politische Lage in der Eidgenossenschaft verlangte andere Prioritäten.
Es war die Zeit der Kappeler Krieg, wobei der erste ohne Blutvergießen endete und 1529 nochmals friedlich beigelegt werden konnte, sogenannte Kappeler Milchsupp. Der zweite im Oktober 1531 endete aber blutig. Das war die oben erwähnte Schlacht,
bei der Zwingli und Diebold von Geroldseck ums Leben kamen. Erst im Sommer 1532 ersuchte Abt Ludwig mit Unterstützung der fünf Eidgenössischen Ort beim Bischof von Albano Ennio Filonardi, der von 1531 –1533 letztmals päpstlicher Nunitius in der Schweiz war,
um die Bestätigung der Wahl. Doch der Nuntius erklärte ihm, dafür keine Vollmacht zu haben. Nun bat der Abt Schwyz den Landamman Gilg Reichmuth auf Kosten des Klosters nach Rom zu schicken, was auch geschah. Die fünf Orte fertigten ihm am 12. März
1533 ein Empfehlungsschreiben aus. Darin hieß es: “ Die Boten der 5 Orte schreiben an den Papst, in den letzten Tagen habe der erwählte Abt von Einsiedeln bei dem Legaten Verulan um Bestätigung nachgesucht, aber die Antwort erhalten.
dass demselben die Vollmacht nicht zustehe, sie zu gewähren; demzufolge bitte Schwyz, dass man sich bei seiner Heiligkeit für den Abt verwende. Dazu sei man besonders geneigt und bitte daher, den Genannten bestens empfohlen zu halten,
zumal das Gotteshaus durch die verdammte neue Sekte Abgang erlitten ,durch eine Feuersbrunst beinahe gänzlich zerstört und durch die großen Kosten für den Wiederaufbau schwer beladen sei,” (Eidgenössische Abschiede IV.,1c, S. 36)
Auch der Kaiser wurde um Interstützung in der Sache gebeten.
Am 26. April 1533. bestätigte Papst Clemens Ludwig als Abt nachdem er wie ausdrücklich in der Urkunde steht erneut gewählt wurde. Erst jetzt, knapp 7 Jahre nach sein er Amtseinführung, war er also auch formal in seinem Amt angekommen.
Am 6.5. 1533 erfolgte die Bestätigung der Exemtion und Privilegien.Dazu zählte auch das Recht der Pontifikalien und die Erteilung der niederen Weihen. mit einer Urkunde vom nächsten Tag wird auf das zitierte Schreiben der 5 Orte geantwortet und erklärt, “die
Bestätigung Ludwig Blarers als Abt habe er (der Papst)gratis und ohne Gegenleistung gewährt”. Trotz der mittlerweile bestehenden Gegensätze bemühte sich Abt Ludwig rasch um das Burgrecht von Zürich. So lange Diebold noch in Zürich war, stemmte er sich mit
macht dagegen und sagte, der einzige rechtmäßige Konventuale Einsiedelns zu sein.
Nach seinem Tod waren die Problem wohl ausgeräumt. Schwierigkeiten gab es nur noch wegen der Bezahlung, denn Diebold hatte offenkundig nie die Steuer für das Burgrecht erbracht. Der Abt wollt natürlich nicht für Diebold bezahlen. Es ging um die
Jahre ab 1526. Zunächts bot der Abt zwei Jahre an. Schließlich einigte man sich darauf, dass der Abt der Stadt Zürich einen Hengst aus dem Gestüt gebe, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Am 30.9. 1533 stellte die Stadt die Verleihungsurkunde für Abt
Ludwig aus. Kurz danach gab es wieder Auslegungsschwierigkeiten, denn Ludwig wollte gestützt auf die alten kaiserlichen Privilegien Zollfreiheit in Zürich, was ihm der Rat nicht zugestehen wollte. Obwohl der Landammman Josef Amberg die alten kaiserlichen
Freiheiten vorlegte, beharrte die Stadt auf ihrem Standpunkt.
Auf Papst Clemens folgte 1534 Papst Paul III (bis 1549). Dieser bestätigte am 13.12. 1537 die Exemtion und die Privilegien für Abt Ludwig. Er erweiterte das Privileg. Der Abt durfte nun auch die Firmung spenden und Kirchen und Kelche weihen, solange “die Häresie
in der Schweiz dauern sollte”. Diese Privileg gilt heute noch. Zwar waren praktisch alle führenden Köpfe der Reformation als Priester auf Einsiedler Pfarreien tätig. Stürmischer ging es aber in St. Gallen zu. Im Februar 1529 fand dort der Bildersturm statt
als Abt Franz in Rorschach im Sterben lag. Vadian veranlasste die Säkularisation des Stifts. Erst der Sieg der katholischen Kräfte bei Kappel 1531 mischte die Karten neu. (mehr dazu siehe St. Gallen) St. Gallener Mönche flohen nach Einsiedeln, wo sie gastliche
Aufnahme fanden. Sie brachten auch Reliquien von Otmar und Notker mit, die bis 1538, bis sich die Lage in St. Gallen wieder beruhigt hatte, in Einsiedeln blieben.
1535 nahm Abt Ludwig die ersten Novizen im Kloster auf. Diese, nämlich Joachim Eichhorn von Wil und Rudolf Brunolt von Rapperswil, beide bürgerlicher Herkunft, legten 1536 ihre Profess ab. Es folgten noch 5 weitere Mönche und zwei Laienbrüder.
Zwei Mönche sandte er nach Ochsenhausen und Hirsau, um die dortige Ordenszucht kennenzulernen und die in Einsiedeln zu heben. Er führte auch die Tonsur und Ordenstracht, wie sie in St. Gallen üblich war, in Einsiedeln ein.
Abt Ludwig starb am 26. Februar 1544.Einen Monat später am 28. März wählten die 4 vorhandenen Konventualen einen neuen Abt. Diese Wahl unterschied sich in einem Punkt wesentlich. Hier stand nicht ein Familienclan zu Wahl, sondern Mönche,
die imselben Orden aber eben nicht miteinander verwandt waren. Joachim Eichhorn ist 1516 in Wil geboren und entstammt einer Familie, die sich in Wil seit dem 16. Jahrhundert nachweisen lässt. Von seinen Geschwistern besuchte ein Bruder, Peter die
Klosterschule in St. Gallen, trat dort ins Kloster ein und wurde 1549 Abt in Wettingen. Joachim trat 1535 ins Kloster Einsiedeln ein. Er war einer der ersten Novizen nach der Glaubensspaltung. Der Wahl wohnten die Äbte von St. Gallen Diethelm Blarer von Wartensee
(1530-1564),von Muri Laurentius von Heidegg (1508-1549) und von Fischingen Markus Schenklin (1540-1553) bei.
Papst Paul bestätigte die Wahl am 23.11.1544. Die katholischen Orte hatten gebeten, auch dieses Mal die Bestätigung persönlich vorzunehmen.Schon in Jahr nach seiner Wahl erneuerte er am 11. Mai 1545 das Burgrecht mit Zürich.
Am 5. Juli 1546 verlieh Kaiser Karl V. Abt und Kloster die Regalien. Der Papst bestätigte 5 Tage später die Privilegien des Stifts. Sein Nachfolger Paul IV. (1555-1559) bestätigte am 10.7.1556 die Privilegien des Stifts und die Exemtion.
Nachdem Ferdinand I. auf seinen Bruder Karl 1558 als deutsche Kaiser gefolgt war,bestätigte auch er am 3. Oktober 1558 die alten Freiheiten des Stiftes ebenso wie die Regalien.Als Ferdinand 1564 starb, folgte sein Sohn Maximilian II. als deutscher Kaiser. Auch er
bestätigte Regalien und alte Freiheiten im April 1566.Die Herren von Schwyz kümmerten sich sehr intensiv um “ihr” Kloster. Schon am Tag der Wahl trafen die Vertreter der Schirmorte bei ihm ein, der Landammann Josef Amberg, der Statthalter Ulrich Auf der
Mauer, sowie der Bannerherr, also der Heerführer von Schwyz Hieronymus Schorno. Sie trafen folgende Vereinbarung mit ihm: Er soll Gottesdienst nach der Regel Benedikts halten. Der Abt soll die Freiheiten des Gotteshauses erhalten. Er darf nichts
verbriefen, versetzen oder verzinsen. Was nicht bereits Lehen war, darf nicht als Lehen vergeben werden. Der Abt darf keine Verwandten als Diener oder Ammann annehmen. Ohne Wissen des Konvents und der Schirmherren darf er keinen Amann einsetzen.
Aber auch der Konvent noch Schwyz dürfen ihm einen Ammann gegen seinen Willen aufdrängen. Gegenüber den Schirmherren ist er zu jährlicher Rechnungslegung verpflichtet. Und schließlich sollen weder Abt noch Konvent durch Umgang mit schlechten Weibern
Ärgernis geben. Er hatte ein fast reibungsloses Verhältnis mit dem Schirmherren. Mit der Amtsführung waren sie sehr zufrieden und schon um 1550 war das Stift fast schuldenfrei. Trotzdem wollte er sich weitgehend aus der Abhängigkeit lösen und versprach
deshalb auch eine alte Schuld bei Schwyz von 1589 Gulden mit jährlich 50 Gulden abzutragen. Viele Urbarien liess er neu erneuern. In Fahr erwarb er eine Reihe von Gütern zurück. In Einsiedeln und Pfäffikon erwarb er Güter und auf der Ufnau
erwarb er viele Güter zurück, die in Privatbesitz übergegangen waren. Auch als Bauherr war er tätig. Er ließ das untere Münster, das immer noch von dem Brand von 1509 geschädigt war, wölben, er ließ eine neue Prälatenstube erbauen und schön ausmalen.
Mit dem Orgelbauer Balthasar Mygel von alten Mygelburg schloss er am 11. Juli 1557 einen Vertrag über eine neue Orgel, obwohl dieser zu derzeit Probleme wegen Gotteslästerung und Landfriedensbruch hatte. Die Orgel mit 18 Registern steht im oberen
Münster. In Pfäffikon ließ er aus einem alten Weinkeller die neue Schlosskapelle erstellen. Zwei neue Kornschütten und weitere Gebäude wurden dort errichtet. In Freienbach wurde der Pfarrhof und die untere Schloßmühle neu erbaut.
Den Lehenseid wegen Halsgerichtsbarkeit und Blutbann leistete er dem kaiserlichen Rat Gerwig Blarer, der auch Abt von Weingarten und Ochsenhausen sowie päpstlicher Legat war. (Zu Gerwig Blarer siehe Kloster Weingarten) Gerwig Blarer bestätigte die
Eidesleistung in einer Urkunde vom 28.11.1560. Abt Joachim war auch auf die Reichstage von Ulm 1552 und 1558 geladen worden, wobei er sie wahrscheinlich nicht besucht hat.
In der Amtszeit von Abt Joachim wurden 21 Konventualen neu aufgenommen. In allen Benediktinerklöstern wurde seit der Reformation großer Wert auf die Ausbildung der Mönche gelegt.
Auch Joachim schickte einige von ihnen zum Studium nach Freiburg im Breisgau und Dillingen. So war Ulrich Witwiler in Freiburg. Johannes Heider von Wil hatte in Freiburg den Magister Artium gemacht. Balthasar Wickmann studierte ebenfalls
in Freiburg. Kaspar Müller von Ägeri war in Dillingen. Von den Konventualen Joachims wurden 4 Äbte, Ulrich Witwiler und Adam Heer in Einsiedeln, Johannes Heider in Pfäfers und Andreas Hersch in Engelberg.
1545 war das Konzil von Trient als Reaktion auf die Reformation Martin Luthers einberufen worden. Es tagte in 4 Sitzungsperioden(3 in Trient eine in Bologna) zwischen 1545 und 1563. Die 3 Trientiner Periode wurde 1562 von Papst Pius IV. (1559-1565) wieder
einberufen. Am 25. Januar 1562 hatten sich Schweizer Prälaten und Vertreter der Schweizer Geistlichkeit in Rapperswil versammelt. Dabei bestimmten sie Abt Joachim zu ihrem Vertreter in Trient. Zusammen mit Ritter Melchior Lussi (1529-1606), dem Gesandten
der katholischen Orte am Konzil von Trient, ging er an den Konzilsort. Allerdings musste der Abt krankheitsbedingt am 16. August nach St. Gerold gehen. Als er wieder nach Trient zurückkehren wollte,war das Konzil abgeschlossen. Wichtigstes Resultat
ist das “Tridentische” Glaubensbekenntnis.Die Glaubensspaltung hatte die katholischen Orte auch räumlich von ihrem Bischofssitz Konstanz getrennt. So gab es Bestrebungen, Abt Joachim die Bischofswürde zu verschaffen. Doch die Pläne zerschlugen sich.
Zur Umsetzung der Konzilsbeschlüsse sollten Diözesansynoden abgehalten werden. Für Konstanz war die Synode 1567 vorgesehen. Papst Pius forderte die Äbte von Einsiedeln und St. Gallen eigens auf, die Synode zu besuchen. Allerdings befürchteten die beiden
Äbte,dass Konstanz in ihre Rechte eingreifen wolle. Erst als Bischof Markus Sitticus von Hohenems (1561-1589)zusicherte, ihre Freiheiten zu wahren, nahmen die beiden Äbte an der Synode teil
Nach 25 – jähriger Regierung starb Abt Joachim am 13. Juni 1569.
Adam Heer wurde am 16. Juni 1569 von Dekan Konrad Beul und dem Konvent zum neuen Abt gewählt. Sein Vater war Johannes Heer aus Rapperswil, sein Großvater mütterlicherseits Joachim Am Grüt. Er war Ratsschreiber in Zürich und erbitterter Gegner von
Zwingli. Sein Sohn Johann Christoph, also der Onkel des neuen Abtes war von 1549 bis 1564 Abt von Muri.Von den Töchtern des Züricher Ratsschreibers war eine, Sophia,1540 Schaffnerin und ab 1550 Äbtissin in Tänikon, die andere Meliora Meisterin in
Hermetschwil. Adam legte 1553 in Einsiedeln die Profess ab. Er wurde zunächst zum Subdiakon, dann zum Diakon geweiht. Die Priesterweihe empfing er 1558. Er war danach wohl Subprior und hatte dieses Amt bis zu seiner Abtswahl inne.
Anwesend waren auch Otmar Kunz, Abt von St. Gallen (1564-1577) Hieronymus Frei (1564-1585). Er erneuerte rasch das Burgrecht mit Zürich, schon am 13.8. 1569. Am 29. September hatte er das Schirmrecht mit Schwyz erneuert. Auch vom neuen Abt verlangte
Schwyz jährliche Rechnungslegung. Papst Pius V. bestätigte Adam Heer am 19. 11. 1569 als Abt von Einsiedeln. 44 Goldscudi und 5 Julier wurden an Gebühren fällig. Die Abtsweihe nahm Weihbischof Jakobus von Konstanz an Lichtmess 1570 im Beisein der Äbte
von Konstanz und Muri vor. Maximilian II verlieh ihm 1572 die Regalien. Mit dem Empfang beauftragte er Johann Andreas von Schwalbach. Dabei bat er auch darum, die Huldigung vor dem Abt der Prämonstratenserabtei Minderau,
dem heutigen Weissenau die Huldigung vornehmen zu dürfen. Abt war damals (1563-1575) Michael Hablützel.
Schon ein Vierteljahr nach seiner Wahl hielt er mit dem Schwyzer Landammann Schorno die erste Abrechnung ab. Auch hat sich ein Tagebuch erhalten, in dem der seien Tätigkeit festhielt, was gegen den Vorwurf unsolider Wirtschaftsführung, der später gegen ihn
erhoben worden ist, eigentlich entkräftet. Gleich zu Beginn seiner Regierungszeit entwickelte er eine rege Bautätigkeit. Die Gangulfskapelle wurde erneuert, ein Jahr später eine neue Kustorei erbaut. 1574 wurde der Chor neu ausgeführt. 1575 wurde mit dem
Presbyterium begonnen, das ein Jahr später fertiggestellt wurde. Neue Ornate, eine neue Mitra wurden erworben, alte Reliquiare wurden erneuert. Aber auch weltliches Silberzeug wurde beschafft, wozu der Abt vermerkte “ist alles zalt”. Auch das spricht für einen
geordneten Haushalt. Er sorgte auch für die Anlegung eines neuen Pilgerwegs und kümmerte sich um den auswärtigen Stiftsbesitz. Ein großes Augenmerk richtete er auf den Nachwuchs und in seiner Amtszeit gab es 19 Neueintritte. Auch für die Bildung seines
Nachwuchses sorgte er. Vier Mönche ließ er in Dillingen studieren, einen in Freiburg. Joachim Müller war in Dillingen und schloss mit dem Baccalaureat in der Bibelwissenschaft und der Theologie ab. Wolfgang Andreas Spieß war ebenfalls in Dillingen. Er wurde
später von der Stadt Solothurn als Administrator ans Kloster Beinwil berufen. Das Kloster befand sich damals im Pfandbesitz der Stadt und stand leer. Adelrich Johann Suter war ab 1582 in Dillingen, wobei die Angehörigen die weitere Ausbildung mit 100 Gulden
unterstützten. Martin Gassenhauser schloss auch in Dillingen mit dem Magister artium et philosophiae ab. Auch Medard Frei war in Dillingen. Joachim von Beroldingen studierte erst in Bologna mit gutem Erfolg Rhetorik und studierte danach in Freiburg weiter.
1575 wurde in Rom das Heilige Jahr begangen. Papst Bonifatius VIII. (1294-1303)hatte 1300 erstmals ein Jubeljahr ausgerufen, das alle 25 Jahre gefeiert wird. 1575 war auch Karl Borromäus dabei und in diesem Jahr wurde der Besuch der sieben Hauptkirchen Roms
eingeführt. Im November informierte er den Konvent und Schwyz von seinem Vorhaben. Versehen mit Empfehlungsschreiben des Konvents und von Schwyz machte er sich am 19. November begleitet von Pater Johannes Heider, den wir oben als Absolventen in
Freiburg erwähnt haben, auf nach Rom.Mit dabei waren auch Ludwig Bucher und Konrad Niggli. Unterwegs war man 4 Tage Gast bei Karl Borromäus, auf Antrag der katholischen Orte schon 1560 während des Konzils von Trient zum Protektor Helvetiae ernannt
worden, war dieser in Einsiedeln natürlich kein Unbekannter. An Silvester 1574 hatte der Abt eine Privataudienz bei Papst Gregor XIII. Es ging vor allem um die Bestätigung der Privilegien, wie dies Papst Pius IV.1563 gemacht hatte. Nur standen jetzt die
Bestimmungen des Konzils von Trient gegen Teile der Privilegien und so kam der Abt nicht zum Ziel. Am 3. März 1575 kehrte der Abt nach Einsiedeln zurück. Von Rom zurück kümmerte er sich verstärkt um Fahr. Er suchte wieder Klosterfrauen in Fahr anzusiedeln,
aus dem im Zuge der Reformation praktisch alle Nonnen aus dem Kloster ausgetreten waren. Er weilte gerade in Fahr, als in die Nachricht von einem erneuten Klosterbrand eintraf. Eine Bande von Mordbrennern hatte in der Gegend gehaust. Unter anderem hatte sie
ein Jahr zuvor in Chur einen großen Brand gelegt bei dem 53 Häuser zerstört wurden. Hauptmann Stör und seine Kumpane wurden gefasst und hingerichtet. Das Innere des Münsters war unzerstört, aber die Sakristeien und das Konventsgebäude fielen den Flammen
zum Opfer. Auch ein großer Teil des Dorfes wurde vernichtet. Die Mönche kamen dann für ein dreiviertel Jahr in Pfäffikon unter.
Zur Erinnerung an die Brandkatastrophe ließ der Abt am 24. April eine Prozession abhalten. Die St. Georgs-oder Reliquienprozess wird bis auf den heutigen Tag durchgeführt.
Unverzüglich wurde mit dem Wiederaufbau begonnen,aber es dauerte lange, bis alles wieder in Stand gesetzt war. Bald darauf bahnte sich auch ganz persönliches Unglück für den Abt an. Schon seit seiner Wahl hatte der Abt eine spürbare Opposition im Kloster,
vor allem in der Person Wolfgang Kalchofners, der von 1552-1553 Pfarrer auf der Ufnau war. Danach wurde er Dekan. Ab 1556 war er Statthalter in Pfäffikon, wo er 1573 starb. Möglicherweise wäre er selbst gerne Abt geworden.
Sein Verhältnis zu den Schirmherren war anfangs gut. Allerdings versuchten sie sich immer wieder in Klosterangelegenheiten ein zu mischen. Als 1571 der Stiftskanzler Jörg Dietschie aus Schwyz gestorben war, hätten die Schwyzer gerne wieder einen Schwyzer in
diesem wichtigen Amt gesehen und legten das dem Abt auch nahe. Dieser aber berief sich auf sein Recht der freien Wahl und bestellte den Glarner Walter Schiesser als neuen Kanzler. Dies wurde in Schwyz übel vermerkt. Die Klosteropposition hinterbrachte den
Schwyzern 1574, der Abt haushalte schlecht, worauf er sich im Januar 1574 vor dem zweifachen Rat verantworten musste. Der Abt führte dies auf üble Nachrede zurück. Das angespannte Verhältnis zeigte sich vor allem beim Klosterbrand. Zwar sandte Schwyz gleich
Boten zum Kloster. Er sandte Dekan und Kanzler um Hilfe an die Schirmherren, bekam aber nur zur Antwort, man habe kein Geld. Das Kloster ließ man lange warten, dem Dorf aber hatte man gleich Hilfszahlungen geschickt.Dann wurde dem Abt
auch lockerer Lebenswandel unterstellt. Als er im Frühjahr 1578 in Pfäffikon erkrankte, wurde das Gerücht gestreut, er leide an einer Geschlechtskrankheit. Es wurde ihm auch unterstellt, dass er 5 oder 6 Kinder habe. Der Abt wies das zwar zurück,
aber das Gerede war nun mal da. Der Abt wurde nun nach Schwyz bestellt. Dort wurde er erst mal auf dem Pfarrhaus festgesetzt. Für die innere Klosterverwaltung wurde der Dekan Ulrich Witwiler eingesetzt. Für das Äußere wurde der Schwyzer Ratsherr Balthasar
Kyd eingesetzt, der bald mit der Überprüfung der Stiftsfinanzen begann. Natürlich wandten sich beide Seiten an die vorgesetzte Kircheninstanz. Nuntius Bonhomini -er war 1579-1581 apostolischer Nuntius mit besonderen Rechten in der Schweiz. Vom Papst hatte
er alle Vollmachten, in dieser Angelegenheit vorzugehen.Dem Nuntius hatte der Abt bekannt, dass er zwei Söhne habe, von denen allerdings nur noch einer am Leben sei. Vom Nuntius wurde der Abt in Chur gehört. Dann erging schließlich am 11. Juli 1580 das
Urteil. Er sollte für 8 Jahre vorläufig der Verwaltung enthoben sein. Das Kloster durfte er in dieser Zeit nicht betreten oder sich ihm nur auf drei Meilen nähern. Die Schwyzer hatten auf eine Amtsenthebung hingearbeitet. Doch Bonhomini meinte, dass
dies nach kanonischem Recht nicht möglich sei. Die Lage war nicht besonders gut. Der Konvent wollte ein ordentliches Oberhaupt bekommen, zumal zu befürchten war, dass sich Schwyz weiterhin in klösterliche Belange mischte. Man fürchtet aber auch
Eingriffe des Abtes von St. Gallen oder von Rom einen fremden Abt aufgezwungen zu bekommen. So beschlossen Konvent und Schwyz gemeinsam, den Abt zu bewegen, dass er resigniert. Das tat er schließlich 1585 und machte so den Weg frei.
Seit 1579 lebte er in St. Gerold, 1580 übernahm er die Verwaltung der Propstei. Er verwaltete sie vorbildlich. Er starb 1610 vom Klerus der umliegenden Pfarreien als Vater und Führer respektiert. auch im Volke genoss er größtes Ansehen.
Ulrich Wittwiler stammt aus Rorschach ist als Sohn des Heinrich Wittwiler und der Agatha Gerschwiler 1535 geboren und legte 1549 unter Abt Joachim die Profess ab. Er wurde 1550 zum Subdiakon und 1551 zum Diakon geweiht. Er zählte zu den Mönchen, die von Abt
Joachim zum Studieren geschickt worden waren. In Freiburg schloss 1556 mit dem Master artium und philosophiae ab. Zum Priester wurde er am 21. Dezember 1556 geweiht. Von 1558 bis 1580 war er Pfarrer von Einsiedeln.
Nuntius Bonhomini bestellte ihn am 15. August 1579 zum Administrator des Stifts.
Am 23. Oktober wählte ihn der Konvent zum neuen Abt. Papst Sixtus V. (1585-1590)bestätigte die Wahl am 17. April 1586. Die Herren von Schwyz baten den Gardehauptmann der Schweizer Garde Jost Segesser von Brunegg, dass er sich beim Papst verwende, dass
dem Kloster die Annaten für die Wahlbestätigung erlassen würden und verwiesen auf den nicht lange zurückliegenden Klosterbrand, die Misswirtschaft des vorhergehenden Abtes und mehrere Jahre mit Missernten.Die Regalien verlieh ihm Kaiser Rudolf II (1576-
1612) am 23. Mai 1588. Er hatte auch ein Ladungen zu den Reichstagen von 1594 und 1597 erhalten,die beide vom Kaiser nach Regensburg einberufen waren.Abt Ulrich beauftragte den Abt von Weingarten, Georg Wegelin (1586-1617) für ihn die Huldigung beim
Kaiser vorzunehmen. Er delegierte den Weingartner Abt auch zum Empfang der Urkunde nach Prag. Der Weingartner Abt wurde 1604 Vorsitzender der oberschwäbischen Benediktinerkongregation und hatte in Ordenskreisen sicher schon einen guten Ruf, so dass es
nicht verwunderlich ist, dass Abt Ulrich gerade diesen Amtsbruder zu der Mission ausgesucht hatte.
Drei Schwerpunkte seiner Amtszeit lassen sich feststellen. Vordringlich war natürlich der Wiederaufbau des Stifts und die Schuldentilgung. immerhin waren mittlerweile 25 000 Gulden an Schulden aufgelaufen. Da war er sehr erfolgreich. Bis 1590 hatte er 40 000
Gulden verbaut, gleichzeitig aber 13000 Gulden Schulden abgebaut. Dazu hatte er noch Geld verliehen. Ein großes Augenmerk legte er auf die Mehrung des Reliquienschatzes der Kirche. Ab 1593 war Elias Heymann von Senheim, vormals Rektor der Universität
Trier versehen mit Empfehlungsschreiben von ihm in der Schweiz, aber auch in Italien, Österreich, dem Elsass dem Rheinland und natürlich auch in Trier unterwegs, um Reliquien für Einsiedeln zu erwerben. Auch für den Nachfolger von Abt Ulrich war er tätig.
Bedingt durch die Querelen um den alten Abt hatte es zunächst wenig Nachwuchs im Kloster gegeben. Aber in seiner Regierungszeit kamen doch 15 Neueintritte dazu. Und er sorgte dafür, dass weiter Mönche an die Universitäten gingen. Zu Dillingen und Freiburg
war noch Luzern als Studienort gekommen. Benedikt Kessel wurde kurz nach seiner Profess nach Monte Cassino geschickt. Er blieb dort 5 Jahre. Schon kurz nach seiner Rückkehr 1591 wurde er wegen Vergehen in Pfäffikon eingesperrt, wurde dann ins Kloster
zurückgerufen, aber schon ein Jahr später des Klosters verwiesen. Er wurde nochmals begnadigt, bald aber erneut rückfällig und wurde wieder eingekerkert. Er konnte entkommen und versah, dann eine Pfarrstelle in Graubünden. Allerdings fiel er dann vom
Glauben ab, wurde in Appenzell Prädikant und starb schließlich an der Pest.
Nicht nur Theologie oder Philosophie studierten Einsiedler Mönche. Bartholomäus Kolin studierte in München Musik und wurde ein hervorragender Organist. Allerdings starb er mit nur 32 Jahren an der Pest.
Nach dem Konzil von Trient wurde im Zuge der Gegenreformation ein starkes Gewicht auf die Reform auch des klösterlichen Lebens gelegt. Der Nuntius Bonhomini hatte die Angelegenheit des Abtes Adam Heer als auch willkommenen Anlass genommen, in der
Schweiz die Klosterreform anzugehen. Man beobachtete die klösterliche Disziplin sehr streng. Schon Bonhomini hatte ja weitreichende Vorschriften erlassen. Auch Abt Ulrich sorgte für Hebung der Klosterdisziplin. Für den Propst des Klosters Fahr hatte er 1586
eine eigene Ordnung erlassen.Auch Äbte anderer Klöster gingen wieder aus Einsiedeln hervor.Nachdem Bonhimini in Einsiedeln Abt Adam seines Amtes enthoben hatte, ging er nach Pfäfers weiter. Um dieses Kloster stand es nicht besser als in Einsiedeln.
Dort war Bartholomäus Spiess Abt (1575-1584), dem ebenfalls Misswirtschaft vorgeworfen wurde. und auch er lebte im Konkubinat. Bonhomini berief nun Johannes Heider nach Pfäfers als Verwalter ein. Nachdem Abt Bartholomäus 1584 starb folgte ihm Johannes
Heider als Abt nach. Andreas Hersch wurde 1592 zum Abt von Engelberg bestellt.
Auch Abt Ulrich hatte Probleme mit Konstanz. Darin liegt vielleicht der Grund, dass man sich intensiv um die Bestätigung der Exemtion mühte. Am 24.7. 1597 erfolgte dies so wie die Bestätigung der Privilegien durch Papst Clemens.
Am 10. Oktober 1600 starb Abt Ulrich.
Nur 5 Tage nach dem Tod des Abtes erfolgte die Neuwahl. Auch der resignierte Abt Adam Heer nahm an der Wahl teil. Augustin I. Hofmann wurde der neue Abt. Sein Vater Andreas hatte in Baden eine kleine Schule errichtet. Dieser stand er 14 Jahre vor.
Dann wurde er von Abt Joachim nach Einsiedeln an die Klosterschule berufen. In Einsiedeln heiratete er Anna Ochsner, mit ihr bekam er 4 Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Der Sohn Augustin wurde 1555 in Einsiedeln geboren. Schon mit 16 Jahren trat er hier ins
Kloster ein. Seine Profess legte er am 29. Juni 1572 ab. Er hatte noch drei Schwestern, die alle Nonnen im Klarissenkloster Paradies in Schaffhausen wurden. Augustin wurde 1579 Priester.Er war ein guter Musiker und wurde Stiftsorganist. 1583 wurde er von
Abt Ulrich zum Subprior berufen und ein Jahr später wurde er Dekan des Stifts.Schon vor der Wahl trafen die Mönche eine Vereinbarung und verpflichteten sich zu deren Einhaltung. Sie enthielt Grundsätze einer Reform. Das Hineinreden von Laien sollte verhindert
werden. Der Abt sollte drei Konventualen zu sich an den Hof holen, darunter den Ökonom und den Cellerar, die die Aufsicht über den Haushalt und die Ökonomie führen sollten. Klagen oder sonstige Vorstellungen sollten von einem dritten Pater
entgegengenommen werden, der diese dann dem Abt unterbreitete. Der Abt war somit entlastet und konnte sich uneingeschränkt seinem Amt widmen. Dass man es Ernst meinte mit der Minderung des Einflusses von Laien, zeigte sich schon bei der Wahl. Zwar waren
acht Abgeordnete von Schwyz mit ebenso vielen Dienern in Einsiedeln. Doch wurden sie erst nach der Wahl vom Ergebnis in Kenntnis gesetzt. Die Wahl fand unter dem Vorsitz des päpstlichen Nuntius statt Johannes della Torre (Nuntius von 1600-1606) statt.
Die Äbte Benedikt Rennhas, Fischingen und Johann Jodok Singisen, Muri assistierten. Diese Drei nahmen am Sonntag Lätare 1601 auch die Abtsweihe vor, nachdem Papst Clemens VIII. am 15. Februar 1601 den neuen Abt in seinem Amt bestätigt hatte. Zugleich
bestätigte er alle Temporalia und Spiritualia des Klosters. Abtsweihe und päpstliche Bestätigung des Abtes kosteten das Kloster insgesamt 1731 Gulden , wobei sich die Annaten allein auf 1472 beliefen. Kaiser Rudolf II. verlieh am 8. Oktober 1601 die Regalien an den
Abt. Da in der Regierungszeit des Abts der Kaiser zweimal wechselte, musste der Abt die Regalien nochmals zweimal beantragen. Kaiser Matthias (1612-1619) verlieh sie ihm im Oktober 1614 und Kaiser Ferdinand II. (1619-1637) machte dies am 8. März 1621.
Rudolf hatte auch die alten Freiheiten bestätigt.Wichtigstes Ereignis gleich zu Anfang der Amtszeit von Abt Augustin war die Gründung der Schweizer Benediktinerkongregation. Das Konzil von Trient hatte 1563 das Ordensdekret verkündet. Zwar ist jedes
Benediktinerkloster bis heute eine selbstständige Gemeinschaft unter einem Abt. Das Dekret schrieb nun vor, dass sich alle selbstständigen Klöster, die keinem Verband oder einem Generalkapitelangehörten, sich innerhalb eines Jahres zu einer Kongregation
zusammenschließen mussten. So schnell ging es aber doch wieder nicht. Aber in vier Schweizer Klöstern begannen Reformansätze zu wirken, so in St. Gallen, Einsiedeln, Muri und Fischingen. Nuntius della Torre machte sich nun für einen Zusammenschluss der
Klöster stark. Am 29. Mai 1602 bestellte er die Äbte von St. Gallen (Bernhard Müller 1594-1630)Fischingen (s.o.) und Muri (s.o.) nach Einsiedeln. Dort forderte er sie zur Kongregationsbildung auf. Die Gründung wurde in Einsiedeln beschlossen. Schon einen guten
Monat später, am 12. Juli 1602 trafen sie sich wieder in Wil. Dort wurden Reformmassnahmen besprochen, die in elf Artikeln formuliert wurden.
Beim nächsten Treffen in Pfäffikon am 4. November war Abt Michael Saxer (1600-1626) von Pfäfers dabei und bei der nächsten Sitzung in Rheinau am 12. Mai 1604 kam Engelberg mit Abt Jakob Benedikt Sigrist (1603-1619) dazu. Beide Äbte mussten vor dem Beitritt
versprechen, die beschlossenen Reformen anzunehmen. Disentis wurde 1617 in Muri in die Kongregation aufgenommen. Abt war Sebastian von Castelburg (1614-34) . Da der Abt aber in den Bündner Wirren fliehen musste, die weltliche Obrigkeit sich der
Verwaltung bemächtigte, griffen die Reformen aber erst unter dem aus Kloster Muri kommenden Administrator und Abt Augustin Stöcklin (1634-1641)nach 1634. Das Kloster Beinwiel kam wegen des Widerstands des Basler Bischof erst 1647 unter Abt
Fintan Kiefer (1633-1675) zur Kongregation. 1648 wurde es nach Mariastein verlegt. Nach der Verlegung an den Wallfahrtsort blühte es auf. 1647 waren damit alle Schweizer Benediktinerklöster, die die Reformation überstanden hatte in der Schweizer
Benediktinerkongregation vereint.
Die Statuten forderten tägliches Lesen der Messe. Die Mönche sollten ihre Mahlzeiten gemeinsam einnehmen, dabei geistliche Lesungen hören. Jedes Privateigentum wurde verboten. Nach der Komplet ist strengstes Stillschweigen einzuhalten. Auch darf
nichts mehr gegessen oder getrunken werden. Nächtliche Zusammenkünfte sind strengsten verboten. Frauen dürfen die Klausur nicht betreten. Die Äbte sollen mittags und abends für mässige aber gesunde Nahrung sorgen. Mönche, die bisher außerhalb der Klausur
wohnten, müssen nun in die Klausur zurück. Wenn der Abt zu Versammlungen musste, darf er nur zwei, höchstens drei Diener mitbringen.Neben diesen praktischen Lebensregeln griff die Kongregation aber auch bei materiellen oder personellen Notlagen ein,
zum Beispiel nach Brandfällen oder bei materieller Misswirtschaft. Die Kongregation wurde am 29. Mai 1602 von Papst Klemens VIII. gegründet und am 13. Dezember 1608 von Papst Paul V. approbiert.
Die Päpste verliehen der Kongregation die Exemtion. Gregor XV. tat dies 20. Mai 1622, sein Nachfolger Urban VIII. am 30. März 1624. Jurisdiktionsstreitigkeiten gab es trotzdem wegen des Visitationsrechts von Bischöfen, des Vorsitzes bei der Abtswahl, des Rechts
auf Wahlbestätigung, der Abtsweihe und noch anderen Steitpunkten.
Die Schweizer Kongregation hatte durchaus Anziehungskraft und auch ausländische Klöster baten um Mithilfe bei der Durchführung von Reformen. Kempten war von 1664-1679, Murbach von 1666-1686 und Fulda von 1672-1679 der Schweizer Kongregation
angegliedert. Wegen des Adelsprivileg konnten diese Klöster aber nicht dauernd bei den Schweizern verbleiben.
Eine große Bewährungsprobe wartete auf den Abt in den Pestjahren. Drei mal grassierte die Seuche in Einsiedeln. Auf die Seuche im Jahr 1611 hatte man sich gut vorbereitet. Man hatte nicht nur zum Sakramentenempfang, zu einer Prozession nach St. Gangulf
und zu ernster Lebensführung aufgefordert, sondern auch sanitäre Vorschriften gegeben. Die Klosterapotheke gab besondere Medizinen aus. Zwei bis drei Totengräber wurden bestimmt und es wurde angeordnet, dass die, die am gleichen Tag sterben sollten, in
eine gemeinsames Grab gelegt wurden. Wie man aus den Todesfällen im Konvent schließen kann, grassierte die Seuche ab September und Oktober in Einsiedeln. Der Pfarrer von Einsiedeln. P. Markus Eichhorn und der von Freienbach, P. Johann Schlachter erlagen
der Pest. Im Konvent fielen ihr noch zwei Patres und zwei Fratres zum Opfer. 1626 wütete die Seuche erneut, doch traf es diesmal keine Konventsmitglieder. Nur drei Jahre später schlug die Pest erneut zu. Dieses Mal fielen ihr zwei Patres zum Opfer.
Als Konsequenz hatte der Abt beschlossen, den Friedhof fürs Dorf weg von der Klosterkirche auf den heutigen Platz zu verlegen.
Großes Gewicht legte der Abt nach wie vor auf die Ausbildung seiner Mönche. 15 studierten in Dillingen. Pro Platz beliefen sich die Kosten auf 50 Gulden, die meist in Naturalien und dies überwiegend in Käse bezahlt wurden. In München studierten 4 Leute aus
Einsiedeln, hier wurde mit Ziegen bezahlt. 5 Mönche waren in Freiburg, einer in Salzburg und zwei in Mailand. Von den Freiburger Studenten ist vor allem Johann Fridolin Rößler zu nennen. Er hatte zunächst in Dillingen Syntax studiert. Dort wurde er 1617
Baccalaureus und 1618 Magister der Philosophie. 1619 wurde er zum Priester geweiht und 1624/25 studierte er Theologie in Freiburg.Seit 1620 wurde in Einsiedeln ein eigenes Hausstudium eingerichtet, an dem Pater Rößler Philosophie und Theologie unterrichtete.
Schwierigkeiten gab es 1615 mit den Jesuiten. Im Vorjahr hatten zwei Jesuiten bei der Engelweihfeier geholfen, Beichte zu hören.Die Jesuiten schlugen nun vor, 6 Jesuiten auf Kosten des Stifts in Einsiedeln unterzubringen und zu unterhalten.
Das war allerdings nicht im Sinne des Abtes. Gute Beziehungen hatte er zu Kardinal Verallo, der von 1606-1608 auch Nuntius in Luzern war und auch zu einigen Kapuzinermönchen. Im Zusammenspiel brachten sie den Papst dazu, das Ansinnen der Jesuiten fallen zu
lassen. Streitigkeiten gab es auch zwischen Weingarten und Einsiedeln. 1613 kaufte Kloster Weingarten von den Grafen von Sulz die Herrschaft Blumenegg. Teile gehörten auch zur Herrschaft Sankt Gerold, in denen ja Einsiedeln das Sagen hatte.
Kaiser Ferdinand II. hatte in dieser Sache die Äbte Johann Eucharius (1616-1631)von Kempten und Bernhard Müller von St. Gallen, sowie den Bischof Heinrich V. von Knöringen (1599-1646) von Augsburg sowie den Grafen Hugo von Montfort als Richter bestellt.
Sie sollten versuchen die Sache gütlich zu regeln oder sich dann richterlich zu entscheiden. Sie wurde erst erledigt, als Einsiedeln 1648 von Weingarten die Landeshoheit kaufte.
Die Beziehungen zu Konstanz waren nicht sehr gut. Die Innerschweiz fühlte sich von Konstanz abgeschlossen. Man ersuchte deshalb, den Abt von Einsiedeln zu ermächtigen, Glocken und Paramente zu weihen. Auch erhoffte man die Berechtigung,
die Firmung zu spenden, was der Abt von Einsiedeln ja schon mal hatte. Man wollte den Abt von Einsiedeln zum Bischof machen, um die vernachlässigten innerschweizer Pfarreien besser betreuen zu können. Konstanz erfuhr davon und konnte dies mithilfe des
Metropoliten von Mainz hintertreiben.
Als Abt war Augustin ein reger Bauherr. In Einsiedeln ließ er ein neues Bibliotheksgebäude errichten. Die Kirche ließ er durch den Maler Hans Heinrich Gessner ausmalen. Zwei neue Orgeln wurden aufgestellt.
Die Teufelsbrücke ließ er 1614 reparieren.
Probleme scheint er mit der Gesundheit gehabt zu haben. Dreimal suchte er Bäder auf. Am 20. Februar 1629 erlitt er einen Schlaganfall, an dessen Folgen er am 2. März 1629 verschied.
Das Kapitel versammelte sich und beschloss, Nuntius Rocci (in der Schweiz 1628-1629 Nuntius) zu benachrichtigen und zur Wahl einzuladen. Nicht benachrichtigt und nicht zur Wahl geladen wurde Schwyz. Das Verhältnis scheint nicht ungetrübt gewesen zu sein.
Im Konvent wurde kolportiert, einige Schwyzerherren hätten behauptet, sie könnten den Einsiedler Abt nach Gutdünken ein- und absetzen.Seit der Berufung von Abt Ludwig Blarer hatten immer Vertreter der Schwyz der Abtswahl beigewohnt. Das wurde immer
mehr als Eingriff in die Rechte des Kapitels betrachtet. Zufälligerweise aber waren Landamman Reding und der Schwyzer Seckelmeister in Einsiedeln. Dort erfuhren sie von der anstehenden Wahl und verlangten, teilzunehmen. Nuntius Rocci, der ja geladen und
auch anwesend war, forderte die beiden auf, ihre Beweise vorzulegen. Das konnten sie natürlich nicht. Am nächsten Tag forderten sie eine Audienz beim Kapitel und nochmals der Wahl bei zu wohnen. Das Kapitel bestimmte aber drei Männer, denen sie ihr
Anliegen vorbringen konnten. Ihre Forderung bei der Wahl dabei zu sein, wurde abgewiesen. Ihnen wurde mitgeteilt, dass sie nach erfolgter Wahl vorgelassen würden, zum Tod des alten Abts kondolieren könnten und dem neuen zu seiner Wahl zu gratulieren.
Gewählt wurde Plazidus Reimann am 9. März 1629. Er war am 19. August 1594 in Einsiedeln geboren.Er entstammte einer Familie, die schon 1384 in Einsiedeln erwähnt wird.Er legte 1611 seine Profess ab.Danach studierte er in Dillingen und wurde am 10. April 1617
Baccalaureus der Philosophie. Er erkrankte und wurde nach Einsiedeln zurückberufen. 1618 wurde er zum Priester geweiht.1620 musste er nochmals ins Bad nach Griesbach. Als er zurückkehrte wurde er in Einsiedeln Novizenmeister. 1622 war er Pfarrer und
Beichtiger im Kloster Münsterlingen. 1628 wurde er in Einsiedeln Statthalter und nur ein Jahr später wurde er im Alter von 34 Jahren zum Abt gewählt. Die Wahl fand am 6. März statt. Da ein Schreiben in Rom liegen blieb, erfolgte die Bestätigung
aus Rom erst am 29. Oktober 1629. Die Weihe nahm Nuntius Rocci am 25. November vor. Die Äbte von Muri Johann Jodok Singisen (1596-1644) sowie Placidus Brunschwiler (1616-1672) von Fischingen assistierten ihm.
Abt Placidus hatte zwei Brüder, der eine Augustin war seit 1626 Amann des Gotteshauses, der andere, Johann Georg war Vogt der Waldstatt. Durch ihre Heiraten waren sie mit angesehenen Schwyzer Familien verwandt.
Das Emporkommen der Familie weckte auch Neid, insbesondere Ludwig Öchslin, der frühere Vogt hatte seine Probleme. Er war schon vorher wegen Schimpfreden gegen den verstorbenen Abt aufgefallen. Deswegen hatte er in Gegenwart einiger Abgeordneter von
Schwyz vor Abt Placidus Reimann und einiger Konventualen Abbitte zu leisten. Eigentlich hätte der ehemalige Vogt öffentlich widerrufen müssen. Darauf hatte der Abt aber verzichtet. Die Abbitte wurde am 2. April getan. Die Retourkutsche kam aber schnell.
Abt Augustin hatte einen neuen Friedhof anlegen lassen, was ja eine Konsequenz auf die Pest war. Abt Placidus wollte nun am 20. April den neuen Friedhof den neuen Friedhof weihen. An diesem Tag aber protestierte der Rat und verbot Beerdigungen auf
dem neuen Friedhof. Schwyz legte er Einspruch ein. Man begründete das so, dass der Friedhof zu weit weg sei. Somit würde der Toten auch zu wenig gedacht. Der Abt nun berief sich auf seine landesherrliche Befugnis, diese Entscheidung zu treffen. Ein Schreiner
aus dem Elsass war gerade in dieser Zeit gestorben und diesen ließ der Abt nun auf dem neuen Friedhof bestatten. Schwyz suchte nun zu vermitteln, aber Vorschläge wie z. B. dass ärmere Einsiedler auf dem neuen Friedhof ihre letzte Ruhe finden sollten,
besser situierte aber nach wie vor auf dem alten Friedhof zu beerdigen seien, waren für alle Einsiedler unannehmbar. Als sich Schwyz aber voll auf die Seite des Abtes stellten, mussten die Einsiedler nachgeben. Es ging jetzt nur noch um die bereits aufgelaufenen
Kosten. Die Einsiedler baten um Übernahme der Hälfte der Kosten, wozu sich der Abt aus Güte schließlich bereit erklärte. Bald gab es aber auch Schwierigkeiten mit Schwyz. Im weitesten Sinne ging es um die Landeshoheit. Die Schwyzer hatten mehr und mehr
versucht, die Abtei voll unter ihre Oberhoheit zu bringen, was ja durchaus im Zug der Zeit lag. Gerade die protestantischen Fürsten hatten ja gezeigt, dass der Deckmantel Religion beziehungsweise Konfession sich auch vorzüglich zur Machtausweitung eignete.
aber auch katholische Gegenden machten sich dieses Prinzip voll zu Nutze. Dass die Abtei da ihre eigen Position wahren wollte, hatte der Konvent schon bei der Wahl von Abt Placidus gezeigt. Beide Seiten versuchten genauestens ihre alten Vorrechte zu wahren.
Das begann bei der Rechnungslegung. Schwyz wollte eine spezifizierte Rechnung des Klosters vorgelegt, das Kloster legte nur eine allgemeine Generalrechnung vor. Auch bei der Rechtssprechung wurde haarklein auf Zuständigkeiten geachtet. Der Abt verwahrte
sich dagegen, dass Gotteshausleute sich vor anderen Gerichten als vor seinem verantworten mussten, auch wenn die Tat außerhalb der Gemarkung des Stifts vorgefallen war.Weiterer Zündstoff lag in anfallenden Kriegskosten beziehungsweise Stellung von
Truppenkontingenten. So forderte Schwyz Leute an für einen Zug nach Bellinzona. Die Einsiedler wollten aber nur mit Zustimmung des Abtes ziehen, die dieser dann auch erteilte. Als die Schweden in Deutschland eingriffen und sich die allgemeine Lage verschärfte,
hatte das auch Auswirkungen auf die Eidgenossenschaft. 1631 forderte Schwyz eine Aufstellung der Waffen, die in Einsiedeln vor zu finden waren. 1633 fielen schwedische Truppen im Thurgau ein, um Konstanz zu belagern. Daraufhin ließ auch Schwyz seine
Truppen mobilisieren, was natürlich Kosten verursachte. Die Schwyz lieh sich vom Kloster insgesamt 3000 Gulden, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass dies eine rückzahlbare Anleihe und keine Kriegssteuer sei. Schwyz bestätigte dies, versuchte aber später
trotzdem dies als Steuer zu deklarieren. Nur Kriege waren teuer und Schwyz benötigte mehr Geld. Also schrieb man 1634 eine Landessteuer aus. Der Beschluß wurde allerdings gefasst, ohne den Abt zu begrüßen. Darin sah dieser eine Verletzung seiner Rechte.
Er versuchte die Angelegenheit zunächst gütlich zu regeln. Man verhandelte in Rothenturm am 7. und 8. April 1636. Der Abt war ebenfalls anwesend und man schien einer Lösung nahe zu kommen. Doch dann schlug die Stimmung plötzlich um, woran Ludwig Öchslin,
der schon früher als Scharfmacher gegen den Abt aufgetreten war, nicht unbeteiligt gewesen zu sein schien. Am 22. April 1637 forderte Schwyz eine unverzügliche Einlieferung der Steuer. Der Stiftsammann überließ in dieser Sache für Einsiedeln die Entscheidung dem Abt,
seinem Bruder. Abt Placidus untersagte die Einlieferung der Steuer. Nun eskalierte die Angelegenheit weiter. Schwyz bestellte am 3. Mai 1637 mit Konrad Heinrich ab Yberg einen Landvogt für Einsiedeln. Schon einen Tag später hatte sich der Abt an den päpstlichen
Nuntius gewandt. Das war von 1630-1639 Ranuccio Scotti (1597-1659). Aber auch Schwyz hatte den Nuntius kontaktiert. Der Abt suchte auch die Vermittlung der katholischen Orte. Der Nuntius hatte darauf verwiesen, dass die Einsetzung eines Landvogts für
Einsiedeln wohl eher eine Sache sei, die den Kaiser berühre. Schließlich war der Abt ja auch Reichsfürst. Einsiedeln hatte auch den kaiserlichen Abgeordneten, Freiherrn Peter von Schwarzenberg in Luzern informiert.Über den Nuntius ging die Sache nun auch an
den Papst. Von allen Seiten ergingen Mahnungen an Schwyz. Das fruchtete aber nichts. Schwyz war entschlossen, die Angelegenheit ohne Vermittlung durchzufechten. Die Sache eskalierte weiter. Schwyz hatte den Stiftsammann als Rebell erklärt und seine
Güter eingezogen, nachdem er nicht in Schwyz erschienen war, der Nuntius drohte mit Kirchenstrafen, der Kaiser verwandt sich in Schwyz fürs Kloster. Schwyz verwies auf die Gefahren, die den anderen Ständen dadurch für Demokratie und Souveränität drohe.
Erst 1642 fruchteten die Friedensbemühungen allmählich. Am 20. April 1642 hatte ein großes Brandunglück Schwyz getroffen. Der Abt sandte trotz aller Streitigkeiten als einer der ersten eine Soforthilfe von 400 Kronen, das versöhnte weiter. Man verhandelte und
am 10./11.9. 1642 hatte man eine grundsätzliche Verständigung gefunden. Allerdings dauerte es noch drei Jahre bis zu einem formellen Friedensvertrag. Am 21. Juni 1645 kam er schließlich zustande. Billig war das nicht. Nach Berechnungen des Abtes
hatte der langwierige Streit das Kloster 11.848 Gulden gekostet. Aber das Stift hatte seine Unabhängigkeit bewahrt. Wie oben erwähnt wurde auch der lange schwelende Streit zwischen den Klöstern Weingarten und Einsiedeln erst unter Abt Placidus erledigt.
Auch gegen Eingriffe des Bischofs in Konstanz in seine Zuständigkeit musste der Abt sich zur Wehr setzen. 1639 hatte er zwei Konventuale aus Einsiedeln Pater Kolumban Ochsner (+1656) und Pater Wolfgang Weishaupt (+1676)nach Rom geschickt. Am Collegium
studierten sie Theologie und privatim wurden sie von Doktor Anton Nanni in kanonischem Recht unterrichtet. Nach Abschluss ihrer Studien besuchten sie noch die beiden bedeutenden Benediktinerabteien Subiaco und Monte Cassino. Beide hatten dem Abt mit
ihren nun erworbenen Rechtskenntnissen erklärt, dass er aufgrund der päpstlichen Privilegien volle Jurisdiktionsgewalt über den ihm unterstellten Ordens-und Weltklerus, aber auch das ihm untergebene Volk habe. Einen Ehehandel in Kuhbach zog der Abt nun
vor sein Offizialat.Das Offizialat entschied den Fall, aber eine Partei wandte sich nun an Konstanz. Das Bistum nahm den Einspruch an und berief die andere Partei vor sein Gericht. Dagegen verwahrte sich nun der Abt und leitete die Streitsache an Rom weiter.
Er hatte sich an Pater Wilfrid Selby gewandt, den Prokurator also den Ordensbeaufragten der englischen Benediktiner. Bei Selby hatten die beiden nach Rom entsandten Patres gewohnt, als sie ihre Rechtsstudien in Italien absolvierten.Der Papst, zu der Zeit
Innozenz X. (1644-1655) wies 1646 die Sache an den Nuntius in Luzern das war von 1646-1647 Alphonsus Sacrati. Der Nuntius lud nun den Konstanzer Bischof vor sich, dass war Sixt Werner Vogt von Altensumerau und Praßburg (1645-1689). Der schickte seinen
Dompropst nach Luzern und ließ erklären, dass er zu Verhandlungen bereit sei.
Abt Placidus ließ nun seien Rechtstitel dem Bischof unterbreiten. Man kam zu keiner Einigung. Es gab weitere Versuche so 1652 auf Einladung des Bischofs. Der Abt kam nach Münsterlingen. Man kam sich in der Sache aber nicht näher. Beide Seiten beharrten immer
wieder auf ihren Positionen und Vermittlungsbemühungen von verschiedenen Seiten scheiterten. Die Sache zog sich. Auch eine Konferenz in Luzern 1665 erbrachte nichts. Der Nuntius schlug schließlich vor, die Frage in Rom einem Kardinalskollegium vor zulegen.
Am 15. Mai 1668 entschied der Papst, inzwischen Clemens IX (1667-1669)dass die Bulle Leos X. vom 10. Dezember 1518 sich nur auf das Stift, nicht aber auf dessen Pfarreien beziehe. Das war allerdings nicht im Sinne des Stiftes. Es erreichte immerhin,dass die
Untersuchungen wieder aufgenommen wurden. Der Abt bestellte eine Fünferkommission, die sich vorab damit befassen sollte. Das Ende dieses Streits aber erlebte weder der Abt noch sein Nachfolger. Auch mit dem Bistum Chur hatte es Schwierigkeiten gegeben.
Dort konnte man sich allerdings einigen. Nuntius Frederico Borromeo (1655-1663) erreichte 1665 einen Vergleich zwischen Bistum und Stift.
Ein gutes Verhältnis hatte der Abt zum Kaiser. Drei Jahre nach dem Amtsantritt von Abt Plazidus bestätigte Kaiser Ferdinand II. (1619-1637) dem Kloster die Rechte und Privilegien. Die Regalien verlieh der Kaiser dem Abt am 5. März 1632. Er stand beim Kaiser wohl in
hohem Ansehen und erhielt am 16. März 1636 die Würde eines kaiserlichen Pfalzgrafen. Auch die Nachfolger des Kaisers, Ferdinand III.(1637-1657) und Leopold I.(1658-1705) bestätigten die Privilegien 1639 bzw. 1660. Als der 30-jährige Krieg in Deutschland tobte,
war das Kloster auch eine Zufluchtsstätte für Amtsbrüder aus deutschen Klöstern. So erhielten die Äbte von Weingarten, Ochsenhausen, Fulda, Gozau und Isenburg ein Obdach in Einsiedeln.Und auch Konventuale wurden in Einsiedeln aufgenommen. Bis zu 30
Mönche aus anderen Klöstern kamen in Einsiedeln unter.St. Peter im Schwarzwald hatte sogar sein Archiv, seine Reliquien und seine Kostbarkeiten bei ihren Schweizer Ordensbrüder in Sicherheit gebracht. Seinerseits ließ der Abt die Einsiedler Reliquien und
das Archiv während des 1. Villmergerkriegs nach Schwyz verbringen (5.Januar-7. März 1656). Eine führende Rolle nahm das Stift auch in der Schweizer Benediktinerkongregation ein. Abt Plazidus wechselte sich im Vorsitz mit dem Abt von St. Gallen Pius Reher
(1630-1654)ab. Auch in der Kongregation musste er sich mit dem Bistum Konstanz auseinandersetzen, denn das Bistum versuchte die Privilegien, die Papst Urban VIII. der Kongregation verliehen hatte, zu beseitigen. Der Prokurator der englischen Benediktiner
Wilfried Selby wurde auch zum Prokurator der Schweizer Benediktiner berufen und erwirkte am 26. September 1631 ein Dekret, dass die Privilegien als zu Recht bestehen ließ. Bestätigt wurde dies auch von Papst Leo X. 1646, nachdem anläßlich der Abtswahl in
Rheinau erneut Streit ausbrach. Von 1630-1644 war Dominikus Tschudi Sekretär der Schweizer Benediktinerkongregation. Er hatte 1613 seine Profess in Muri abgelegt. Als Sekretär sammelte Tschudi 1636 alle bis dahin ergangenen Erlasse. Die Äbte approbierten dies
als erweiterte Satzung und am 2. Dezember 1636 wurden sie in Einsiedeln promulgiert. Das ist ein Vorgang der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt zu vergleichen, d.h. diese Sammlung erhielt nun in der Schweizer Kongregation praktisch
Gesetzeskraft. Problem gab es mit den Klöstern Pfäfers und Disentis.Beide Abteien waren in Schieflage geraten. Vor allem Muri, später auch St. Gallen kümmerten sich um die Klöster. Zwei Äbte aus Muri, ab 1634 August Stöcklin und ab 1642 Adalbert Bridler
brachten das Kloster wieder vorwärts. Für einige Zeit schlossen sich auch die Klöster Kempten und Murbach der Kongregation an. Die Schweizer Benediktiner unterstützen ihre Brüder bei der Hebung der Ordenszucht. Mönche aus St. Gallen wirkten in Murbach
und von Einsiedeln wurde zunächst Christoph von Schönau nach Kempten abgeordnet. Dieser hatte am 9. Juni 1647 seine Profess abgelegt. In Kempten war Roman Giel von Gielsberg 1339 in einer für Kempten schwierigen Zeit zum Abt gewählt worden.
1632 hatten protestantische Bürger der Stadt Kempten zusammen mit den Schweden das Stift in einen Trümmerhaufen verwandelt.Der Konvent war in Schloss Schwabelsberg nahe Kempten versammelt. Der Abt strebte für seinen Konvent strenge
Askese an. Außerdem wollte er die Ordensgemeinschaft auch für nichtadelige Mitglieder öffnen. Das scheiterte aber am Widerstand der Reichsritterschaft. 1664 wurde der Einsiedler Mönch Christoph nun auf Bitten der schwäbischen Ritterschaft und des
Konstanzer Bischofs als Subprior nach Kempten geschickt.Am Anfang scheint seine Tätigkeit ziemlich schwierig gewesen zu sein, zumal Abt Roman als schwierig galt, ein schroffes Wesen hatte und auch sehr sprunghaft war. Auch hat er wohl seinem Schweizer
Mitbruder das Leben schwer gemacht. Erst unter Abt Bernhard Gustav von Baden-Durlach änderte sich das. Sein Rat wurde geschätzt und er war auch Begleiter von Kemptener Mönchen in Fulda,Köln und Bonn. Er wollte schon 1671 nach Einsiedeln zurückkehren,
musste aber bis 1678 in Kempten bleiben, ehe er als Dekan nach Einsiedeln zurück durfte. Als weiterer Einsiedler Mönch war Pater Benno Zimmermann in Kempten. Er wirkte dort von 1664 bis 1670 als Theologieprofessor.
Auch andere Mönche aus Einsiedeln waren als Lehrer tätig. An der Benediktiner-Universität in Salzburg lehrte Augustin Reding als Theologieprofessor von 1654-1657. Später wurde er dann Nachfolger von Abt Plazidus.Auf Pater Augustin folgte Pater Bernhard Waibel
1657 in Salzburg. Er hatte 1638 seine Profess abgelegt. In Salzburg hatte er die Professur für spekulative Theologie und Exegese inne. Er war acht Jahre Vizerektor des Salzburger Kollegs und zwei Jahre Prokanzler der Universität. 1667 musste er zurückkehren,
da ihn der Abt wegen der Konstanzer Angelegenheit nach Rom schicken wollte. 1671 erbat ihn der Salzburger Erzbischof Max Gandolf von Kuenburg (1668-1687) für den Wallfahrtsort Maria Plein. Dort sollten sich jüngere Kräfte auf ihre Lehrtätigkeit in Salzburg
vorbereiten. Älteren Lehrkräften wurde die Möglichkeit gegeben, sich dorthin zurück zu ziehen. In Gengenbach wirkte Pater Basilius Strecker von 1655-1657 als Philosophieprofessor.
In der 40 –jährigen Amtszeit von Abt Plazidus werden 85 neue Mitglieder in den Konvent aufgenommen. Auch Pater Raphael Gottrau hatte unter Abt Plazidus die Profess abgelegt. Er wurde sein übernächster Nachfolger. Pater Bonifaz Tschupp hatte 1645
seine Profess in Einsiedeln abgelegt. 1667 wurde er zum Abt von Päfers gewählt.
Auch in weltlichen Angelegenheiten war der Abt ein gesuchter Vermittler. 1639 trafen sich erstmals Vertreter von Frankreich und Bayern, um dem mörderischen Ringen ein Ende zu machen. In Einsiedeln kamen die Gesandten zusammen. Inwieweit
der Abt dabei beteiligt war, ist nicht klar, aber es war das erste Mal überhaupt in diesem großen Krieg, dass Gespräche gesucht wurden. Im Schweizer Bauernkrieg von 1653 wurde der Abt vom Großen Rat von Luzern um Vermittlung gebeten.
Allerdings waren die Leidenschaften zu stark aufgepeitscht, so dass die Vermittlungsbemühungen des Abtes zunächst nicht zum Ziel kamen. Auch im Zwyerhandel war sein Rat gefragt. Freundschaftliche Beziehungen hatte der Abt auch zu anderen Orden,
so den Schweizer Kapuziner und Franziskanern. Die Wallfahrt nahm unter Abt Plazidus großen Aufschwung. Gerade in sehr schweren Zeiten suchen Menschen vermehrt Trost. Nach einem erfüllten Leben verstarb Abt Plazidus am 10.Juli 1670.
Augustin Reding wurde am 10. August 1625 in Lichtensteig geboren. Dort war sein Vater Johann Rudolph von Reding-Biberegg Landvogt des Fürstabts von St. Gallen. Der Vogt war in zweiter Ehe mit Margareta Pfyffer von Altishofen verheiratet. Er wurde wegen
seiner klassischen Bildung gerühmt und gelegentlich “eidgenössischer Cicero” oder der Seneca der Schweiz genannt. Zwei Brüder Augustins gingen ebenfalls ins Kloster. Als Jost Dietrich 1652 geboren trat er in Einsiedeln ins Kloster ein und erhielt dort den
Ordensnamen Plazidus. 1668 legte er seine Profess ab. Ein weitere Bruder Heinrich wurde Jesuit in Freiburg im Üchtgau. Dort starb er 1682. Auch drei Schwestern nahmen das Ordensgewand. Maria Katharina war Zisterzienserin in Magdenau, Maria Margaretha war in
St. Maria zu den Engeln in Wattwil und Maria Mechthild schließlich war Priorin in Fahr von 1696 bis 1724. Augustin legte 1641 seine Profess ab. 1649 wurde er Priester und schon vor seiner Priesterweihe wurde er mit 24 zum Lehrer der Philosophie bestellt. Abt
Plazidus wollte seinem jungen Lehrer akademische Würden verschaffen. Der Rektor der Universität Johann Caspar Helbing signalisierte Entgegenkommen. Er erlangte in Freiburg ohne vorher die Universität besucht zu haben, die akademischen Grade. Am 5. und 12.
Oktober 1654 legte er in Freiburg die Prüfungen ab. Er erhielt den Grad eines Lizentiaten, das ist die Lehrbefähigung und Magister der Theologie. Augustin wurde dann als Professor an die 1622 gegründete Benediktineruniversität in Salzburg geschickt. Der Salzburger
Erzbischof Guidobald(1654-1668)schätzte ihn sehr und ernannte ihn zu seinem Geistlichen Rat.1657 rief Abt Plazidus seinen geschätzten Lehrer nach Einsiedeln zurück.
Er hatte ihn auf inständige bitten des Erzbischofs und der Äbtissin von Nonnberg, wo er das Amt des Beichtvaters versah schon ein Jahr länger als Abt Plazidus es beabsichtigt hatte. Augustin übernahm von Pater Bernhard den Lehrstuhl für Theologie. Der Abt
ernannte ihn auch zu seinem Offizialen.In dieser Funktion sollte er dem Abt vor allem im Streit mit Konstanz zur Seite stehen. 1659 wurde Augustin Dekan. Das verlieh seiner Verhandlungsposition noch mehr Gewicht. Einmal liess er aus Versehen eine von Konstanz
gegen Einsiedeln erwirkte Bulle fallen. Das wurde sofort so interpretiert, als habe sie Augustin aus Verachtung fallen lassen. Der Bischof verhängte die Suspension über den Abt, das ist das Verbot der Amtsausübung. Über Augustin und 15 Kapitularen aber wurde die
Exkommunikation verhängt. Zwar hob der Nuntius dieses Vorgehen sofort auf, aber als Hebel bei der Abtwahl diente es wohl doch. Am 16. Juni 1670 hatte ihn das Kapitel zum Gehilfen des kranken Abts gewählt. Einen knappen Monat später verstarb Abt Plazidus
und es war klar, wer der neue Abt werden sollte. Augustin wurde zum neuen Abt gewählt. Er sandte sofort zwei Patres nach Konstanz, die dort erstens seine Wahl zum Abt meldeten und gleichzeitig seinen Willen zur friedlichen Beilegung des Streites bekunden
ließen. Der neue Amtsinhaber erklärte sich bereit, die bischöfliche Gerichtsbarkeit anzuerkennen, Visitationen der Klosterpfarreien zu zu lassen und auf die Appellation nach Rom zu verzichten. Dafür erhoffte er, dass Entgegenkommen in anderen strittigen
Punkten gezeigt wurde. Gleiches ließ er auch in Rom verlauten. Aber Konstanz setzte alle Hebel in Bewegung und erreichte dass die Konsistorialkonkregation (1588 von Papst Sixtus V. gegründet) die Abtswahl für ungültig erklären liess. Als dies in Einsiedeln
bekannt wurde, stellte Abt Augustin sofort sein Amt zu Verfügung. Aber er wurde erneut einstimmig gewählt. Allerdings war klar, dass die Bestätigung aus Rom kaum mehr zu Erreichen war. Aber am 1. Juli 1671 bestätigte Papst Clemens X. (1670-1676) die Wahl.
Am 17. Juli 1670 war Augustin zum Abt gewählt worden. Schon 4 Tage später berief er das erste Generalkapitel ein und bekundete die Absicht, dies alle drei Jahre zu tun. Er sah sich so um Einklang mit der Regel aber auch mit den Bestimmungen,die Papst Benedikt
XII. 1336 in seiner Bulle “Summi magistri”(kurz Benedicta) erlassen hatte. Ein Pater sollte ihn bei der Rechnungsführung unterstützen. Außerdem bestimmte er drei Kapitularen,denen wollte er jährlich Rechenschaft über den ökonomischen Stand des Klosters
ablegen. Dieser sollte schriftlich im Dekanat hinterlegt werden. In St. Gerold wollte er die Klausur einführen. Er wollte auch ihre Meinung der Mönche zum Weitergang des Konstanzer Handels hören. Wie vorgesehen fand 3 Jahre später also 1673 das nächste
Generalkapitel statt. Dabei ging es hauptsächlich um die Stellung der Expositi, also der Patres, die ihn den Klosterpfarreien tätig waren. Beim dritten Generalkapitel 1679 wurden vor allem die Baupläne des Abtes besprochen. Beim letzten Generalkapitel 1682 wurde
vor allem über Pfäfers geredet,die Verhältnisse dort, die Novizenaufnahme und die Abtwahl. 1682 umfasste der Konvent 100 Mitglieder und dabei sollte es nach Meinung des Abtes auch bleiben. Es war schon eine große Leistung, einen solchen Konvent zu führen.
Daneben schwelte weiter der Streit mit Konstanz. Er betätigte sich als Vermittler in mehreren Streitigkeiten.So vermittelte er eine Sache zwischen dem Stift Schäni und Benken, bei der es um eine Kollatur ging. Auch einen Streit zwischen Luzern und dem damaligen
Nuntius in der Schweiz Odoardo Cibo (1670-1679) konnte er beilegen, was sicher auch an den guten Beziehungen zwischen Abt und Nuntius lag. Das Professbuch erwähnt auch den Beistand, den der Abt der bayrischen Benediktinerkongregation gab, als es um deren
Errichtung und damit verbunden vor allem die Exemtion ging. Der bayrische Episkopat hatte bis zuletzt versucht dies zu verhindern. Im Professbuch steht, dass Kardinal Scarlatti erklärt habe, dass die Kongegregation ihre Exemption dem Kloster Einsiedeln verdanke.
Um das genau zu beurteilen, müsste man aber wohl die Korrespondenz des Abbate Scarlatti lesen, die mir leider nicht zugänglich ist. Sie ist im Diözesanarchiv Passau “Die Errichtung der Benediktinerkongregation in Bayern” (lateinisch-italienisch)
Erwähnt werden muss noch, dass Scarlatti nicht Kardinal war, sondern als Gesandter für Bayern in Rom tätig war. Seit 1678 hatte das Kurfürstentum wieder eine diplomatische Vertretung beim Heiligen Stuhl. Sie wurde in der Zeit von Angehörigen der Familie
Scarlatti wahrgenommen. Am 16. Juni 1684 trafen sich die Äbte von 18 bayrischen Klöstern, die die bayrische Benediktinerkonkregation gründen wollten, unterstützt von Kurfürst Max Emanuel. Sie wurde am 26.8.1684 durch das Breve von Papst Innozenz XI.
(1676-1689) gegründet. Vorbild für die Kongregation war die Helvetische Kongregation. Deswegen wurde sie auch der Jurisdiktion des Nuntius in Luzern unterstellt. Das Treffen der bayrischen Äbte fand in der Zeit statt, als sich auch Augustin in Rom aufhielt.
Augustin war von März bis Juni dort, um sich persönlich um den Streit mit Konstanz zu kümmern. Seine theologische Arbeit war in Rom ja durchaus beachtet worden. Am 28. April hatte er eine Audienz beim Papst. Er konnte dem Papst nicht nur seine Werke
über das Tridentiner Konzil und das auf päpstlichen Wunsch verfasste Buch über die Annalen des Baronius vorlegen, sondern er konnte auch den Streit mit Konstanz aus Einsiedler Sicht erläutern. Der Papst befragte ihn auch eingehend über die kirchlichen
Verhältnisse in der Schweiz und in Deutschland. Er beklagte sich dabei, dass die Bischöfe in Deutschland sich viel mehr um ihre weltlichen als die geistlichen Angelegenheiten kümmerten. Den Streit mit Konstanz wollte er aber nicht ohne neue Überweisung an die
Kommission entscheiden.
Wenn man sich vor Augen hält, wie der Abt von seinen durch das Kloster vorgegebenen Aufgaben auch zeitlich in Anspruch genommen war, kann man seine schriftstellerische Produktion nur bewundern. Seine Schrift übers Konzil von Trient sowie über die Annalen
des Baronius wurde oben erwähnt.Die Schrift für das Tridentinum umfasste 8 Bände und erschien von 1677-1684.Sie richtete sich hauptsächlich gegen den Züricher reformierten Theologen Johann Heinrich Heidegger (1635-1698), der von 1659-1665 in Steinfurt in
Westfalen als Professor lehrte. Von 1667 bis zu seinem Tod lehrte er in Zürich. In seinen kontrovers theologischen Schriften setzt er sich vor allem mit dem Konzil von Trient, den Wallfahrten und der unbefleckten Empfängnis auseinander. Cesare Baronio (+ 1607)
war italienischer Kirchenhistoriker, Schüler des Philipp Neri und hat eine große Kirchengeschichte von Christi Geburt bis 1198 verfasst. nicht zuletzt wegen dieser Leistung wurde er apostolischer Protonotar, Kardinal (1596) und schließlich Bibliothekar der
Vatikanischen Apostolischen Bibliothek. Johann Heinrich Ott (um 1617-1682) war Professor für Hebräisch und ab 1668 für Kirchengeschichte. Dieser hatte Baronio in seinen Schriften angegriffen. Auf Wunsch von Papst Innozenz hatte Augustin seine
Verteidigungsschrift “Vindex veritatis annalium ecclesiasticorum Baronii” verfasst.1688 schrieb er die “Oeconomica cathedra apostolica”, die sich vor allem mit Gallikanismus auseinandersetzt. Darin hatte sich vor allem das Autonomieverständnis der
französischen Kirche manifestiert. Unter Ludwig XIV. erreichte diese Bewegung ihren Höhepunkt. Exponent war der französische Bischof von Meaux Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), unter dessen Federführung auf dem Nationalkonzil von 1682 die
4 gallikanischen Artikel verkündet wurden. Diese Schrift Augustins fand in Rom die größte Anerkennung. Sein Hauptwerk ist die Theologia scholastika. Sie erschien von 1697 an in 13 Bänden.
Natürlich lagen einem solchen Abt die Studien in seinem eigenen Kloster besonders am Herzen. Er unterrichtete noch selbst im studium kontroversisticum. Die Abtei genoss den besten Ruf. Einsiedler Konventualen wurden nach Engelberg,
Pfäfers, Maria Stein und Ebersmünster erbeten. Aber auch nach Einsiedeln kamen Mönche, um dort Unterricht zu erhalten, so aus Pfäfers, Kempten und Gengenbach.
Nachdem Muster der Benediktineruniversität sollte auch für die Schweiz eine Benediktinerakademie gegründet werden. Sitz sollte das Kloster Pfäfers sein. Das Projekt kam aber nicht zustande.
Die Konfirmation des Abtes aus Rom hatte sich ja wegen der Konstanzer Einsprüche verzögert. So konnte der Abt auch erst nach 1671 um die Verleihung der Regalien beim Kaiser einkommen. Er hatte dafür Dr. Franz von Mayersheim bestellt. Begleitet wurde
dieser von den Grafen Brandis. Aus Kostengründen wollte der Abt nur die Verleihung der Regalien ohne die Bestätigung der Privilegien. Er wurde darauf hingewiesen, dass das eine nicht ohne das andere gehe. Insgesamt mussten dafür 1800 Gulden aufgewendet
werden. Zum Hause Habsburg hatte der Abt ein sehr herzliches Verhältnis. So wurde er durch einen eigenen Gesandten von der Geburt des späteren Thronfolgers Joseph I. persönlich benachrichtigt.
Auch als Landesvater war Augustin tätig. Gleich nach seinem Amtsantritt versuchte er Seiden-und Baumwollweben als Hausindustrie einzuführen, umso den Erwerb zu mehren. Im Stift selbst ließ der Abt eine Wollweberei einführen, über die zunächst
P. Rupert von Roll(bis Oktober 1675) die Aufsicht führte. Auch auf die Entsumpfung der Moore sollte mehr Augenmerk gelegt werden. Man konnte sie als Heu und Streuwiesen nutzen.
Zwei Erwerbungen in der Zeit Augustins waren wichtig. In Bellenz (Bellinzona)hatte er auf Drängen der Orte Schwyz, Uri und Unterwalden, die dort regierten, das dortige Gymnasium von den Jesuiten übernommen. Diese hatten in Bellenz seit 1646 eine
Schule geführt, aber 1674 den Unterricht eingestellt. Das Kapitel war zunächst dagegen. Man war aber gezwungen, auf die Orte Rücksicht zu nehmen und auch Nuntius Odoardo Cybo (1670-1679)hatte sich stark gemacht. Also wurde Pater Wolfgang Weißhaupt, der
ja 1639 zum Studium der Theologie und des kanonischen Rechts von Abt Plazidus nach Rom geschickt worden war, nach Bellenz gesandt. Er sollte dort die Übernahme untersuchen. Er wurde dann auch zum Propst der neuen Niederlassung bestimmt, starb aber schon
im Folgejahr und wurde in Bellenz bestattet. Mit Pater Wolfgang war Pater Pius Kreuel (Profess 1659) geschickt worden, um die neue Niederlassung in Augenschein zu nehmen. Er musste auch schon 1676 nach Einsiedeln zurückkehren, um dort die Stiftsorgel zu
reparieren. Drei weitere Patres und ein Frater kamen nach Bellenz, um dort den Unterricht zu übernehmen von etwa 30 Schülern zu übernehmen. Pater Aegidius Effinger (Profess 1647) wirkte von 1675-1677 als Lehrer in Bellenz. Pater Roman Steinegger arbeitete
als Grammatiklehrer in Bellenz, starb aber schon am 18.Januar 1677 an einem heftigen Fieber, das er sich wohl bei einem Krankenbesuch zugezogen hatte. Pater Meinrad Steininger (Profess 1662)war Professor der Theologie, als er die Stelle in Bellenz übernahm.
Er war bis 1677 in Bellenz.Frater Maurus von Roll (Profess 1669)war seit 1675 als Prokurator tätig.1677 feierte er seine Primiz. Danach war er weiter für die Finanzen der jungen Niederlassung tätig. Anselm Bissling (Profess 1662)war auf Pater Wolfgang Weißhaupt als
Probst in Bellenz gefolgt. 1680 stürzte er in Bellenz vom Pferd. er wurde danach zwar nochmals leidlich hergestellt, verstarb aber im April 1681. Sein unmittelbarer Nachfolger, Pater Eustach Reutti vertrug das Klima in Bellenz nicht, und musste schon einen Monat
später nach Einsiedeln zurück. Auf ihn folgte Pater Desiderius Scolar (Profess 1663), der 13 Jahre Propst in Bellenz war. Abt Augustin war zeitlebens ein großer Gönner des Bellenzer Gymnasiums und besuchte es drei Mal persönlich.
Ein weiterer wichtiger Erwerb war die Herrschaft Sonnenberg in Thurgau. Das dortige Schlossgut war zuletzt im Besitz der Familie von Beroldingen. Der letzte Besitzer Sebastian Ludwig von Beroldingen hatte es zunächst dem Kloster Einsiedeln angeboten.
Da er aber keinen katholischen Käufer gefunden hatte,veräußerte er die Herrschaft für 80.000 Gulden an die Stadt St. Gallen. Aber die Herrschaft sollte nicht in nichtkatholische Hände gelangen. Nun machte der Bruder des Besitzers sein Zugrecht geltend, also das
Recht des nächsten Erben, ein aus der Familie veräußertes Grundstück binnen eines Jahres gegen Ersatz von Preis und Kosten , dieses wieder an sich zu ziehen. Luzern wandte sich zusammen mit dem Nuntius an Einsiedeln. Die Kaufsumme wurde nun auf die
Schweizer Klöster verteilt und die Herrschaft erworben. Auch der Papst war durch den Nuntius von dem Vorfall unterrichtet. Er sprach den Äbten sein Lob aus, war doch ein für die katholische Sache wichtiger Vorposten erhalten geblieben.
Nicht erfolgreich war der Abt dagegen auch beim Versuch, alten Stiftsbesitz im Elsass zurück zu erwerben.
Relativ ruhige Zeiten hatte die helvetische Benediktiner Kongregation. Nur das Kloster Pfäfers war in Schwierigkeiten geraten. 1665 war das Kloster niedergebrannt.Abt Justus Zink (1645-1677), in dieser Zeit Abt, war der Lage nicht gewachsen. Der Nuntius
bewegte ihn zum Rücktritt. Mit Bonifaz Tschupp, bisher Stiftsdekan in Einsiedeln wurde ein neuer Abt bestellt. Die Schwierigkeiten hielten aber an. Man wollte das Kloster ganz aufheben und die Mönche auf andere Klöster verteilen. Dann aber beschlossen
die in Einsiedeln versammelten Äbte, Päfers zunächst auf 30 Jahre mit Einsiedeln zu vereinigen. 1682 kam die Union zustande. Sie wurde allerdings mit dem Tod von Abt Augustin wieder aufgehoben.
Abt Augustin vermehrte den Reliquienschatz des Klosters. Unter ihm wurde die Große Monstranz fertiggestellt. Für den täglichen Gebrauch ließ der Abt eine weitere Monstranz fertigen.
Abt Augustin genoss großes Ansehen. Sein wissenschaftlicher Ruf, aber auch der seiner Konventualen waren unbestritten.
Gegen Ende der 80-iger Jahre wurde der Abt der Abt von einem Stein-und Bruchleiden geplagt. Sein Zustand verschlechterte sich. Im Dezember erhielt er auf eigenen Wunsch mit Pater Adelrich Suter (Profess 1657) einen Koadjutor.
Er verstarb am 13. März 1692.
Unter seiner Regierung hatte sich die Zahl der Konventualen fast verdoppelt. Allerdings hatte sich auch der Schuldenstand des Klosters vergrößert, was dann den Nachfolger doch etwas belastete.
Am 24. März 1692 wurde Raphael von Gottrau zum neuen Abt gewählt. Er war der 2. Sohn des Francois Pierre Jean Gottrau und der Marie Margerite Weck als Francois Othmar geboren. (alle Daten aus Gottrau,de Gottrau site genealofique et heraldique du canton de
Fribourg)Im 14. Jahrhundert blühte das Städtchen Freiburg im Üechtland vor allem durch den Leder-und Tuchhandel auf. Auch die Familien Gottrau und Weck waren in diesem Geschäft reich geworden und gehörten ab dem Ende des Jahrhunderts dem städtischen
Patriziat an. Abt Raphael hatte 9 Geschwister, 6 Brüder und drei Schwestern. Sein Vater gehörte dem Familienzweig der Grange-Montagny an und war 1662 Vogt von Bulle und seit 1670 Ratsherr in Freiburg. Franz Othmar studierte am Jesuitenkolleg St. Michael in
Freiburg. 1665 trat er ins Kloster Einsiedeln ein.
Am 25. April 1666 legte er als Frater Raphael seine Profess ab.Am 15. August 1670 wurde er in Pfäffikon zum Priester geweiht.Er wurde 2. Exorzist in Einsiedeln und ab 1574 war er Bibliothekar in Einsiedeln. Im Sommer 1676 schickte ihn Abt Augustin an die Schule
nach Bellenz, doch schon im November kam er nach Einsiedeln zurück. 1678 war er wieder 2. Bibliothekar in Einsiedeln. Er sollte zusammen mit dem Bibliothekar Leodegar Fleischlin (Profess 1656) die Neuordnung der Bibliothek voranbringen. Nach der Union mit
Pfäfers wurde Raphael als Dekan nach Pfäfers geschickt, doch auch dort blieb er nicht lange. Schon ein halbes Jahr später kehrt er zurück. 1684 war er ein halb es Jahr Brüderinstruktor. Er sollte dann nach Fahr, wurde aber nach Münsterlingen als Pfarrer beordert.
Dort vertrug er aber das Klima nicht und er kam schon im Februar nach Einsiedeln zurück. Obwohl Raphael Ämter immer nur kurze Zeit innehatte und auch nie lange an einem Ort blieb, wurde er am 24. März 1692 zum Abt gewählt. Das geschah allerdings erst im
dritten Wahlgang. Die päpstliche Bestätigung durch Innozenz XII. (1691-1700) erfolgte am 15. Oktober 1692. so konnte auch die Abtweihe erst am 28. Dezember 1692 statt. Der neue Nuntius Marcello d’Aste (1692-1695) nahm die Weihe unter Assistenz der Äbte von
Pfäfers Bonifaz Tschupp und Muri Plazidus Zurlauben vor. Kaiser Leopold I. verlieh die Regalien am 3. September 1694.
Die finanzielle Lage des Stiftes zwangen den Abt schon gleich zum Handeln. Dass er erst im dritten Wahlgang zum Zug kam, hatte ja auch mit dieser Situation zu. Eine Fraktion der Äbte hätte lieber einen in weltlichen Angelegenheiten erfahrenen Verwalter als
neuen Abt gesehen. Die Schuldenlast des Klosters betrug nicht weniger als 208 860 Gulden, was immerhin eine Zinslast von 7000 Gulden verschlang. Ein Verkauf war angeraten. Sonnenberg war aus politischen Gründen kaum machbar.
Also dachte man an Ittendorf. Das wurde kurz nach dem 30-jährigen Krieg 1650 vom Kloster Salem mit allen Rechten und Gütern erworben. Von 1671-1677 baute es das Kloster Einsiedeln als Statthalterei zum Schloss aus. Heute ist es nach einer Volksabstimmung
1972 ein Stadtteil von Markdorf. Die älteren Mönche waren gegen den Verkauf, doch Abt Raphael sah sich zum Handeln gezwungen. Rupert von Roll (Profess1668), der wir gesehen haben, 1675 der Wollweberei vorstand, war seit 1692 Statthalter in Einsiedeln.
Er wurde vom Abt nach Ittendorf geschickt, um das Anwesen in Augenschein zu nehmen. Der Fürstbischof von Chur Ulrich von Federspiel (1692-1728) zeigte sich am Erwerb der Herrschaft interessiert, war allerdings nicht bereit mehr als 70.000 Gulden zu zahlen.
Der Bischof von Konstanz schlug einen Tausch mit Gütern im Thurgau vor. Damit wäre dem Stift, das ja Geld brauchte, nicht gedient gewesen. Aber das Kloster Weingarten zeigte sich stark interessiert. Weingarten hatte nach dem verheerenden Krieg von 1618-1648
vor allem unter Abt Wegelin, der noch während des Krieges regierte, einen enormen Aufschwung genommen. Der Weingartner Prior war 1693 in Einsiedeln. Die Sache wurde dem Kapitel vorgetragen und von 40 Kapitularen sprachen sich 36 für den Verkauf aus.
Der Verkaufspreis wurde zunächst auf 178.000 Gulden festgelegt, allerdings wollte Weingarten nur 132.000 zahlen. Nach zähen Verhandlungen einigte man sich schließlich auf 136.000 Gulden. Ganz reibungslos ging es nicht, da die Herrschaft Heiligenberg,
die Stadt Überlingen, das Stift Salem und der Bischof von Konstanz noch Rechtsansprüche geltend machten und deshalb gegen den Kauf Einspruch erhoben. Am 14. März 1693 gab das Stiftskapitel sein Zustimmung zu dem Verkauf. Zur Regelung des Verkaufs wurden
die Patres Ottmar Reutti (Profess 1652) 1691 Propst von St. Gerold und Benno Zimmermann (Profess 1654) nach Ittendorf geschickt. Weingarten war ein guter Schuldner. Schon am 23. Mai 1693 wurde das erste Geld nach Einsiedeln geschickt. Bereits im Dezember
scheint die komplette Schuld getilgt gewesen zu sein. Zwar gab es in dieser Sache noch 1697 Verhandlungen vor dem Landgericht in Weingarten. Der Verkauf aber war durch. Das Kloster verwendete sofort 121.642 Gulden zur Tilgung und hatte so seine Schuldenlast
um mehr als die Hälfte reduziert.
Ein weiteres Problem war mit der Auflösung der Union mit Pfäfers bereinigt. Stand noch der Streit mit dem Bistum Konstanz an. In Konstanz war Marquard Rudolf von Rodt 1689 zum Fürstbischof gewählt worden. Die Bischofsweihe fand 1690 statt. Der Abt hatte ihm
durch den Stiftsdekan gratulieren lassen. Auch als Pater Benno wegen des Ittendorfer Kaufs dort war, ging er in Meersburg vorbei und ließ durch den Abt ausrichten, dass er an einer Lösung des Streits interessiert wäre. Auch vom Kapitel bekam der Abt freie Hand in
der Sache. Der Abt setzte auf eine persönliche Begegnung und als er im Juni 1693 im Thurgau war, ging er von Freudenfels ins Chorherrenstift Kreuzlingen und von dort nach Meersburg. Dort stieg er im Bären ab und ließ dem Fürstbischof seine Ankunft melden
und bat um eine Audienz. Man wurde sich einig, Advokaten aus dem Spiel zu lassen. Abt Raphael schlug vor, die Äbte von Weingarten Willibald Kobolt (1683-1697) und St. Gallen Cölestin Sfondrati (1687-1696) mit der Vermittlung zu betrauen. Sie hatten sich dazu
bereit erklärt. Am 10. Dezember 1693 wurde ein Treffen im Augustinerchorherrenstift Öhningen vereinbart. Vom Kloster Einsiedeln kamen Pater Meinrad Steinegger, mittlerweile Subprior in Einsiedeln und Josef Dietrich, damals Statthalter in Freudenfels.
Auf Konstanzer Seite verhandelten Generalvikar Johannes Blau (1692-1694) und Offizial Johann Hugo Kessler (1692-1711). Man einigte sich über dem Stifte unterstellten Pfarreien in Einsiedeln, Freienbach, Oberkirch-Kaltbrunn, Feusisberg, Ettiswil, Reichenburg,
Maria Zell bei Sursee, Ägeri, Eschenz, Sarmenstorf und Wagen. Der Bischof sollte in all den Kirchen als Ordinarius gelten. Auch in der Stiftskirche sollte der Bischof die Pontifikalien ausüben dürfen, das heißt Weihen vornehmen. Doch von jeglicher Jurisdiktion,
Visitation und Korrektion blieb sie ausgenommen. In diesem Fall wurden die Rechte des Bischofs auf den Abt übertragen. Es wurden noch Regelungen, die Weltgeistliche betrafen. Am 12. Januar 1694 stimmte das Kapitel dem Konkordat zu. Damit wurde ein Streit
abgeschlossen,der über Jahrzehnte geschwelt hatte. Das war das wichtigste Ereignis in der Regierung von Abt Raphael.Schon 1698 trat er von seinem Amt zurück und machte gesundheitliche Gründe geltend. Er ging nach Freudenfels, wo er am 4. Januar 1707
verstarb. In der Propsteikirche Klingenzell ist er bestattet.
Nachdem Abt Raphael am 30. September 1698 von seinem Amt zurückgetreten war, versammelte sich das Kapitel am 04.10. zur Wahl des neuen Abtes. Johann Josef von Roll war am 30. September 1653 als Sohn des Landvogts und Hauptmann Philipp von Roll und der
Maria Gugger geboren worden. Seine Familie zählte zu den vornehmsten in Solothurn. Am 4.August 1669 legte er die Profess ab und erhielt den Ordensnamen Maurus. Kurz nachdem er Subdiakon geworden war, wurde er 1675 nach Bellenz in die neue Schule
geschickt. 1676 kehrte er nach Einsiedeln zurück, um die weiteren Weihen zu empfangen. Am 20.Dezember 1676 wurde er zum Priester geweiht. Seine Primiz durfte er in Solothurn feiern. Damit wurde auch die Bedeutung seiner Familie gewürdigt.
1677 kehrte er nach Bellenz zurück, wo er das Amt des Prokurators versah. Am 24. Oktober 1693 wurde er zum Propst von Bellenz. Die Niederlassung blühte unter ihm. Er erwarb sich einen guten Ruf als Verwalter und Vorgesetzter. Das hat wohl dazu
beigetragen, dass er am 5. Oktober zum Abt erwählt wurde. Es waren vier Wahlgänge erforderlich. Den Vorsitz führte der Nuntius Giulio Piazza (1698-1702). Bei der Wahl waren auch Abt der Abt von Muri, Plazidus Zurlauben und der von St. Gallen, Leodegar
Bürgisser (1696-1717) anwesend. Am 30.03.1700 bestätigte Papst Innozenz XII den neuen Abt in seinem Amt. Die Abtsweihe erfolgte dann am 10. Oktober 1700 praktisch mit denselben Agierenden. Weniger glücklich verlief die Verleihung der Regalien.
Zum einen gab es Schwierigkeiten mit dem kurtrierischen Residenten in Wien, von Heunisch. Dieser sollte sich um die Verleihung der Regalien bemühen und erhielt dazu insgesamt 2000 Gulden. Das schien ihm nicht zu reichen und er verlangte mehr.
Es ergaben sich jahrelange Rechtsstreitigkeiten, in deren Verlauf Kaiser Leopold starb.Ein Freiherr von Au und Philipp Jakob Kistler sollten nun die Verleihung vorwärts bringen. Kaiser Joseph I. (1705-1711) erteilte am 7. Oktober 1706 die Investitur. Wie es scheint
wurde darüber allerdings kein Diplom erstellt, da die Angelegenheit mit von Heunisch immer noch strittig war. Auch Kaiser Joseph starb 1711 bei einer Pockenepidemie, die im Frühjahr 1711 Österreich heimsuchte. Unter einem neuen Kaiser, Karl VI. (1711-1740)
wurden die Reichsinsignien schließlich am 22. August 1714 verliehen. Das hatte sich wegen des spanischen Erbfolgekriegs 1701-1714, in den auch Karl noch verwickelt war, nochmals verzögert. Nur 7 Tage später, am 29.8. 1714 verstarb Abt Maurus an einem
Schlaganfall.
Das wichtigste Vorhaben in der Amtszeit von Abt Maurus war der Klosterneubau. Schon unter Abt Plazidus gab es Überlegungen in dieser Richtung. Unter Abt Augustin wurde mit dem Bau des Chores und der Beichtkapelle der Anfang der Baumaßnahmen ergriffen.
Problem war aber nach wie vor die Schuldenlast des Stiftes.Aber die alten Gebäude waren in schlechtem Zustand, der Konvent wuchs. Und so wurde ein Neubau unabhängig von der Finanzlage immer dringlicher. Am 8. Februar 1702 gab das Kapitel Günes Licht.
Frater Caspar Moosbrugger sollte einen Riss und ein Modell des neuen Klosters erstellen. Mit seinem Bruder Johann Moosbrugger wurde ein Vertrag über die Bauausführung abgeschlossen. Am 25. März 1704 teilte der Abt den katholischen Orten seine Bauabsicht
mit und am 31. März wurde der erste Spatenstich zum Neubau gemacht.
Ein bisschen genauer soll hier Caspar Moosbrugger betrachtet werden. Er wurde am 15. Mai 1656 als Sohn des Christian und der Anna Beer in Au im Bregenzer Wald geboren. Dort begründete Michael Beer (*1605) die Auer Zunft. Seine Idee war, dass das ganze Dorf
sich auf den Bau von Kirchen spezialisierte. In der Auer Zunft waren Baumeister, Maurermeister, Zimmerleute, Steinmetze und Stukkateure vereinigt. Die wichtigsten Familien waren Beer, Thumb und Moosbrugger und Kuen. Zwischen 1670 und 1700 war fast die
gesamte männliche Bevölkerung von Au im Bauhandwerk tätig. Andreas machte eine Maurer und Steinmetzlehre in Au. 1673 wurde er von Christian Thumb (1645-1725) freigesprochen. Bei ihm hatte er auch seine Lehre gemacht. 1673 hatte der Konvent in
Einsiedeln ja beschlossen, den Chor zu vergrößern. Abt Augustin hatte den Bau an den Bregenzer Baumeister Johann Georg Kuen (1642-1691) vergeben. Unter ihm arbeitete Andreas Moosbrugger als Steinmetz in Einsiedeln am Bau des Chores und der Beichtkirche.
1681 bewarb er sich um die Aufnahme ins Kloster. Nach positivem Bescheid legte er am 21. November 1682. Er nahm den Ordensnamen Caspar an. Das Kloster erkannte seine Fähigkeiten und förderte sie. Er bildete sich fort. Er kopierte publizierte italienische
Architektur und konstruierte sie nach. Eine seine ersten Arbeiten war die Magdalenenkapelle, das ist der Chor der Beichtkapelle im Stift. Im September 1683 war er in Disentis. Dort hatte er für Abt Adalbert de Medell (1655-1696). Dort legte er für den geplanten
Klosterneubau “ettlich Riss” vor. Schon kurz danach bat der Weingartner Abt Willibald Kobold Bruder Caspar um mit ihm über den Weingartner Klosterneubau zu sprechen. Die Architektur der Weingartner Klosterkirche, der größten Barockkirche nördlich der Alpen
fußt weitgehend auf den Plänen von Bruder Caspar.So wie es aussieht, wurde der Rat Bruder Caspars immer gefragter. Im Dezember 1684 wurde er nach Muri bestellt. Abt Plazidus Zurlauben plante in Muri einen Klosterneubau. In Muri übernahm er die Planung und
ab 1694 die Ausführung. In Fischingen plante und baute er zwischen 1685-1687 die neue Klosterkirche. In Münsterlingen folgten 1691 die Klausurgebäude . Zwischen 1694 und 1698 wurde die Klosterkirche in Muri erbaut. Ab 1704 war er mit der Planung von
Einsiedeln betraut. Diese Aufgabe nahm ihn auch so stark in Anspruch, dass andere Projekte zurücktraten. Um 1715 war Caspar Moosbrugger wohl nochmals in seiner Heimat in Au. Dabei entstanden wahrscheinlich die sogenannten “Auer Lehrgänge”, das sind zwei
Skizzenbücher. Der erste Teil enthält einen allgemeinen Teil zur fachlichen Ausbildung. Daran schließt ein Kapitel über “die Prinzipien der Geometrie” an. Dann folgen Skizzen von Säulen-, Mauern- und Fassadenteilen, sowie Altäre und Chorgestühl und Grundrisse.
Der zweite Teil enthält Grundrisse und Architekturentwürfe von ausgeführten und nicht ausgeführten Projekten. 1720 war er nochmals in St. Gallen dort entwarf er für den Abt Joseph von Rudolfi (1717-1740) Pläne für den Kirchenneubau in St. Gallen.
Bruder Caspar verstarb am 26. August 1723. Nach seinem Tod wurde er als “archtitectus celeberissimus” bezeichnet. Seine Bedeutung liegt vor allem in der Weiterverarbeitung vorhandener Tendenzen. So haben auch Franz Beer in Weißenau und Dominikus
Zimmermann in Steinhausen seine Idee von der Ovalchorlösung aufgegriffen.
Nach diesem Exkurs zurück zu Abt Maurus. Neben der Bautätigkeit waren kleiner Probleme zu lösen. Kleinere Reibereien mit Schwyz mussten beseitigt werden. Schwierig war die Getreideversorgung wären des Spanischen Erbfolgekriegs,
da die süddeutschen Getreidemärkte durch die Kriegsereignisse für die Innerschweiz gesperrt waren. Wie auch während des 30-jährigen Krieges kamen eine Reihe von Flüchtlingen aus anderen Abteien nach Einsiedeln, so aus Ochsenhausen,
Wiblingen, Murbach und Schuttern.
1702 feierte die Schweizerische Benediktiner prunkvoll, wie das im Barock üblich war ihr hundertjähriges Bestehen.
Mit nur 61 starb Abt Maurus. Auf ihn folgte nach der Wahl am 13. September 1714 Thomas Schenklin. Er wurde am 24.Juni 1681 in Rorschach geboren. Sein Vater war Johann Jakob Schenklin, der erst Lehensvogt in St. Gallen und unter Abt Gallus Alt fürstäbtlicher
Kanzler von St. Gallen.
Aus seiner Familie waren schon zwei Äbte hervorgegangen, Markus von Schenkli (1540-1553), der aus St. Gallen kam. Er errichtete das im Zug der Reformation erloschene Kloster in Fischingen wieder.Auch im Kloster von Alt St. Johann regierte ein Mitglied der
Familie als Abt,nämlich Albrecht. 1697 wurde er ins Kloster aufgenommen unter der Bedingung, dass sein Lebensunterhalt gesichert sei. Ihm wurden dann 400 Taler Erbteil von zu Hause zugesichert. Am 8. Dezember 1698 legte er als erster unter Abt Maurus
die Profess ab. Am 28. März 1705 wurde er zum Priester geweiht. In den Jahren davor war er schwer erkrankt, genas aber wieder. Er hat wohl auch Philosophie studiert, denn im Oktober 1706 wurde er von Abt Maurus als Philosophiedozent nach Bellenz geschickt.
Drei Jahre später kam er zurück nach Einsiedeln, wo er Klerikern in Philosophie und Theologie Unterricht gab. Am 10. April 1771 wurde er Kapitelsekretär. Vor seiner Abtswahl war er Fraterinstruktor und Subprior. Als Sekretär war er während des Toggenburger
Kriegs in mehreren Missionen des Abt Maurus tätig. Der Toggenburger Krieg ging vom 12. April bis zum 11. August 1712 war ein Konflikt, der sich an Auseinandersetzungen des St. Galler Abt Leodegar Bürgisser mit seinen reformierten Untertanen in der
Grafschaft Toggenburg entzündete. Siehe dazu Blog St. Gallen.
Bei der Wahl zum Abt führte Martin Battaglino den Vorsitz, der Auditor der Nuntiatur. Der Nuntius Giacomo Carraciolo (1710-1716 weilte zu der Zeit in Lugano. Die Äbte von Muri, Plazidus Zurlauben und Rheinau Gerold II. Zurlauben (1697-1735) waren anwesend.
Papst Clemens XI. (1700-1721) bestätigte die Wahl am 23. Februar 1715. Die Weihe nahm der päpstliche Nuntius unter Assistenz der Äbte von Muri und Rheinau am 7. Juli 1715 vor.
Am 23. März 1716 verlieh Kaiser Karl VI. die Regalien. Die Bestätigung der Privilegien erfolgte aber erst am 30. April 1720. Am 13. August 1718
hatte der Kaiser den Blutbann über St. Gerold verliehen.
Drängendste Aufgabe für den neuen Abt war die Weiterführung und Vollendung des Stiftbaus. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit begann er mit dem weiteren Ausbau. Bis 1718 war der Stiftsbau mit Ausnahme des nördlichen Halbflügels beendet. 1719 befragte der
Abt das Kapitel wegen des Neubaus, den schon Abt Augustin erwogen hatte. Der Konvent hatte wegen der zu erwartenden Schuldenlast zunächst gezögert. Das Kapitel gab nun sofort seine Zustimmung, zumal Bruder Caspar doch schon älter war und kränkelte.
Mit Michael Rueff, der ja schon nach dem Tod von Johann Moosbrugger 1710 an seine Stelle getreten war, wurde ein Vertrag geschlossen. Michael Rueff war der Schwager von Johann und Vormund seiner Kinder.
Man legte das alte Münster nieder in dem Maß, wie der Neubau fortschritt, um den Gottesdienst möglichst wenig zu beeinträchtigen. Im August 1723 hatte man nach intensiver Beratung auf den eigentlich vorgesehenen Kuppelbaus zu verzichten zum einen
aus Kostengründen zum anderen aber auch wegen des für für einen Kuppelbau ungünstigen Klimas. 1726 waren die Türme fertiggestellt worden und im Oktober konnten die Glocken aufgezogen werden. Damit war die Kirche im Äußeren fertig. Auch für en Innen-
ausbau hatte der Abt hervorragende Kräfte gewonnen. Am 19. Februar 1724 hatte Abt Thomas Aegidius Asam (1692-1750)als Stukkateur und Cosmas Damian Asam(1696-1739) als Maler unter Vertrag genommen. Sie arbeiteten von 1724-1726 im Kloster Einsiedeln.
1730 arbeiteten Diego (1674-1750) und Carlo (1686-1775)Carlone, beide aus der italienischen Künstlerfamilie aus Scaria. Diego hatte in Einsiedeln 16 Figuren geschaffen sowie die allegorischen Verzierungen an den 8 Altären im Hauptschiff sowie die beiden
Grabdenkmäler über der Gruft der Fürstäbte. Carlo hat die Altarblätter des Benedikt und Meinradsaltar geschaffen. Sowie der Planer der Einsiedler Kirche ihre Vollendung nicht erleben durfte, hat auch Abt Thomas die Vollendung des kircheninneren nicht mehr
erlebt. Er verstarb mit 53 Jahren am 27. August 1734.
Auf Abt Markus folgte Nikolaus Imfeld. Er wurde am 25. April 1694 als Sohn des Johann Sebastian und der Maria Ursula Imfeld in Sarnen geboren. Er wurde auf den Namen Anton Sebastian getauft. Sein Vater war Lehrer und Organist. Die Familie war damals
eine der führenden in Obwalden. Anton Sebastian hatte einen drei Jahre älteren Bruder, den Justus Ignaz. Dieser wurde später Landschreiber, Landessäckelmeister und war 1764 regierender Landammann von Obwalden, ein Amt, das 100 Jahre zuvor auch der
Urgroßvater der beiden, Hans Peter Imfeld innehatte. Anton Sebastian trat ins Kloster Einsiedeln ein. Am 21. November 1714 legte er als Nikolaus die Profess ab. Am 25. Mai 1720 wurde er zum Priester geweiht. Nach seiner Priesterweihe studierte er noch weiter.
Am 25. 10. 1721 wurde er zum Katecheten für die Schulkinder bestimmt. Ab 28. April 1723 war er Philosophieprofessor. Im Mai 1733 wurde er Subprior. Am 7. September 1734 erfolgte seine Wahl zum Abt. Nuntius Giovanni Battista Barni (1731-1743) führte den
Vorsitz.Anwesend waren auch die Äbte von Pfäfers Ambros Müller (1725-1738) und Muri Gerold Haimb (1723-1751). Die päpstliche Bestätigung durch Papst Clemens XII. (1730-1740) erfolgte am 15. Dezember 1734. Da die Kirche praktisch beendet war, hatte man
beschlossen Kirchweihe und Abteinsetzung gleichzeitig zu begehen. Am 1. Mai 1735 nahm der Nuntius die Abtweihe vor und die Äbte von Muri und Pfäfers weihten die Altäre. Kaiser Karl VI. verlieh die Regalien am 12. August 1735. Auch die Nachfolger des Kaisers
taten dies, Franz I. (1745-1765), der Gemahl Maria Theresias am 24.7. 1747 und Joseph II. (1765-1790) bestätigte am 22. September 1767 die Privilegien des Stifts.
Abt Nikolaus vollendete nun vor allem den Bau der Ökonomiegebäude, die zum Teil schon von Abt Thomas begonnen worden waren. Noch Abt Thomas hatte das Fundament zur Bäckerei gelegt. 1735 folgten die Schlosserwerkstätten. 1740 wurde mit dem Bau der
Hofmühle begonnen. Da es aber nicht genug Wasser gab, ließ Abt Nikolaus die Mühle an der Alp bauen. Nun musste noch der Chorumbau ins Werk gesetzt werden, da der unter Abt Augustin erbaute Chor nicht recht zur Kirche passte. Der Augsburger Architekt und
Maler Franz Kraus wurde mit dem Umbau betraut. Er schuf auch die Deckengemälde im Chor. Er konnte seine Arbeit allerdings nicht beenden. Er erkrankte und verstarb im August 1752. Seine Gemälde vollendete ein Maler Ruepp aus Augsburg.
Die Statuen im Chor schuf der Bildhauer Johann Baptist Babel (1716-1799). Nun wurden auch die Ökonomiegebäude vollends zum Abschluss gebracht. 1764 wurde der Marstall erbaut und 1767 der Ochsenstall. 1770 war der letzte Trakt errichtet und damit der
Klosterbau abgeschlossen. Den Marstall hatte Bruder Kaspar Braun abgeschlossen. Er ist 1714 in Bregenz geboren. Er war zunächst Steinhauer von Beruf, ist dann aber ins Kloster Einsiedeln eingetreten. 1748 hat er die Profess abgelegt. Er war dann auch
Architekt tätig. 1759 hat er das Gasthaus am Etzel bei der Meinradskapelle, die Caspar Moosbrugger 1698 gebaut hatte, errichtet. In Pfäffikon baute er 1760 das neue Schloss. Im Kloster Einsiedeln war ihm die Aufsicht über die Gebäude anvertraut.
Auch zwei Patres aus Frankreich waren in Einsiedeln. Das war einmal Plazidus Beurret. Er hatte seine Profess 1714 abgelegt. Aegidius Docourt hatte seine Profess 1718 abgelegt. Er stammte wie sein Mitbruder aus Pruntrut. Beide waren am Umbau der Bibliothek
beteiligt. Die Bibliothek war nun nicht nur bestens untergebracht. Der Abt stattete sie auch bestens mit Büchern aus.
Auch auf das Archiv richtete der Abt sein Augenmerk. Um 1770 ließ er es neu ordnen. Der Archivschreiber Wolfgang Dietele legte damals die Summarien an, die heute noch die Benutzung des Archivs erleichtern.
Unter Abt Nikolaus flammte der Streit mit Konstanz wieder auf. Es ging um das Recht Einsiedelns, die ihm inkorporierten Kirchen zu weihen. Der Nuntius hatte zwar 1740 zu Gunsten von Einsiedeln entschieden. Der Bischof und der Abt versuchten das
Problem ohne Rom zu lösen. Dazu traf man sich am 17. Mai zu einer Konferenz auf Schloss Sonneberg. Sein Kompromissvorschlag brachte der Abt im Konvent aber nicht durch. Vor allem Pater Meinrad Brenzer (Profess 1728) war dagegen. Er war lange Archivar und
auch Notarius Apostolicus. Die Frage blieb so ungelöst.
1764 wurde das Kloster auch in den “Harten-und Lindenhandel” hineingezogen. Das war einmal eine Auseinandersetzung von Franzosenfreunden und Anhängern der spanischen und habsburgischen Parteien. Es war aber auch eine sozial motivierte
Bewegung gegen die führenden Geschlechter in Schwyz, angeführt von aufstrebenden Politikern aus der ländlichen Mittelschicht,denen die höchsten Landesämter verwehrt blieben. Im Hungerjahr 1770 unterstützte der Abt beide Seiten tatkräftig, was half, dass
manche Wunde vernarbte.
Um 1755 hatte man um Einsiedeln mit dem Anbau von Kartoffeln begonnen,die bald zu einem der wichtigsten Nahrungsmittel des Hochtals werden sollte
Abt Nikolaus war in den letzten 15 Jahren seiner Amtszeit immer wieder krank. Ein Steinleiden setzt ihm schwer zu. Mehrmals dachte man schon, dass er sterben müsse. Im Alter von 80 verstarb er am 1. August 1773 nach großer Lebensleistung
und hinterließ ein gut bestelltes Feld.
Am 11. August 1773 versammelte sich das Kapitel zur Wahl des neuen Abtes. Gewählt wurde Marian Müller. Er war am 2. Oktober 1724 als Joseph Leodegar Müller geboren. Er war das jüngste von 15 Kindern des Michael Müller und der Magdalen Höltschi
in Aesch im Kanton Luzern. Schon mit 7 wurde er in Sachseln von einem Geistlichen unterrichtet. Sein Talent wurde wohl erkannt und mit 12 siedelte er an die Klosterschule in Einsiedeln über. 1741 meldete er sich für das Kloster an und am 20. Januar 1742
trat er das Noviziat an und ein Jahr später legte er als Frater Marian seine Gelübde ab. Er hatte wohl besonderes Redetalent, denn als er am 12. November 1747 Diakon wurde erhielt er auch den Auftrag, Unterricht in Rhetorik zu erteilen.
Auch musste er bei besonderen Anlässen Reden halten. Als am 14.9. 1747 Kardinal Angelo Maria Querini, Kardinalbibliothekar der Vatikanischen Bibliothek Einsiedeln besuchte, hatte er die Aufgabe, den Gast mit einer lateinischen Rede zu begrüßen.
Welche Ehre aber auch Herausforderung für einen jungen Mönch, denn Kardinal Querini stand mit bedeutenden Philosophen seiner Zeit im Gedankenaustausch und unterhielt einen Briefwechsel so z. B. mit Voltaire, Friedrich dem Großen, Montfaucon oder
Gottsched. Auch als die Äbte der Schweizer Kongregation zur Jahrhundertfeier der Engelweihe in Einsiedeln versammelten begrüßte sie jetzt Pater Marian mit einer Rede in Latein. Seine Priesterweihe hatte er am 9. Juni1748 erhalten.
Pater Marian hatte ja schon vor seiner Priesterweihe Unterricht erteilt hatte, war es nur folgerichtig, dass Abt Nikolaus ihn auch weiter mit einer solchen Aufgabe betraute. Er wurde ans Gymnasium nach Bellenz geschickt, wo er 14 Jahre verbrachte.
Er lehrte dort 8 Jahre Rhetorik, zwei Jahre Philosophie und 4 Jahre Moraltheologie. Während seiner Zeit in Bellenz führten seine Schüle Komödien auf, die er verfasst hatte. Auch musikalisch war er begabt. 1751 schickte ihn das Kloster nach Mailand
um bei Meister Giuseppe Palladino, das Komponieren zu erlernen. Der Musiker ist heute allerdings in Vergessenheit geraten. Als 1755 der Mailänder Kardinal Giuseppe Pozzobonelli Einsiedeln besuchte, war wieder Pater Marian der Begrüßungsredner.
1763 wurde er von Bellenz zurückberufen. Er übernahm gas Amt des Subpriors und war vor allem als Sekretär für Abt Nikolaus zuständig, er langsam alt wurde. 1771 übernahm er das Archiv, das unter seiner Leitung neu geordnet und registriert wurde. Der
Archivschreiber Dietele wurde oben erwähnt.
Pater Marian wurde 11. August 1173 zum neuen Abt gewählt. Nur einen Monat später, am 11. September 1773 bestätigte Papst Clemens IV. (1769-1774) die Wahl. Die Weihe nahm Nuntius Luigi Valenti Gonzaga (1764-1773)vor. Die Äbte von St. Gallen
Beda Angehrn (1767-1796) und Muri Bonaventura Bucher (1757-1776) assistierten. Kaiser Joseph II. verlieh dem Abt am 31. September 1776 die Regalien.
Dass Abt Marian sein Hauptaugenmerk auf Bildung und Schulen richten würde, ergab sich aus seinem bisherigen klösterlichen Werdegang fast zwangsläufig. Bei der Förderung der Volksschulen tat sich besonders Pater Isidor Moser hervor.
Seine Profess hatte er 1759 abgelegt. 1764 oder 1765 war er Dorfkatechet in Einsiedeln für die Schulkinder und ab 1767 war er Oberkatechet für die Schulentlassenen. Gleichzeitig war er aber auch als Philosophieprofessor, später als Theologieprofessor tätig.
Er arbeitete am “Grossen Einsiedlischen Katechismus”. Er schrieb auch eine Reihe kleiner Unterrichtsbücher für die Schulen sowie Gesangbücher. Im September 1774 wurde Pater Isidor erstmals Pfarrer in Einsiedeln. 1776 hielt er einen eigenen Unterrichtskurs
für Lehrer ab und er gab eine Schrift über die Verbesserung der Schulen heraus. Auch P. Johann Schreiber (Profess 1754)schrieb in der in Luzern erscheinenden “Historischen, philosophischen und moralischen Wochenschrift” einen Artikel zur “verbesserung
der Schulen” Auch die Gymnasien standen im Blickfeld des Abtes. Hier war vor allem Pater Robert Kech tätig. Er hatte seine Profess 1759 abgelegt. Er wirkte von 1763 bis 1764 als Lehrer in Bellenz,danach an der Klosterschule in Einsiedeln. Er gab eine lateinische
Grammatik für Gymnasien und später ein Übungsbuch heraus.
Die Bibliothek wurde weiterausgebaut.
Auf seiner ersten Schweizer Reise war Goethe vom 09.bis 15. Juni in Zürich. Bei diesem Aufenthalt wanderte er von Zürich aus mit den Grafen Friedrich und Christian von Stolberg sowie Graf Christian von Haugwitz nach Einsiedeln.
Auch der Physiker Volta hatte zwei Jahre später Einsiedeln besucht. Auch Abt Martin Gerbert aus St. Blasien, das er schon aus seiner Studienzeit kannte. Er hatte ein halbes Jahr in Einsiedeln studiert. Er initiierte das Projekt “Germania sacra”.
Abt Marian versuchte das Problems des Weiherechts mit dem Konstanzer Bistum zu klären. Der Abt traf sich am 30. Mai 1775 mit Konstanzer bevollmächtigten in Freudenfels. Der Abt wollte nicht, dass das Weiherecht Einsiedelns von einer vorherigen Erlaubnis
durch den Bischof abhängig gemacht wurde. Es kam aber nicht zu einer Einigung, da Bischof Franz Konrad von Rodt am 16. Oktober 1775 starb. Der Abt wandte sich zwar an den Nachfolger Maximilian Christoph von Rodt (1775-1779). Doch die Dinge blieben liegen.
Abt Marian war nie von besonders kräftiger Gesundheit. Ab 1777 verschlechterte sich aber sein Zustand stetig. Am 17. November 1780 verstarb er schließlich erst 56 Jahre alt.
Am 4. Dezember 1780 wählte das Kapitel unter Vorsitz von Nuntius Giovanni Battista Caprara (1775-1785) Abt Beat Küttel zum neuen Abt von Einsiedeln. Anwesend war auch der Abt von St. Gallen Beda Angehrn und Gerold Meyer (1776-1810) aus Muri.
Papst Pius VI. (1775-1799) bestätigte die Wahl schon am 10. April 1781, so dass die Weihe durch Nuntius Caprara am 6. Mai erfolgen konnte. Kaiser Joseph II. verlieh die Regalien am 1. November 1781. Die Nachfolger Kaiser Leopold II. (1790-1792) tat dies am
17.Oktober 1791 und Kaiser Franz II. (1792-1806) am 24. November 1794. Beide bestätigten auch die Privilegien des Stifts. Kaiser Franz war der letzte Kaiser, der die Regalien verlieh. Denn am 6. August 1806 erfolgte die
“Erklärung Sr. Maj. des Kaisers Franz II, wodurch er die deutsche Kaiserkrone und das Reichsregiment niederlegt, die Churfürsten, Fürsten und übrigen Stände, wie auch alle Angehörige und Dienerschaft des deutschen Reiches, ihrer bisherigen Pflichten entbindet”
(Dokumentarchiv.de). Damit war das Heilige Römische Reich erloschen.
Abt Beat Küttel wurde am 2. Juni 1733 als Marzell Küttel geboren. Seine Eltern waren der Landammann von Gersau Johann Georg Küttel (1697-1792) und Maria Magdalena Camenzind. Marzell Küttel legte am 29. September im Kloster Einsiedeln seine Profess als
Frater Beat ab. Am 25. Mai 1755 wurde er zum Priester geweiht.
Zunächst unterrichte Pater Beat an der Klosterschule Rhetorik. Ab Januar 1762 war er Vorsteher der Schule.1766 wurde Pater Beat durch Abt Nikolaus zum Stiftstatthalter ernannt. Ab 1772 war er Stiftsdekan. Er war damit auch für das wirtschaftliche Wohlergehen
des Stifts zuständig.
Gleich zu Beginn seiner Regierungszeit brachte er den Ausgleich mit Konstanz zustande. Abt Beat hatte sich mit dem letzten Salemer Abt Robert Schlecht (1778-1802) in Verbindung gesetzt. Auch die Zisterzienserabtei am Bodensee hatte Schwierigkeiten mit
dem Konstanzer Bischof. Auch er hatte es geschafft den Konflikt seines Klosters mit dem Bistum Konstanz offiziell beizulegen. Er hatte Pater Beda Müller (Profess 1755), der ihm im Amt als Statthalter folgte, als er selbst Dekan wurde, extra nach Salem geschickt,
weil der Salemer Abt ja im Einsiedler Streit mit Konstanz vermitteln sollte. Der Kanzler von Salem Seyfried wurde nun in den Verhandlungen mit dem Konstanzer Bischof zum Sachwalter Einsiedelns bestellt. Am 24. Juli 1782 einigte man sich und ein
Konkordat wurde mit Bischof Maximilian Christoph von Rodt wurde abgeschlossen.
Wichtigstes Bauvorhaben in der Regierungszeit war der Neubau der Residenz von Bellenz, der von 1781-1783 erfolgte. Pater Beda Müller wurde am 6. Januar 1782 als Propst nach Bellenz geschickt doch verstarb er dort schon am 5. Juni des Folgejahres im Alter von 51
Jahren.
Es wird nun Zeit für einen kleinen Exkurs. Am 14. Juli 1789 stürmte die Pariser Bevölkerung die Bastille. Die Revolution war ausgebrochen.Dieses Fanal wirkte auch in anderen Ländern.In der Schweiz sah man den Beweis, dass eine Revolution machbar ist und man
konnte mit französischem Eingreifen drohen.Überall in der Schweiz wurde nun mit einer Unzahl von Petitionen Veränderungen angestrebt. In St. Gallen kam es zu einer friedlichen Einigung. Abt Beda schloss im November gegen den Willen des Konvents eine
Vereinbarung mit einer Volksversammlung in Gossau mit 20.000 Teilnehmern einen “Gütlichen Vertrag” ab. 1797 verlangte die Bevölkerung in Baselbiet Freiheit und Gleichheit. Die Schlösser Waldenburg, Hornburg undFarnsburg wurden in Brand gesteckt.
Der konservative Bürgermeister Andreas Merian in Basel trat zurück. Dann erst gab der Rat zögerlich nach und war bereit, die Forderungen der Landbevölkerung zu erfüllen. 1793 anerkannten die Alten Orte die Befreiung des Thurgau und die gleichberechtigte
Aufnahme des Kantons Thurgau in die Eidgenossenschaft. Im Waadtland erhob Fréderéric Caeser de La Harpe die Forderung nach der Unabhängigkeit von Bern. Er bat auch die französische Republik öffentlich um militärische Unterstützung gegen Bern.
Die Landvögte von Bern verloren die Kontrolle. Der Rat von Bern demonstrierte Macht und sandte 5000 Soldaten ins Waadtland. Darauf griffen die Waadtländer zu den Waffen und riefen die Republik Léman aus. Frankreich erklärte Bern unter einem Vorwand
den Krieg. Bern verlor zwei Schlachten bei Fraubrunn und am Grauholz. Die Stadt am 5. März 1798 besetzt und geplündert.
Das Französische Direktorium hatte 1797 Peter Ochs beauftragt, eine Verfassung auszuarbeiten. Peter Ochs hatte in Basel und Leyden Rechte studiert
und in Leyden promoviert. Die Verfassung war der französischen Verfassung ähnlich. Es gab ein Parlament mit zwei Kammern, einer zentralen Regierung, das Direktorium und einem obersten Gericht. Die
föderalistische Struktur der Schweiz wurde abgeschafft.
Am 12. April 1798 versammelten sich 121 Abgeordnete aus den Kantonen Aargau, Basel, Bern, Fribourg, Léman (Waadt), Luzern, (Berner)
Oberland, Schaffhausen, Solothurn und Zürich. Peter Ochs proklamierte vom Balkon des Aarauer Rathauses die Helvetische Republik. Diese war als “Schwesterrepublik” eng an die französische Republik gebunden
Die Urschweiz war bei der Gründung nicht dabei und lehnte die Helvetische Republik ab. Die Revolutionäre wollten die neue Ordnung mit Hilfe von französischen Truppen erzwingen. Uri, Glarus und Schwyz
nahmen die Verfassung am 28.3.1798 an, als die Franzosen in großer Überzahl anrückten und keine Hilfe kam. Nidwalden wehrte sich bis zuletzt. Stans wurde erobert und ging in Flammen auf. 368 Nidwalder fanden den Tod.
Die Helvetische Republik schaffte die Leibeigenschaft und politische Untertanenverhältnisse ab. Eine wichtige Errungenschaft war die Rechtsgleichheit. Ein einheitliches Strafgesetzbuch wurde eingeführt das sich an dem Code penal orientierte. Mittelalterliche
Rechtsvorschriften wurden abgelöst und endlich die Folter abgeschafft. Der Schweizer Franken wurde eingeführt . Die Einheitswährung beendete den Münzwirrwarr. Die Volksschulbildung wurde verbessert. Das war auch die Zeit eines Johann Heinrich Pestalozzi
(1746-1827). Was Kirche und Staat angeht, die Helvetische Republik sollte ein laizistischer Staat sein. Geistliche und Laien wurden einander gleich. Die geistliche Gerichtsbarkeit der katholischen Kirche wurde ebenso abgeschafft wie die Sittengerichte in
den reformierten Kantonen. Am 27.4. 1798 wurde dem päpstlichen Nuntius die Anerkennung versagt. Am 8.5. 1798 wurde das Vermögen der Stifte und Klöster einer staatlichen Zwangsverwaltung unterworfen und am 17.9. zum Nationaleigentum erklärt,
also säkularisiert. Am 4.4.1799 schränkte die helvetische Exekutive die Prozessionen ein und verbot auf diese Weise die Wallfahrten. Den Klöstern wurde verboten, Novizen und Professen aufzunehmen.
Zurück zu Abt Beat. 1790 baten Mönche aus Frankreich um Aufnahme im Kloster, um hier ihr Ordensleben fortsetzen zu können. 1792 waren schon 48 ausgewanderte Geistliche da. 1797 waren über zwei Jahre verteilt über 2000 Emigranten aus Frankreich
in Einsiedeln gewesen. Natürlich waren das überwiegend Anhänger des Ancien Régime. Ende April 1798 rückten französische Truppen gegen Schwyz vor. Mit einem solchen Einfall hatte man nicht gerechnet und war auch nicht vorbereitet.
Pater Konrad Tanner hatte vorher mit großer Umsicht als Propst in Bellenz gearbeitet. 1795 wurde er als Statthalter nach Einsiedeln bestellt. Am 3. Mai 1798 rückten die Franzosen nun in Einsiedeln ein. General Nouvion besetzte das Kloster.
Die Stiftsmitglieder waren alle schon ab dem 29. April geflüchtet, die meisten nach Vorarlberg, einige nach Disentis. Nur Pater Martin du Fay de la Vallaz (Profess 1785) war zurückgeblieben. Vor seinem Eintritt ins Kloster hatte er im französischen Regiment seines
Stiefvaters General Pankraz de Courten gedient und war dort mit 24 schon Hauptmann. Er war auf eigenen Wunsch geblieben, um das schlimmste für das Kloster abzuwenden. Am 4. September begann, die Plünderung des Klosters. Die Bibliothek, das
Naturalienkabinett aber auch viele Möbel gingen an das Direktorium. Ende Mai wurde die Gnadenkapelle niedergerissen. Die Orgeln wurden an einen Uhrmacher in Aegeri verkauft und am 4. Juni wurden die Glocken vom Turm geworfen. Das Vieh war entweder
geschlachtet worden oder wurde der Heeresverwaltung übergeben, auch die Pferde. Pater Martin machte man das Angebot, wieder in die Armee einzutreten, was er natürlich ablehnte. Am 9. Mai wurde er aus der Schweiz verbannt. Er wurde nach Konstanz
eskortiert und ging dann nach Petershausen, wo er bis 1799 blieb.Seine Familie hatte sich mittlerweile für ihm verwendet. Er durfte dann nach Siders, wurde allerdings bald wieder als Aufwiegler und Ruhestörer an die Landesgrenze nach Basel verbracht. Er hielt
sich dann auf Gütern von Kloster St. Blasien auf. Er erhielt dann im August 1801 vom Justizminister in Bern die Erlaubnis, bei seiner Mutter in Siders zu bleiben wo er dann bis zu seiner Rückkehr am 11. Februar 1802 blieb.
Pater Konrad Tanner war vom Abt beauftragt worden, Ornate, das Haupt des Heiligen Meinrads und das Gnadenbild in Sicherheit zu bringen, was ihm gelang, vor die Franzosen in Einsiedeln einmarschierten. Er ging zuerst nach Tirol. 1799 kehrte er nach Einsiedeln
zurück, musste aber mit den Schätzen erneut flüchten. Er kam dann bis nach Linz, kehrte später über Innsbruck 1802 nach St. Gerold, wo er 1802 Pfarrer wurde. Dort wurde er 1806 ins Kloster zurückberufen. Der Abt selbst war zunächst nach St. Gerold geflüchtet.
Der größte Teil der Stiftsmitglieder ging nun ebenfalls nach St. Gerold. Das aber war zu klein. Der Abt mühte sich nun die Patres irgendwie unter zu bringen. Man hatte angedacht mit Zustimmung der Kurie von Konstanz das Kloster Reichenau wieder zu besiedeln.
Doch das zerschlug sich. Einige Patres fanden Aufnahme in den Stiften von Augsburg, Ottobeuren, Petershausen, Salem und Stams. Aber auch in Schwaben kämpften die Franzosen und die Patres mussten wieder weiterfliehen.
Die Beschlüsse der Helvetischen Republik, das Vermögen der Stifte einer staatlichen Zwangsverwaltung zu unterwerfen, um sie schließlich zum Nationaleigentum zu überführe, galt natürlich auch für Einsiedeln. Und so wurde auch Kloster Einsiedel am 17. 9. 1798
aufgehoben. Das Zisterzienserkloster in Stams hatte Abt Beat Asyl angeboten. Er blieb aber zunächst in St. Gerold. Im Frühjahr rückten die Franzosen aber auch in Schwaben weiter vor, so dass die Lage in St. Gerold immer unsicherer wurde. Da ging der Abt
schließlich doch nach Stams.
Erzherzog Karl (1771-1847) hatte die französischen Truppen unter General Jourdan in Oberschwaben am 21. März 1799 bei Ostrach und am 25. März bei Stockach besiegt. Am 5. Juni schlug er General Massena bei Zürich. Am 8. Juni rückten die Kaiserlichen
nun in Einsiedeln ein. Einige Patres unter ihnen Pater Konrad Tanner konnten wieder ins Kloster zurückkehren. Das war zunächst allerdings nicht von langer Dauer. Die Franzosen rückten wieder vor und nahmen am 14. August Einsiedeln aufs Neue ein.
Die Heimkehrer mussten erneut eilends fliehen. Diesmal machten sich auch viele Dorfbewohner auf die Flucht. Nachdem im Kloster nichts mehr zu holen war, wurde jetzt das Dorf geplündert. Schnell wurde wieder der Zustand vor den französischen Niederlagen
hergestellt. Masséna siegte in der 2. Schlacht von Zürich am 25.und 26. September 1799. Die Lage war nun für den Konvent nicht rosiger wie im Jahr zuvor und Abt musste sehen, wo seine Konventualen im Winter bleiben konnten. Abt Beat war mittlerweile in
Herdwangen untergekommen, wo Kloster Petershausen ein Rentamt hatte. Von dort schickte er Pater Markus Landtwig, der in friedvolleren Tagen auch als Vizekapellmeister im Kloster tätig war, in verschieden süddeutsche Klöster um um Asyl zu bitten.
Diesmal kamen einige in Tirol und zwar in Stams, Wilten und Fiecht unter. Andere fanden Zuflucht in bayrischen Klöstern, in Ottobeuren, Benediktbeuren, Regensburg,Roth und Weyarn. Die Franzosen rückten Anfang 1800 auch in Schwaben weiter vor, so dass
Abt Beat in Herdwangen auch nicht mehr sicher war. Er wandte sich auch in die Benediktinerabtei Fiecht im Inntal. Dort blieb er bis zum 13.April 1801. Die gesamte Lage änderte sich aber doch rasch.
Am 9. Februar 1799 hatte in Frankreich ein Staatsstreich stattgefunden. Er beendete die Regierung des Direktoriums und damit auch die französische Revolution. Napoleon Bonaparte wurde als Erster Konsul Alleinherrscher. Am 12. Dezember 1799 wurde die
Verfassung des Konsulats verabschiedet und 1800 durch eine Volksabstimmung angenommen. Kurz zuvor hatte Napoleon seinen Bruder Lucien zum Innenminister ernannt. Dieser überwachte auch die Abstimmung. Napoleon hatte praktisch die Fäden in der
Hand und das Abstimmungsergebnis für die neue Verfassung war entsprechend eindeutig. 99 % der Wahlberechtigten stimmten dafür. Nur der Erste Konsul bestimmte die Minister. Er konnte Gesetze verfassen und verabschieden.
In der Schweiz begünstigte der Erste Konsul die Föderalisten aus machtpolitischen Gründen gegen die Befürworter des Einheitstaats, die Unitarier.
Die Helvetische Republik versank bald im Chaos. In nur zwei Jahren zwischen 1800 und 1802 gab es mindestens 4 Staatsstreiche. 1802 zogen die französischen Truppen überraschend aus der Helvetischen Republik ab. Damit hatte die Exekutive ihre Machtbasis
verloren. In der Innerschweiz brach sofort ein Aufstand los. Der “Stecklikrieg” von 1802 erfasste rasch alle 19 Kantone. Die Zentralbehörden waren zur Flucht nach Lausanne gezwungen. Napoleon beorderte die Konfliktparteien zur “Consulta” nach Paris.
Dort arbeiteten Vertreter der Kantone und Gemeinden zusammen mit den französischen Unterhändlern Kantonsverfassungen und eine Bundesverfassung aus. Die föderalistische Zukunft der Schweiz war gesichert. Die Kantonssouveränität wurde
wiederhergestellt. Die Mediationsakte erstellte Napoleon weitgehend selbst. Mediation heißt zwar Vermittlung, aber es war praktisch das Diktat Napoleons. Wichtig für unser Thema, die Güter der Klöster werde zurückerstattet, aufgehobene werden
wiederhergestellt mit Ausnahme von Kloster St. Gallen da man die Substanz des neugegründeten Kanton St. Gallen gefährdet hätte, was die Wiederherstellung des Stifts wohl bewirkt hätte. auch Novizen konnten wieder aufgenommen werden.
Abt Beat kehrte am 11. Januar 1802 in sein Kloster zurück. Das Kloster war in denkbar schlechtem Zustand und in seiner Existenz noch nicht gesichert. Das Aufhebungsdekret von 1798 war noch in Kraft. Aber am 19.02.1803 wurde die sogenannte Mediationsakte
veröffentlicht. Napoleon sah sich als Vermittler, französisch médiateur. Aber die Akte war natürlich ein Diktat. Aber sie bestimmte, dass die Klöster ihre Güter in der Schweiz zurückerhalten sollten. Am 15. März 1803 teilte die Regierung des neugebildeten
Kantons Schwyz dem Kloster mit, dass alle im Kanton gelegenen Güter des Stiftes zurückgegeben würden. Jetzt war die Wiederherstellung des Stifts endgültig gesichert. Aber die Klostergebäude waren schwer beschädigt, die Gnadenkapelle abgerissen.
und das Gnadenbild noch in der Fremde. In der Ökonomie war noch ein Pferd und ein Schwein. So startete man den Wiederaufbau.St Gerold, die Zufluchtsstätte vieler Mönche in dieser Zeit ging allerdings verloren. Sie wurde mit dem Reichsdeputations-
hauptschluss vom 25. Februar 1803 eingezogen und zusammen mit der Herrschaft Blumenegg, die dem Stift Weingarten gehört hatte an den Fürsten von Oranien übergeben.
Am 8. März 1804 wurde die Übereinkunft (das Convenium) zwischen dem Stift und dem Kanton Schwyz ausgefertigt. Darin hieß es unter a) “ Der Kanton nimmt unser Stift unter seinen unmittelbaren Schutz, garantiert und verspricht ihm seine Existenz, die Sicherheit
seines Eigentums, Güter,Kapitalien, Zinse und rechtliche Gefälle, sowie die freie Administration derselben, jedoch mit dem Vorbehalt der Kastenvogtei.” Rechte, Polizeiordnung und auch Abtwahl wurden in weiteren Punkzen angesprochen. Im
Gegenzug verpflichtete sich die Abtei jährlich 7000 Gulden quartalsweise Steuern an die Kantonskasse zu zahlen. Allerdings wird dem Kloster zugesichert, dass der Kanton “billige Rücksicht nehmen” würde, wenn das Kloster diese Summe “ohne merkliche
Schwächung seiner ökonomischen Substanz” nicht mehr leisten könne. Damit war nun auch die Existenz des Klosters wieder schriftlich garantiert.
Die Schule in Bellenz wurde am 16. August 1805 wieder übernommen. Am 29. September 1806 nahm Abt Beat die ersten Novizen wieder auf. Das war nötig, denn die Zahl der Klosterinsassen war seit dem Einmarsch der Franzosen 1798 von 93 auf
65 zurückgegangen. 13 Konventsmitglieder waren im Exil gestorben und mussten außerhalb von Einsiedeln bestattet werden. Natürlich hatte diese schwere Zeit, die das Stift durchmachen musste, auch die Kräfte des Abtes aufgezehrt.
Er verstarb am 18. Mai 1806.
Konrad IV. Tanner war als Judocus Meinrad Tanner am 29. Dezember 1752 in Arth am Zugerseee zur Welt gekommen. Sein Vater war Schulvogt der Gemeinde.Sein Vater starb mit 46. Nun kümmerte sich Landammann Josef Viktor Lorenz von Hettlingen
den der junge Waise wie einen zweiten Vater verehrte. Er trat früh in die Klosterschule in Einsiedeln ein. Dort trat er mit 18 ins Kloster ein. Am 8. September 1772 legte er als Frater Konrad sein Profess ab. Primiz feierte er am 1. Juni 1777. Am 6. Januar
1782 bestimmte ihn Abt Beat als Lehrer am Gymnasium Bellenz. Er schrieb einige Bücher zur Jugenderziehung. In Bellenz hatte er die Präzeptur übernommen und er stellte für den Schulbetrieb genaue Vorschriften auf.
Von 1787-1789 war er wieder in Einsiedeln. Dort sollte er die Stiftsbibliothek übernehmen.Neuordnung und Katalogisierung waren seine Aufgabe. Er wurde eigens an eine Reihe süddeutscher Klöster geschickt, um die dortigen Einrichtungen zu studieren.
1789 wurde er Probst in Bellenz und er übte das Amt zur größten Zufriedenheit des Abtes aus. Er verwaltete den Wirtschaftsbetrieb sehr umsichtig. Er war auch ein kluger Vorgesetzter für Patres und Schüler. Deshalb berief ihn Abt Beat 1795 nach Einsiedeln zurück.
Dort wirkte er als Stiftsstatthalter. In den schweren Zeiten des Klosters war er einer der letzten die das Stift verließen. Er führte die Verhandlungen mit Konstanz wegen der Besiedelung der Reichenau und er brachte das Gnadenbild und das Haupt des Meinrad in
Sicherheit. 1806 wurde er von Abt Beat wieder nach Einsiedeln berufen. Er wurde nun Novizenmeister. Am 30. Mai 1806 wurde er zum Abt gewählt. Am 11. September weihte ihn Nuntius Fabrizio Sceberras Testaferrata (1803-1815) zum Abt. Die Äbte von Rheinau
Januarius Frei (1805-1831) und von Fischingen Augustin Bloch (1776-1815)assistierten. Abt Konrad brauchte keine Bestätigung der Privilegien mehr oder Fürstentitel, denn das war Vergangenheit. Auch die Huldigung der Gotteshausleute entfiel.
Drängendstes Problem waren zunächst die Finanzen. Der verstorbene Abt hatte gerade mal 3920 Gulden in bar hinterlassen, was natürlich nicht überraschte. Den jährlichen Klosterbedarf hatte der Abt auf 26 000 Gulden geschätzt. Ausländische Schuldzahlungen
blieben aus. Der Kanton begnügte sich dann mit einer jährlichen Zahlung von 300 Gulden. Auf eine gute Ausbildung seiner Patres legte er großen Wert. Viele erhielten Unterricht in höherer Mathematik, Physik und Hebräisch. Einige schickte er nach Frankreich oder
in die französische Schweiz, damit sie sich in der französischen Sprache ausbilden konnten. Die Bibliothek wurde gut mit Schweizer Geschichte ausgestattet. Auch auf die eigene Klostergeschichte legte er Gewicht. Die Patres sollten ihre Erlebnisse während des
Exils aufzeichnen. Die alte Klosterchronik wurde 1823 durch Pater Josef Tschudi neu herausgegeben. Die Herausgabe der Monumenta Germaniae förderte er. Er wurde deshalb zum Ehrenmitglied der Gesellschaft “pro aperiendis fontibus historiae medii aevi”
ernannt. Seine Bemühungen, die dem österreichischen Kaiserhaus geliehenen 100.000 Gulden zurück zu bekommen, blieben so erfolglos wie die Rückforderung des Kapitals, das 1794 an den emigrierten Erzbischof von Paris geliehen worden war.
Der Hochaltar wurde 1821 renoviert. Der Kirchplatz und die Kramgasse wurden restauriert. Die Klosterwaldungen wurden neu vermessen und eine Wollfabrik wurde im Stift wieder angelegt.
Die Lage aller Mitglieder der Schweizer Kongregation war nicht gerade rosig. Das Kloster Sankt Gallen war untergegangen. Besonders schwierig war die Lage der Klöster Muri und Rheinau, die in reformierten Kantonen lagen. Der Abt von Sankt Gallen Pankratius
Vorster zog sich immer mehr von den Geschäften zurück. Alle Klöster mussten sehen, wie sie mit der neuen Situation zurecht kamen. Ein Zusammenschluss fehlte, auch weil keiner der Äbte die Führung übernehmen wollte. Nach 1815 konsolidierte sich
die Lage allmählich. Abt Konrad übernahm die Initiative, um die Klöster wieder enger zusammen zu führen und die alte Kongregation wieder aufleben zu lassen. Er holte sich Rückendeckung vom Nuntius. Das war 1818/1819 Vincenzo Macchi. Auch die
Bundesbehörde in Luzern und die Kantonsbehörde in Schwyz informierte er. Erst dann lud er die Äbte auf den 28. Mai 1819 nach Einsiedeln ein. Nur Abt Pankratius Vorster aus St. Gallen und Abt Anselm Huonder aus Disentis erschienen nicht.
Disentis war am 6. Mai 1799 von den Franzosen in Schutt und Asche gelegt werden und Abt Lorenz Cathomen verstarb kurz danach in seiner Heimat in Brigel. Da das Kloster in Trümmern lag, beschlossen die verbliebenen Konventualen die Abtwahl
zu verschieben. 1804 wählten sie mit Anselm Huonder einen neuen Abt. Dieser machte sich auch gleich an die Wiederherstellung des Klosters, doch das nahm Jahre in Anspruch. Aus Pfäfers kam Stiftsdekan Johann Baptist Steiner, da Abt Joseph Arnold
(1805-1819) kurz vorher verstorben war. Die Versammelten wählten Abt Konrad zum Ersten Visitator und die Äbte Januarius Frei von Rheinau sowie Ambrosius Bloch (1816-1838) wurden zu Mitvisitatoren bestellt.
Die grundlegende territoriale Neuordnung in Deutschland und auch der Schweiz infolge der französischen Revolution und der napoleonischen Kriege hatte natürlich auch Auswirkung auf die Bistümer in Deutschland und der Schweiz. 1815 waren die
bayrischen,württembergischen, österreichischen und schweizer Teile vom Bistum Konstanz abgetrennt. Die schweizerischen Gebietsteile wurden von dem Propst von Beromünster, Franz Bernhard Göldlin (1762-1819) als Generalvikar verwaltet.Er favorisierte
ein Vierwaldstätterbistum mit Sitz in Luzern. Sein Plan scheiterte aber am Widerstand der Regierungen und der Kurie.Die Erhebung der Abtei Einsiedeln zum Bischofssitz für ein Bistum zunächst für Schwyz wurde auch angedacht.Göldlin starb am 16. September
1819. Die Teile des alten Bistums Konstanz wurden zunächst provisorisch Chur unterstellt. Schwyz schloss sich 1824 definitiv an Chur an. Damit war für Abt Konrad klar, dass er nicht Bischof würde, was er nie angestrebt hatte. Papst Pius VII. (1800-1823)
erließ am 16. August 1821 die Zirkumsskriptionsbulle “Provida sollersque”. Das war die Neuumschreibung der katholischen Diözesen in Deutschland nach dem Wiener Kongress und trug den territorialen und politischen Veränderungen Rechnung.
Der letzte Bischof Konstanzer Bischof Karl Theodor von Dalberg (1744-1817) war am 10. Februar 1817 in Regensburg verstorben. Der Bischofsstuhl blieb vakant. Die päpstliche Bulle von 1821 erklärte das Bistum Konstanz für aufgelöst. Mit Bischof
Bernhard Boll wurde am 21. Oktober 1827 der erste Freiburger Erzbischof geweiht. Bis zur Säkularisation war er Zisterziensermönch in Salem.
Abt Konrad hatte sich nie einer besonders guten Gesundheit erfreut.Ab 1810 war immer in Kur in Pfäfers. 1822 im Jahr seines goldenen Professjubiläums. Im Frühjahr 1824 war er schwer krank, doch ein Jahr später am 7. April 1825 verstarb er an Brustwassersucht.
Der Tod des Abtes gibt wieder Gelegenheit, auf die Zeitereignisse zu schauen.
Napoleon hatte Europa praktisch neugeordnet. Der Flickenteppich Deutsches Reich wurde von Napoleon beendet. Es gab fast 350 selbstständige Einzelstaaten auf dem Gebiet des Reiches. Der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 war die letzte
Sitzung des “immerwährenden Reichstages” und das letzte Gesetz. Die deutschen Fürsten sollten für ihre territorialen Verluste auf dem linken Rheinufer entschädigt werden. Säkularisation und Mediatisierung waren die Instrumente. Das Kirchengut wurde
verweltlicht und den Fürsten gegeben. Das bedeutet das Ende der Klöster in Deutschland. Die Reichsritterschaft verlor ihre Reichsunmittelbarkeit. Ihre Gebiete wurden ebenfalls zur Entschädigung herangezogen. 1806 war die Zahl der Territorien auf etwa
34 geschrumpft. Wie die Klöster verschwanden auch die Reichsstädte. Von 51 wurden 45 aufgelöst. Kleiner Fürstentümer und Grafschaften wurden aufgelöst und den benachbarten großen Fürstentümern Baden, Württemberg, Preußen und Bayern zugeschlagen.
Auf Druck Napoleons hatte Kaiser Franz am 6. August 1806 abgedankt. Das deutsche Reich hatte aufgehört zu existieren. Bis dahin hatte es insgesamt 844 Jahre bestanden. Die Völkerschlacht bei Leipzig vom 16.-19. Oktober 1813 besiegelte die Niederlage Napoleons.
Nach dem Intermezzo der hundert Tage wurde Napoleon auf St. Helena verbannt. Im Wiener Kongress von 1814-1815 versuchten Vertreter aus rund 200 europäischen Staaten,Herrschaften, Körperschaften und Städten eine dauerhafte europäische
Nachkriegsordnung zu erarbeiten. Ziel war es, zwischenstaatliche Gewalt zu vermeiden und mögliche Konflikte in Zukunft diplomatisch zu lösen.
In der Schweiz erhielten in einigen Kantonen nach der Völkerschlacht restaurative Kräfte wieder Auftrieb. In Bern übernahm am 23.12. 1813 wieder das Patriziat die Regierung und forderte die Kantone Waadt und Aargau auf, wieder unter die bernische Herrschaft
zurückzukehren. Anfang 1814 kam das Patriziat auch in Freiburg, Solothurn und Luzern wieder an die Macht. In dieser Zeit entbrannte aber auch ein Streit um einen neuen Bundesvertrag. Eine gemäßigte Partei, die die Mediationsverfassung reformieren wollte,
stand eine restaurative Partei gegenüber, die Machtverhältnisse der vorhelvetischen Ordnung wieder einführen wollte. Am 8.9. 1814wurde der neue Bundesvertrag verabschiedet und 3 Tage später Genf, das Wallis und Neuenburg als neue Kantone
aufgenommen. Der Wiener Kongress regelte am 20.03.1815 die Abfindungen und die Landesgrenzen. er anerkannte die 22 Kantone. Nachdem der 1. Pariser Frieden am 30. Mai 1814 nach dem Sturz Napoleons die Koalitionskriege vorläufig beendet hatte,
beendete der 2. Pariser Frieden vom 20.11. 1815 die Koalitionskriege definitiv. Wichtigstes Ergebnis für die Schweiz war,dass die unterzeichnenden Mächte die immer währende Neutralität der Schweiz anerkannten. Die Gebietsforderungen der Schweiz, unter
anderem war Konstanz gefordert worden, wurden nur zum kleinen Teil erfüllt. Der Schweiz wurden drei Millionen Francs Kriegsentschädigung zugesprochen. In der Zeit nach der europäischen Neuordnung erlebte die Schweiz 1816/17 die letzte schwere Hungersnot
ihrer Geschichte. Die Industrialisierung setzte ein. Die jährliche Spinnwarenproduktion steigerte sich zwischen 1814-27 von 680 auf 2800 Tonnen. In Rheineck wurde 1825 die erste mechanische Weberei eröffnet. In dieser Zeit begann auch die industrielle
Schokoladenproduktion. Parallel zur Industrialisierung entwickelte sich das Bankwesen. 1815 gab es in der ganzen Schweiz gerade 10 Banken, 1830 waren es bereits 74. In Bern wurde 1825 die erste Banknote ausgegeben.
Wichtige Passtraßen wurden ausgebaut. Das Verkehrswesen wurde leistungsfähiger und auch der Tourismus nahm Aufschwung. Die wirtschaftliche Modernisierung untergrub die Fundamente der restaurativen politischen Ordnung. Gesellschaftliche Schichten, die
offen für liberale Ideen waren wurden gestärkt. Dieser Abschnitt der Restauration endet so um 1830. Die Modernisierung war auch von starkem Bevölkerungswachstum begleitet. Allerdings schafften es Industrie und Landwirtschaft nicht, diese Zunahme vollständig
zu absorbieren, was die traditionell vorhanden ländliche Armut zum Massenphänomen ausweitete.
Zurück zum Kloster Einsiedeln. Am 28. Dezember 1772 wurde Jakob Josef Müller als Sohn von Josef Jakob Müller und der Maria Anna Scherzinger in Schmerikon geboren. Schon sehr jung kam er in die Klosterschule nach Einsiedeln und schon mit 16 meldete er
sich als Novize Kloster an. Als Frater Cölestin legte er am 25. April 1790 legte er die Profess ab. Der päpstliche Nuntius Pietro Gravina (1794-1798) erteilte ihm am 11. September 1776 in Luzern die Priesterweihe.
Er kam zunächst an die Klosterschule. Dann besetzten die Franzosen 1798 das Kloster und die Mönche mussten ins Exil. Zuerst kam er in Bludenz unter. Im November aber musste er weiter. Mit vier Mitbrüdern wandte er sich nach Bayern. Über Kempten,
Ottobeuren und Wessobrunn gelanget er nach Benediktbeuren. Da aber viele nicht in Benediktbeuren unterkommen konnte, musste er am 15. 12. 1798 weiterziehen. Im Professbuch steht, dass Pater Cölestin über München, Freising Landshut nach Asbach
kam und dort gute Aufnahme fand. Es müsste sich um Stift Adbach handeln, heute ein Ortsteil von Rotthalmünster. Das war ein kleines Kloster in der Nähe von Passau, das sich bis zu seiner Aufhebung eines ausgezeichneten Rufes erfreute. Dazu passt auch, dass er
vom Bischof von Passau, am 31. Dezember 1799 die Erlaubnis zur Ausübung der Seelsorge erhielt. Das war damals Bischof Leopold Leonhard von Thun, der letzte Fürstbischof von Passau. Es haben sich auch laut Professbuch Predigten aus Münchheim erhalten,
was auch Sinn macht, denn Münchham war eine Pfarrei, die seit 1338 dem Kloster Asbach inkorporiert war und aus Münchham kann leicht Münchheim werden, zumal wie das Professbuch vermerkt, näher Nachrichten fehlen. In Asbach blieb Pater Cölestin
von 1800 bis 1801 danach wanderte er weiter und kam auch nach Wien. Im Frühjahr 1803 kehrte er nach Einsiedeln zurück und wirkte dort zunächst als Unterpfarrer. Von seinen Mitbrüdern wurde er am 7. Oktober 1803 in die Kommission gewählt, die einen Plan
einer neuen Klosterordnung erstellen sollte.Zu Beginn des Jahres 1804 wurde die Klosterschule wiedereröffnet. Zunächst setzt Abt Beat Pater Anselm Zelger als Schulpräfekten ein. Er hatte am 31.8.1788 seine Profess abgelegt. Er war bei der Besetzung des Klosters
mit einigen Schülern nach St. Gerold geflohen. Zusammen mit Pater Dekan kam er am 29. November 1801 als erster wieder nach Einsiedeln zurück. Schon im Herbst 1804 nahm Pater Cölestin die Stelle von Pater Anselm ein. Pater Anselm war Lehrer für Theologie
und Philosophie von 1817 bis zu seinem Tode 1834 war er Statthalter. Pater Cölestin kümmerte sich sehr um die Schule. er gab auch ein Lehrbuch für den Rhetorikunterricht heraus. Wichtig waren ihm die Lateinkenntnisse seiner Zöglinge. Ab 5. Januar 1811
musste er die Stelle des Oberpfarrers in Einsiedeln übernehmen, da Pater Isidor Moser aus Altersgründen um seine Entlassung bat, was ihm 18.11. gewährt wurde. Pater Isidor hatte seine Profess 1759 abgelegt und insgesamt drei Mals als Pfarrer in Einsiedeln
gewirkt. Für Pater Cölestin war das Amt als Einsiedler Pfarrer eine wichtige Station, da er von Amts wegen mit Land und Leuten in Berührung kam und die Einsiedler Verhältnisse gut kennenlernte. Aber schon 1815 wurde er als Statthalter nach Sonnenberg gesandt.
Mit Sonneberg war auch Gachnang verbunden und Pater Cölestin musste zwei weit auseinander gelegen Besitzungen verwalten. Den Anforderungen des Hungerjahrs zeigte er sich gewachsen. Auch erwies er sich als geschickter Verwalter und so Verwunderte
es nicht, dass nach dem Tod von Abt Konrad seine Mitbrüder ihn zum neuen Abt wählten. Abt Ambrosius Bloch von Muri saß der Wahl vor. Papst Leo XII. (1823-1829) bestätigte die Wahl am 27. Junin 1825. Wegen der zu erwartenden Auslagen wollte der neue Abt
die Weihe zunächst nicht in Einsiedeln stattfinden lassen. Doch das Kapitel überredete ihn, die Weihe doch in Einsiedeln vorzunehmen. Fürstbischof Karl Rudolf Graf von Buol-Schauenstein (1794-1833) nahm die Benediktion unter Assistenz der Äbte von
Rheinau Januarius Frey (1805-1831) und Pfäfers Plazidus Pfister (1819-1836) vor. Der Pfäferser Abt hielt die Festpredigt.
Als erstes hatte der neue Abt den Steuerstreit zu lösen. Beim Tode Abt Konrads war er gerade in der Schwebe.Am 26. Januar 1825 hatte der Kantonsrat die Verlängerung des Conveniums mit drei stimmen Mehrheit abgelehnt, aber auch beschlossen, einen
neuen “Subsidienvertrag” mit dem Stift abzuschließen. Der neue Abt schaltete sich persönlich in die Verhandlungen ein. Nach zähen Verhandlungen einigte man sich schließlich darauf, dass das Stift 200 Louisdor entrichten sollte, wovon die Hälfte dem ganzen
Kanton, die andere Hälfte dem Alten Land zu fallen sollte.
Was weiter zur Lösung anstand, war, wie man mit St. Gerold umgehen sollte. Mit Abt Konrad war der letzte “Pensionär” von St. Gerold gestorben. Der mit Österreich geschlossene Pachtvertrag lief 1825 aus. Es war die Frage, ob man Anstrengungen unternehmen
solle, diesen alten Stiftsbesitz wieder zu erwerben oder nicht. Die in Vorarlberg weilenden Patres waren überwiegen dafür, den Vertrag Pachtvertrag nicht zu verlängern bzw. die Aufgabe der Propstei. Aber das eigens für diese Frage einberufenen Kapitel
entschied sich für eine Erneuerung des Vertrages auch unter dem Gesichtspunkt einer Zufluchtsstätte. Ein drittes Problem beschäftigte Abt Cölestin zu Beginn seiner Amtszeit. Das war die Wiedergewinnung des “Wiener Kapitals”. Wien hatte mittlerweile das
Zurechtbestehen der Forderung anerkannt. Dr. Römer aus Stuttgart hatte für das Stift verhandelt. Am Ende erhielt das Stift schließlich 78565 Gulden zurück. Ausgeliehen hatte es dem Kaiserhaus aber 300 000 Gulden. Darauf waren ja seit 1805 auch Zinsenangefallen.
Allerdings musste man in diesen Zeiten froh sein, überhaupt etwas zurück zu erhalten. Noch schlechter war es um Forderungen bestellt, die man gegen den Bischof von Paris, den Grafen Fugger von Pappenheim und dem Fürsten von Schwarzenberg hatte.
Auf die 50000 Gulden, die schon 1764 an Schwarzenberg geliehen worden waren, erhielt man dann immerhin wieder regelmäßig Zinsen.
Am 19. November 1816 hatte Abt Konrad einen Vergleich mit den Einsiedlern abgeschlossen. Es ging dabei um die sogenannten drei dreizerteilten Güter, die so hießen, weil sie Allmende waren, also der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung standen,
das Stift aber Miteigentumsrecht beanspruchte und auch der Vogt ein mitsprachrecht hatte, wenn es zu Streitigkeiten zwischen den Nutznießern kam. Der Vergleich gewährte einen gleichberechtigten Anteil und regelte die Verteilung des jährlichen Ertrages
nach einer schon 1564 getroffenen Übereinkunft. Doch 1826 kam es zu Streitigkeiten. Bestrebungen liefen darauf hinaus, dem Kloster die Nutznießung der Allmendgüter und vor allem die Mitbestimmung über die Verwendung der aus den Gütern fließenden
Einnahmen zu entziehen. Abt Cölestin machte persönlich vor der Landgemeinde die Rechte des Stiftes geltend. Ein friedlicher Ausgleich war nicht zu erreichen. So brachten beide Seiten die Sache vor den Landamman und den Rat von Schwyz.
Am 18. Februar 1829 anerkannte der Kantonsrat Miteigentums, Mitverwaltungsrechte und Mitnutzungsrechte des Klosters. Er setzte fest, dass eine eigene Behörde einzurichten sei, die vom Dorf und Kloster gestellt werde und von der Bezirksbehörde
vollständig unabhängig sein sollte. Da einige im Dorf damit nicht zufrieden waren und deshalb immer wieder Sand ins Getriebe streiten, so dass der Kompromiss nicht funktionieren konnte, wurden die Vorschläge von beiden Seiten am 7. Mai 1830
einer Landsgemeinde vorgelegt. Der Antrag des Klosters wurde abgelehnt. Falls dieses ablehnte sollte der Fall vor ein Kantonslandgericht gehen. Dazu kam es dann. Das Kloster akzeptierte schließlich einen Vergleich, die dreizerteilten Güter gingen an die
Gemeinde über. Das Kloster behielt nur den sogenannten Gärstlinsberg.Diese Lösung war allerdings nur von kurzer Dauer. Da der Kanton dringend Geld brauchte, wurde auch an das Stift die Forderung erhoben, eine jährliche Steuer zu entrichten. Der
Abt erklärte sich zu einer freiwilligen Abgabe bereit nicht aber eine jährliche Verpflichtung, da dafür keine gesetzlichen Vorgaben vorlagen. 1835 wurden schließlich die Genossengüter neu geregelt. Die Genossame erhielt nun privatrechtlichen Charakter, das heißt,
der Nutzen der Güter floss nicht mehr dem Gemeinwesen, sondern den Genossen zu. Das Stift erklärte sich bereit auf Forderungen von 15.000 Gulden zu verzichten und erhoffte sich im Gegenzug eine gütliche Lösung der Steuerfrage. Doch eine Lösung ohne Prozess
erschien immer schwieriger. Schließlich lenkte das Stift um des lieben Friedens Willen ein. Am 22. Januar 1837 einigte man sich auf einen Vergleich. Das Kloster musste den Gästlinsberg wieder abtreten aber ihm wurde ein Miteigentum an der Genossame im Sinne
des Vertrages von 1564 zugestanden. Damit war die Steuerfrage und die Frage der dreizerteilten Güter endlich geklärt.
Das Jahr 1830 war ein sehr unruhiges Jahr für den Kanton Schwyz. Das alte Land Schwyz hatte immer mehr versucht, seine alte Stellung geltend zu machen. Reichenburg hatte praktische eine Trennung von Einsiedeln vollzogen. Man drängte auf eine neue Verfassung
hin. In einem Memorial stellten die Bezirke Richtlinien für diese Verfassung auf. Am 26. April 1831 erschien die neue Staatsverfassung. Die Klöster wurden der Staatsaufsicht unterstellt. Sie hatten am Ort ihrer Niederlassung Beiträge zu den Bezirkslasten und
öffentlichen Anstalten zu leisten. Außerschwyzerische Novizen durften nur mit Erlaubnis des Kantonsrats ins Kloster aufgenommen werden. Sie unterstanden der Ortspolizei. Ankauf von Gütern und Kapitalien war ihnen untersagt. In Bezug auf Handel
und Gewerbe waren sie auf Hausbedarf und die Erzeugnisse ihrer Güter beschränkt. Weitere Unruhe verursachte der sogenannte Horn-und Klauenhandel. Es ging hier zunächst um eine Auseinandersetzung um die Nutzung der Allmend zwischen Besitzern
von Großvieh (Hornmännern) und Kleinvieh (Klauenmännern). Das weitete sich aber bald zu einer Auseinandersetzung zwischen konservativen (Hornmänner) und liberalen Kräften (Klauenmännern) aus und endete schließlich in einer handfesten Prügelei,
der sogenannten Prügellandsgemeinde vom 6.5. 1838 in Rothenturm Die eidgenössische Tagsatzung musste eingreifen und beschloss, dass eine weitere Kantonsgemeinde unter eidgenössischer Aufsicht abgehalten wurde. Diese fand am 22.7. 1838 statt. Die
Hornmänner siegten auf der ganzen Linie und hatten damit die Macht für die konservativen Kräfte auf Jahre hinaus gesichert.
Zwei weitere Ereignisse sind zu erwähnen. Am 21. April 1840 kaufte das Stift St. Gerold von der K.u.K. Staatsgüterveräußerungskommission in Innsbruck. Von einem Erwerb der Herrschaft Blumenegg hatte man abgesehen. Ursprünglich hatte man gehofft,
damit den Erwerb von St. Gerold zu beschleunigen, hatte dies aber eher verzögert. Einen Rückschlag gab es dagegen beim Kloster Fahr. Seit der Helvetik hatte es als Exklave zum Kanton Aargau gehört. Zwar hatte der Kanton 1805 den Fortbestand der Klöster,
die in seinem Bereich lagen, garantiert, aber allmählich mischte sich die Staatsgewalt immer stärker ein. Im Aargau hatte es eine starke Bewegung für eine Verfassungsrevision gegeben. Am 5. Januar 1841 fand darüber eine entscheidende Abstimmung ab.
Die Katholiken unterlagen. In Solothurn war zu dieser Zeit Unruhen ausgebrochen. Klöster wurden als Urheber der Unruhen bezichtigt und man verlangte die Aufhebung der Klöster. Am 15. Januar erschien eine bewaffnete Abteilung vor dem Kloster und verlangte
von den Frauen, das Kloster innerhalb von 8 Tagen zu verlassen. Zwar setzte sich Einsiedeln sofort juristisch zu Wehr und legte Protest bei der Tagsatzung ein. Es dauerte dann aber zwei Jahre, bis die Frauen unter Bedingungen wieder zurückkehren konnten.
Die Regierungszeit von Abt Cölestin war alles andere als ruhig. Wie ernst er manchmal die Lage sah, zeigt auch, dass er sich von dem Bayernkönig Ludwig (1825-1848) die Zusicherung geben lassen hatte, dass man sich im Falle der Vertreibung in einem aufgelassenen
Kloster in Bayern niederlassen konnte.
Ein großes Augenmerk legte er natürlich auf das Schulwesen, was ihn bei den Umbrüchen natürlich auch besonders forderte. Und wie allen Äbten in Einsiedeln stand natürlich die Wallfahrt im Vordergrund. In der Schweizer Benediktinerkongregation war zum 1.
Visitator gewählt worden. Die Lage vieler Klöster war nicht rosig. Päfers ging dem Untergang entgegen. Rheinau im Kanton Zürich und Fischingen im Kanton Thurgau bereiteten Kummer. in Muri im Aargau waren die Mönch vertrieben worden
und fanden in Gries bei Boten eine neue Heimat.
In Bayern wurden nach der Säkularisation Benediktinerklöster wieder besiedelt. Einsiedeln unterstütze diesen Prozess tatkräftig. Am 16. Dezember 1834 wurde in Augsburg St. Stephan als Benediktinerkloster von König Ludwig I. neu gegründet.
Bis zur Säkularisation war es ein freiweltliches adeliges Damenstift. St. Stephan wurde Mutterkloster für die Priorate Metten und Ottobeuren. Von Metten aus wurden weitere ehemalige Benediktinerklöster wie das Kloster Scheyern (1838), das Kloster
Weltenburg (1842) und Andechs (1846) und 1850 schließlich St. Bonifaz in München wiederbesiedelt. Mit Zustimmung des Kapitels sandte Abt Cölestin Pater Gregor Waibel (Profess 1807) und Pater Meinrad Kälin (Profess 1807)nach Augsburg. Pater Gregor wurde
Prior und Pfarrer in Ottobeuren. Für ihn war es auch so etwas wie eine Rückkehr, denn er hatte 1805 in Ottobeuren Rhetorik studiert.Pater Gregor blieb bis 1839 in Ottobeuren. Pater Meinrad wirkte als Professor in Augsburg, war im neuen Kloster von 1835 Subprior
bis 1839 und danach Prior bis 1845. In Augsburg war er auch Mitglied des polytechnischen Vereins des Oberdonaukreises. 1845 kehrte er in die Schweiz zurück. Auch Kolumban Mösch (Profess 1827) war von 1835 bis 1844 in Ottobeuren. Franz Sales Müller (Profess
1811) war von 1839 bis 1846 als Pfarrer in Ottobeuren. Pater Ambros Röslin (Profess 1824) wurde 1839 als Lehrer nach St. Stephan in Augsburg geschickt, wo er bis 1848 tätig war. Danach kehrte er wieder nach Einsiedeln zurück. Vom Stift Muri unterstütze Pater
Reginbold Reimann die Bemühungen der Benediktiner in Bayern. Auch um mithilfe zur Wiedererrichtung des Stifts Weltenburg bat man Einsiedeln um Hilfe. Die politischen Unwägbarkeiten ließen auch über eine Klostergründung in Galizien nachdenken.
Das Projekt wurde aber nicht weiter verfolgt.
Am 25. April 1840 konnte der Abt sein goldenes Professjubiläum feiern. Seine Gesundheit aber ließ nach. Mehrmals suchte er Bäder auf. 1845 stellten sich starke Schmerzen ein. Er hatte ein krebsartiges Beinleiden. Am 26. März 1846 verstarb er.
Am 23. April 1846 wurde mit Heinrich Schmid ein neuer Abt gewählt. Es war der 50. in der Reihe der Einsiedler Äbte. Schon im ersten Wahlgang erreichte er die erforderliche Zahl der Stimmen.
Heinrich Schmid kam am 17. Februar 1801 als Sohn der Bauern Heinrich Schmid und Maria Verena Bütler in Baar zur Welt. Dort besuchte er die Schule und wechselte dann 1814 auf das Städtische Gymnasium nach Zug. Von Herbst 1818 an besuchte
er die Klosterschule in Einsiedeln.1819 begann er mit dem Noviziat und seine Profess legte er am 22. Oktober 1820 zusammen mit Pater Gallus Morel und Pater Athanas Tschopp ab.
Im Zusammenhang mit Konstanz wurde oben die Bulle Provida sollersque vom 16. August 1821. In Württemberg wurde Rottenburg zum Bischofssitz erhoben . Interessanterweise erteilte der erste Bischof von Rottenburg Johann Baptist von Keller
(1821-1828) dem späteren Abt die Priesterweihe. Nach seiner Primiz wurde er als Mathematiklehrer an der Klosterschule eingesetzt. Er ging auch Pater Josef Tschudi (Profess 1810) zur Hand, der von 1819 bis 1832 Stiftsarchivar war. Als Pater Josef 1832
Statthalter in Pfäffikon wurde, war es nur folgerichtig, dass Pater Heinrich ihm im Amt folgte. Die Stelle des Archivars wurde immer als Vorstufe zur Tätigkeit eines Verwalters einer Klosterökonomie betrachtet. Auch die Ernennung zum Stiftsstatthalter
1839 wirkte so logisch.Die Tätigkeit als Archivar hatte für Heinrich den praktischen Vorteil, dass er sich in die Rechte und Befugnisse und die Nutzungsanteile der Allmende gut einarbeiten konnte. Als Statthalter kümmerte er sich vor allem um die Stiftswaldungen.
1831 veranlasste er eine Bestandsaufnahme aller Wälder. Er sorgte für die Verbesserung der Bodenkultur. Er erliess genaue Anweisungen zur Schonung des Jungholzes und darüber wo und wie Holz geschlagen werden darf. Diese Massnahmen kann man als Beginn
einer “modernen” Forstwirtschaft sehen.Die Güter des Stifts wurden ebenfalls vermessen.
Auch auf die Pferdezucht im Stift richtete er sein Augenmerk. Schon 1784 hatte Pater Isidor Moser (Profess 1759) in seiner Zeit als Statthalter in Einsiedeln von 1782-1787 das Gestütsbuch des Kloster Einsiedeln begründet.
Pater Heinrich führte nun zur Blutauffrischung der Einsiedler Pferdezucht die sogenannte englische Rasse im Marstall ein. 1840 wurde ein Zuchtbuch angelegt.
In der Verwaltung sorgte er für eine bessere Buch-und Geschäftsführung. Auch als Baumeister war er tätig. Er baute das Pfarrhaus in Schnifis. Das Schulhaus in Einsiedeln wurde unter seiner Leitung und nach seinen Plänen erbaut.
Als es im November 1846 bezogen werden konnte, war Heinrich bereits Abt. In den letzten Regierungsjahren Abt Coelestins war er bereits dessen wichtigste Mitarbeiter gewesen und so war es klar, dass er zu dessen Nachfolger gewählt wurde. Die Bestätigung
durch den Papst verzögerte sich allerdings, da Papst Gregor XVI. am 1. Juni verstarb. Sein Nachfolger wurde Pius IX. (1846-1878). Diese erfolgte am 27. Juli 1846. Die Weihe nahm Nuntius Alessandro Macioti (1845-1848) unter Assistenz des Bischofs von Chur
Kaspar von Karl (1844-1859) sowie des Abtes von Engelberg Eugen von Büren (1822- 1851) vor. Zusammen mit Heinrich wurde auch der neugewählte Abt von Dissentis Anselm Quinter (1846-1858) geweiht.
Am Anfang der Regierung Abt Heinrichs fand die letzte militärische Auseinandersetzung auf dem Gebiet der Schweiz statt, der Sonderbundskrieg. Es war ein Bürgerkrieg, der von 3. bis 29. November 1847 dauerte. In den Jahren 1844 und 1845 fanden die
Freischarenzüge statt. In Luzern hatten die Konservativen unter Josef Leu und Constantin Siegward-Müller einen von ihnen initiierte Verfassungsrevision durchgesetzt und den Sieg davon getragen. Darauf hin forderten sie von der Tagsatzung, dass der Kanton
Aargau gezwungen werde, die im Rahmen des Aargauer Klosterstreits (s.o. Kloster Fahr) die aufgehobenen Klöster wieder herzustellen. 1843 erklärte der Kanton nur die Frauenklöster wieder her zustellen. Daraufhin fassten die katholischen Kantone
Luzern, Uri, Zug, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und das Wallis den Beschluss, sich von der Eidgenossenschaft zu trennen, falls der Kanton Aargau, die Klöster nicht wieder vollständig wieder herstelle. Der Kanton Aargau vermutete, dass die Jesuiten dahinter
steckten und forderte, dass diese aus der Schweiz ausgewiesen würden. Im Wallis wurden die Liberalen gewaltsam nieder geworfen. Der Kanton Luzern berief Jesuiten an die Höheren Lehranstalten von Luzern. Das konfessionalisierte die politische
Auseinandersetzung zwischen dem liberal-radikalen und konservativen Lager. Freischaren versuchten die Regierung in Luzern zu stürzen, scheiterten aber in zwei Angriffen. Der konservative Politiker Josef Leu wurde am 20. Juli 1845
erschossen. Dies und die Furcht vor weiteren Freischarenzüge veranlasste die konservativen Kantone, einen förmlichen Bund zu schließen. Als die Beschlüsse bekannt wurden, beantragte Zürich im Sommer 1846, den Bund gemäß Bundesvertrag für
aufgelöst zu erklären. Im Juli 1847 waren in Genf und St. Gallen die Liberalen an die Macht gekommen. Nun wurde eine Revision des Bundesvertrags und eine Ausweisung der Jesuiten beschlossen.Die Sonderbundskantone vertrauten auf die Hilfe Frankreichs und
Österreichs blieben Mahnungen und und Vermittlungen unzugänglich und rüsteten. Am 4. November 1847 entschied die Tagsatzung in Bern auf Waffengewalt. Sonderbundstruppen fielen am 3. November ins Tessin ein. Am 12. November unternahmen sie einen
Vorstoß ins aargauische Freiamt. Der General der Sonderbundstruppen Johann Ulrich von Salis-Soglio kam am 27. September in Einsiedeln an. Er machte dem Abt seine Aufwartung und logierte im Kloster. Ab 11. November rückten die eidgenössischen
Truppen mit 100 000 Mann unter General Guillaume-Henri Dufour rückten gegen die Sonderbundskantone vor. Am 11. November kapitulierte Freiburg. Die Truppen der Sonderbundskantone wurden am 23. November geschlagen. Daraufhin kapitulierte Luzern
und wurde besetzt. Am nächsten Tag kapitulierten die übrigen innerschweizer Kantone des Sonderbunds. Abt Heinrich hatte Kunde vom Fall Luzerns erhalten und begab sich am 25. November zum Kommandeur der Schwyzer Truppen Alois von Reding nach
Biberbrück. Er machte die aussichtslose Lage klar und riet dringend, einen Waffenstillstand einzugehen. Dieser kam zustande und wurde am 27. November vom Schwyzer Volk angenommen.
Der Sonderbundskrieg hatte 150 Menschen das Leben gekostet und 400 Verletzte gefordert. In den besiegten Kantonen wurden Verfassung und Regierungen im liberalen Sinne revidiert. Die Kriegskosten mussten von den Verlierern durch hohe Reparationen
beglichen werden. Am 28. November erschien Oberstbrigadier Blumer und nahm mit seinem Stabe im Kloster Quartier. Im Dorf waren rund 1000 Mann stationiert. Die Einquartierung dauerte vom 28. November 1847 bis 11. Februar 1848. Die Kosten für Verpflegung
und Einquartierung beliefen sich auf 40.000 Gulden, für die das Kloster aufkommen musste.Schwieriger war die Lage im Kanton Schwyz. Das Kloster hatte sich bereit erklärt, die Hälfte der Kriegsschulden, das waren immerhin 110.000 Franken freiwillig zu
übernehmen. Das war dem Kanton noch nicht genug, am 30. Oktober nahm der Kantonsrat die Verteilung der Lasten zwischen Kanton und Kloster vor. Dem Kloster wurde die Hälfte der Staatsschulden, das waren 2269.83 Franken. Gleichzeitig wurde der Verkauf
von Liegenschaften untersagt. Doch die Herrschaft Gachnang im Thurgau, die man 1632 erworben hatte, musste aufgegeben werden.
Auch Bellenz ging verloren. 1852 hatte die Regierung im Tessin einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Aufhebung aller männlichen Orden vorsah. Auch die Residenz in Bellenz war auf der Liste der aufzuhebenden Klöster. Zwar machte Probst Pius Regli
(Profess 1812) die Regierung darauf aufmerksam, dass die Residenz kein Kloster darstelle. Ohne Erfolg. Am 28. Mai 1852 nahm der Große Rat den Aufhebungsantrag mit einer Stimme Mehrheit an. Der Probst wurde dann vom Kloster beauftragt,
den Prozess gegen die Tessiner Regierung wegen der Güter, die dem Kloster gehörten, zu führen. Er wurde am 26. Oktober 1855 schiedsgerichtlich entschieden. Dem Kloster wurde die Residenzbibliothek sowie eine Entschädigung von 40.000
Franken zugesprochen. Das Kloster hatte aber in 175 Jahren rund 175.000 Franken eigene Mittel aufgebracht.
Der Sonderbundskrieg und seine finanziellen Folgen, aber auch die Vorgänge in Bellenz, haben die unsichere Lage der Schweizer Klöster deutlich gemacht. Der Gedanke in der Neuen Welt eine Niederlassung zu schaffen, war nachvollziehbar, Der Anstoß kam
allerdings aus den USA selbst.
1822 war in Lyon basierend auf den Ideen und initiiert von Pauline Jaricot das Werk der Glaubensverkündung gegründet worden. Das Werk verbreitete sich rasch in Europa. Von 1846 bis 1850 war damals Pater Gallus Morel in der Schweiz Präfekt des
Werkes. Nachdem Der Strom europäischer Einwanderer und darunter eben auch vieler deutschsprachige wurde das Problem der seelsorgerischen Betreuung dieser Menschen immer drängender. Zwar hatte das wiedergegründete Benediktinerkloster
Metten und vor allem der aus Metten kommende Pater Bonifaz Wimmer sich intensiv um Amerika gekümmert. Pater Bonifaz war auch Begründer des benediktinischen Mönchtums in Amerika. Wie wir oben gesehen haben, begann sich benediktinisches
Leben nach den Klosteraufhebungen der Säkularisation gerade wieder zu entfalten. Da waren einfach noch nicht genug Kräfte für eine umfassende Missionstätigkeit in Übersee frei.
1847 wandte sich nun John Henni an den Präfekten der Glaubenskongregation, Gallus Morel. John Henni war seit 1843 Bischof in Milwaukee. Er stammte aus Obersaxen in Graubünden. Der Zeitpunkt der Anfrage war allerdings nicht sehr günstig,
denn es war ja die Zeit des Sonderbundkrieges. 1852 erneuerte der Bischof seine Bitte. Ein Pater sollte kommen und schauen, wo eine Benediktinerniederlassung gegründet werden könne. Das sollte bald geschehen, da die Grundstückspreise im Steigen
begriffen waren. Allerdings hatte kurz zuvor der Bischof Jacques Maurice de St. Palais (1849-1877) von der amerikanischen Diözese Vincenne in Indiana Gelegenheit mit Abt Heinrich persönlich zu sprechen. 1851 war der Bischof in Rom und kam auch nach
Einsiedeln. In der erst 1834 gegründeten Diözese lebten etwa 4000 Katholiken, verteilt auf 50.000 Quadratmeilen. Die Zahl war ständig im Steigen begriffen und der überwiegende Teil der Gläubigen war deutschsprachig. Nur 3 Priester standen dem
Bischof zur Seelsorge zur Verfügung. Abt Heinrich war zu der Zeit mit dem Ausbau der Schule der Schule beschäftigt und auch die finanziellen Nachwirkungen der letzten Jahre lasteten noch auf dem Kloster. Im Folgejahr kam der Generalvikar der
Diözese Pater Joseph Kundek (1810-1857) nach Einsiedeln. Pater Joseph Kundek war kroatischer Priester, der deutsch sprach. Er tat viel für die Ansiedlung deutscher Einwohner. Er gründete Siedlungen. Ferdinand war das erste komplette deutsche Dorf, das er
gründete. Dann folgte Fulda und Celestine. In Einsiedeln hatte sich die Lage inzwischen geändert. Die Regierung im Tessin hatte gerade die Residenz in Bellenz aufgehoben. Dadurch wurden Kräfte frei. Und es lief ja auch ein Prozess gegen die Tessiner Regierung.
Vielleicht erhoffte man sich auch daraus finanzielle Mittel zu bekommen, um ein solches Unternehmen finanzieren zu können. Der Abt und der Konvent gaben also die Zustimmung zu einer Gründung in der Neuen Welt. Natürlich wurde der Plan auch dem
Papst vorgelegt. Pater Gallus Morel stellte das Vorhaben in Rom persönlich vor. Die geplante Klostergründung sollte auch der Erziehung von Weltgeistlichen dienen. Kardinal Fransoni, seit 1834 Präfekt der Kongregation De Propaganda fide, teilte am 22.
November 1852 mit, dass Papst Pius das Werk lobe. Auch dem Werk der Glaubensverbreitung in Lyon wurde das Projekt vorgelegt. Die finanzielle Hilfe des Werks sah der Abt auch deswegen für wichtig an, dass in der Schweiz nicht der Gedanke aufkomme, man
verlagere Klostervermögen aus der Schweiz nach Amerika. Der Abt schickte Pater Karl Brandes (Profess 1832 in Solesmes, erneuert in Einsiedeln 1850) nach Lyon. Seine Mission war erfolgreich, wobei ihm vielleicht seine Zeit in einem französischen Kloster half.
Das Werk sicherte eine Unterstützung von 12 bis 15000 Franken zu, nur noch der Zentralrat in Paris müsse zustimmen. Nun holte Abt Heinrich auch die Zustimmung des Kapitels ein. Diese wurde am 19. November 1852 gegeben. Nun wählte der Abt aus den Patres,
die sich freiwillig gemeldet hatten, zwei aus. Das war einmal Pater Beda O’Connor, ein gebürtiger Ire, der als Knabe nach Einsiedeln kam und praktisch kein Wort deutsch konnte. Das lernte er in Einsiedeln natürlich rasch. Seine Profess legte er 1847 ab.
In Einsiedeln unterrichte er Englisch. Für seine neue Aufgabe war er dank seiner Sprachkenntnisse natürlich bestens gerüstet. Er wurde begleitet von Pater Ulrich Christen (Profess 1832).
Pater Beda war ab 1886 Kanzler des Bischofs von Vincennes, ab 1870 war er dessen Generalvikar. Abt Heinrich ernannte ihn 1871 zum Apostolischen Notar. Er verstarb mit erst 50 Jahren in Terrehaute.
Pater Ulrich war erst an der Kirche St. Joseph in Jasper, danach an der Ferdinandskirche in Ferdinand und schließlich an der Maria Hilfkirche in Dubois. Er 1865 wieder nach Einsiedeln zurück. Schon im April 1835 hatte Pater Ulrich
1400 Juchart Landgekauft, was den Abt doch etwas aus der Fassung brachte. Er beruhigte sich erst wieder nach einem Schreiben des Bischofs und Pater Kundeks. Der Kauf erwies sich aber als sehr vorteilhaft, den er aber vorbehaltlich der Zustimmung
des Kapitels gemacht hatte. Die Zustimmung wurde erteilt. Bischof und Generalvikar hatten weiteres Land geschenkt. Am 21. März 1854 wurde die klösterliche Niederlassung eröffnet, die man unter das Patronat St. Meinrads stellte.
Die Niederlassung war um weitere zwei Patres verstärkt worden, nämlich Pater Hieronymus Bachmann (Profess 1818). Er war zweimal in USA, erstmals von 1853 bis 1854 und dann nochmals 1855 für zwei Jahre. Mit Pater Hieronymus ging Pater Eugen Schmerzmann
nach Amerika. Er gehörte zwar dem Stift Engelberg an, half in der Zeit aber als Lehrer in Amerika aus. Pater Eugen war der erste Pater, der in Amerika verstarb und zwar im Jahr 1854. Ihnen folgten Pater Athanasius Tschopp (Profess 1820) und Pater Johannes
Chrysostomus Foffa (Profess 1851). Pater Athanasius war für ein Jahr ab 1855 als Prior von St. Meinrad in Amerika. Pater Johannes Chrysostomus war zweimal in Amerika, einmal von 1855-1871 und ein zweites Mal für 10 Jahre 1875 bis 1885. Da war er dann Pfarrer in
Belleville. Die Unternehmung in Amerika erwies sich als glückhaft. Doch bereitete die Verschuldung der neuen Niederlassung dem Abt zunehmend Sorgen und er meinte dieser Entwicklung durch eine teilweise Liquidation des Besitzes entgegen wirken zu
müssen. Bischof Jaques Maurice de Palais reiste 1859 extra nach Einsiedeln und erreichte, dass man die Lage von St. Meinrad zuhause nun doch günstiger beurteilte. Der Bischof erhielt auch zwei neue Hilfskräfte die für St. Meinrad wichtige Impulse brachten.
Pater Martin Marty hatte sein Studium bei den Jesuiten in Freiburg begonnen. Als die Jesuiten 1848 dort vertrieben wurden, ging er nach Einsiedeln. 1855 legte er dort seine Profess ab. In Einsiedeln war er Professor für Moraltheologie. Vom Abt wurde er 1860 nach
St. Meinrad nach Amerika gesandt. 1865 wurde Prior. Seiner geschickten Leitung war es zu verdanken, dass das Priorat zur selbstständigen Abtei erhoben wurde und Pater Martin wurde der erste Abt. 1876 ging Abt Martin zu den Sioux-Indianern.
Er wurde “zum Apostel der Sioux-Indianer” und war einer der bedeutendsten Missionare seiner Zeit. Er wurde zum Titularbischof von Tiberias ernannt. Er legte 1879 die Abtswürde nieder. Ihm wurde die Indianermission anvertraut und er war sämtliche Katholiken
des Riesengebietes anvertraut. 1889 wurde das Territorium von Dakota in die beiden Staaten Nord-und Süddakota aufgeteilt. Auch die kirchliche Aufteilung folgte. Martin Marty wurde der erste Bischof des neuen Bistums Sioux Falls. Bischof Martin verstarb
1896 mit 63 Jahren. Mit Pater Marin war Pater Fintan Mundwiler (Profess 1855) nach Amerika gegangen. Er wurde der erste Prior der zur Abtei erhobenen Niederlassung und als Abt Martin zum Bischof erhoben wurde, wählten seine Mitbrüder den
bisherigen Prior zum Nachfolger des bisherigen Abtes. Abt Fintan wurde 1855 der erste Präses der Schweizerisch-Amerikanischen Benediktinerkongregration. Auch er verstarb mit 63 am 14. Februar 1898 in St. Meinrad in Amerika.
Zurück nach Europa. Abt Heinrich war ja gleich am Tag nach seiner Weihe bestellten ihn die Äbte der Kongregation zu ihrem Präses. Am 28. Oktober 1846 brannte das Kloster Dissentis nieder.Dem Wiederaufbau folgte eine drückende Schuldenlast.
Der Kanton Graubünden stellte das Kloster unter Staatsaufsicht. Das kantonale Klostergesetzes von 1861 verhinderte die Novizenaufnahme. Das Kloster geriet an den Rand des Untergangs. Als Abt Anselm 1859 verstarb, blieb der Abtsstuhl zunächst mal unbesetzt.
Abt Heinrich wurde zum Apostolischen Administrator der Abtei bestellt. Abt Heinrich sandte Patres aus Einsiedeln nach Disentis um die Dinge dort zu bessern, allerdings kaum mit Erfolg da man dort “von Fremden” nichts wissen wollte.
Am 15. Juli 1859 ernannte Papst Pius IX. Pater Georg Ulber zum Abt von Dissentis.Pater Georg hatte 1840 seine Profess in Einsiedeln abgelegt. Er verhandelte nun mit der Regierung in Graubünden. Doch die erzielte Übereinkunft wurde von Rom nicht angenommen.
Daraufhin verzichtete Pater Georg auf die an ihn ergangene Berufung. Nun wurde Placidus Tenner vom Nuntius zum Oberen, nicht zum Abt ernannt. Abt Heinrich hatte auch wegen der politischen Lage seine Stelle als Apostolischer Administrator
niedergelegt. Nun ernannte Rom den Bischof als apostolischen Delegaten für Disentis, mit dem Recht, Obere nach eigenem Gutdünken einzusetzen. Davon machte Bischof Nikolaus Franz Florentini (1859-1876) und bestellte Paul Birker als Abt von Disentis
Abt Paul war am 27. August 1847 von König Ludwig I. als erster Abt von St. Bonifaz in München ernannt worden. Er hatte sehr strenge Vorstellungen von mönchischer Askese und Klosterleben. In seinem Konvent konnte er sich damit nicht durchsetzen und trat
1854 zurück. Er war ein anerkannter Schulmann. Deshalb bemühte er sich in Disentis vor allem um die Hebung des Schulwesens, auch um die Regierung in Graubünden günstig zu stimmen. Unterstützt wurde er in seinem Bemühen durch Kapitularen aus Einsiedeln.
Seine Regierung war aber nicht sehr glücklich und so dankte er 1877 auch in Dissentis ab. Bessere Zeiten für Disentis gab es erst, als ein Stimmungsumschwung im Volk und der Regierung für ein besseres Umfeld gesorgt hatten.
Im Thurgau war die Meinung vieler Politiker Klöster seien „jedem gemeinnützigen Wirken fremd geblieben“. Staatliche Klösterverwalter wurden eingesetzt. Man beschloss, dass Novizenaufnahme bewilligt werden musste oder ganz oder
sie wurde gleich ganz verboten. 1848 beschloss der Große Thurgauer Rat alle Klöster bis auf eines aufzuheben, das dann 1869 auch noch folgte. Dies betraf die Klöster Augustiner-Chorherrenstift St. Pelagius Bischofszell (seit etwa 850),
Augustiner-Chorherrenstift St. Ulrich und Afra Kreuzlingen (seit 968), Benediktinerinnenkloster Münsterlingen (seit etwa 1100)
Bendiktinerkloster Fischingen (seit 1135), Zisterzienserinnenabteien Feldbach (seit 1253), Kalchrain (seit 1330) und Tänikon (seit 1249)*
Kartäuserkloster Kartause Ittingen (seit 1461, zuvor Augustinerkloster),Kapuzinerkloster Frauenfeld (seit 1559)
und 1869 Dominikanerinnenkloster St. Katharinental
Für Rheinau hatte der Züricher Rat 1835 das Verbot der Novizenaufnahme beschlossen und damit das Kloster zum Aussterben verurteilt. 1874 wurde Kloster Mariastein vom Kanton Solothurn aufgehoben.
Damit existierten in der Schweiz nur noch drei Benediktinerklöster als Abt Heinrich starb.
Am 8. September 1869 wurde in Rom das 1. Vatikanische Konzil eröffnet. Auch Abt Heinrich war zu diesem Konzil berufen worden und nahm daran teil. Zusammen mit Prior Martin Marty von St. Meinrad und Pater Georg Ulbers, der ja in Disentis hätte Abt werden
sollen reiste man nach Loreto und Assisi. Zum St. Benediktsfest in Monte Cassino 1870 hielt Abt Heinrich das Pontifikalamt. Wichtigstes Ergebnis des Konzils war das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes bei “endgültigen Entscheidungen in
Glaubens-und Sittenlehrern.” Das führte mancherorts zu heftigen Reaktionen. Österreich kündigte ein 1855 geschlossenes Konkordat. Es kam zu Kirchenabspaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die altkatholische Kirche, in der Schweiz
Christkatholische Kirche. die Gemeinschaft selbständiger katholischer Kirchen ist in der Utrechter Union zusammengeschlossen. Das Erzbistum Utrecht ist die älteste altkatholische Kirche und seit 1723 von Rom unabhängig.
Abt Heinrich konnte im Jahr 1870 auch sein goldenes Professjubiläum feiern.
Abt Heinrich verstarb am 28. Dezember 1874.
Am 28 Dezember 1821 kam Abt Basilius als Johann Anton Oberholzer auf dem Gut Buchholz bei Uznach zur Welt. Seine Eltern waren die Bauersleute Alois Oberholzer und Anna Bochsler. Er besuchte die Schule in Uznach. Dort wurde er schon früh
als Sänger geschult. Er erlernte auch das Orgel-Klavier-und Geigenspiel. Danach besuchte er eine Art Höhere Realschule. Ab Herbst 1835 besuchte er die Klosterschule in Einsiedeln. Seine musikalischen Talente wurden dort gefördert.
Irgendwann aber sagt ihm das nicht mehr zu und er wollte das Studium nach der sechsten Klasse aufgeben. Sein Vater hatte sich nach einem Platz in einem Handelshaus in St. Gallen für ihn umgesehen. Auf dem dahin besann er sich aber eines anderen
und kehrte nach Einsiedeln zurück und meldete sich dort für das Noviziat an. Er wiederholte die 6. Klasse und beschäftigte sich viel mit Musik. Im September 1845 legte er als Frater Basilius die Profess ab. Er studierte Theologie und wurde am 19. September 1846
zum Priester geweiht. Nach seiner Primiz wurde er dem Präfekten und Rektor am Gymnasium Pater Rupert Ledergerber zur Seite gegeben um in den Ferien die Studenten zu überwachen und Unterricht in Gesang und Musik zu geben. Im neuen Schuljahr
unterrichtete er an zwei Klassen Mathematik, in der ersten Klasse Griechisch. Daneben übernahm er noch eine Zahl Gesangs-und Musikstunden. Als 1848 die Schule vergrößert wurde, bestellte ihn der Abt zum Vizepräfekten.
Von 1846 bis 1850 war er auch Vizekapellmeister. Er war ein ausgezeichneter Musikant und konnte die meisten Instrumente spielen. Er war ein sehr guter Lehrer und kam mit dem ihm anvertrauten jungen Leuten bestens klar.
Am 22. Dezember 1858 bestellte ihn Abt Heinrich zum Stiftsküchenmeister. Das sollte die Vorbereitung zum Statthalter in Pfäffikon sein. Diesen Posten musste er am 14. Mai 1859 antreten. Er ging nur ungern von Einsiedeln weg. Er wurde oft von seinen
ehemaligen Studenten aber auch Mitbrüdern in Pfäffikon besucht. An seinem neuen Platz aber arbeitete er sich gut ein und verwaltete den Betrieb in Pfäffikon bestens. Als sich der Gesundheitszustand von Abt Heinrich zunehmend
verschlechterte, kam auch ihm das Gerücht zu Ohren, er werde in Einsiedeln als neuer Abt gehandelt. Er eilte sofort nach Einsiedeln, um Abt Heinrich zu bitten, ihn unverzüglich nach Amerika zu schicken. Als er in Einsiedeln ankam, stand es schon so schlecht
um Abt Heinrich, dass er seine Bitte nicht mehr vorbringen wollte.
Am 13. Januar 1875 wählten in seine Mitbrüder zum neuen Abt. Die Weihe nahm Weihbischof Kaspar Willi von Chur an, der ja auch dem Orden der Benediktiner angehörte. Laut Professbuch assistierten ihm die Äbte von Rheinau und Engelberg.
Für Engelberg war das Abt Anselm Villiger (1866-1901). Für Rheinau müsste das der letzte Abt Leodegar Inneichen gewesen sein. Allerdings war das Kloster ja 1862 aufgehoben worden und in eine kantonale Heil-und-Pflegeanstalt umgewandelt worden.
Auch müsste das kurz vor seinem Tod gewesen sein. denn Abt Leodegar verstarb 1876.
Als Schulmann lagen ihm natürlich die Schulen am Herzen. Ein großer neuer Schlafsaal wurde gebaut. Dazu kamen sanitäre Anlagen. Die Schule bot nun 130 Schülern Platz. 10 neue Musikzimmer wurden eingerichtet.
Er sandte seine Mönche auch an Hochschulen in Rom, Leipzig, Berlin, München und Tübingen.1880 hatte er Columban Brugger, seinen Späteren Nachfolger zum Studium nach Karlsruhe geschickt. Das zeugt für Offenheit und Weitsicht des Abtes.
Die Gründung des Polytechnikums Karlsruhe erfolgte durch Großherzog Ludwig von Baden am 7. Oktober 1825 in seiner Residenzstadt. Es war eine der erste Hochschulen dieser Art in Deutschland. Ihr Bildungsangebot lässt auf den ersten Blick nicht
unbedingt auf ein klösterliches Profil zu passen, zeigt aber, dass der Abt die besonderen Begabungen seiner Mönche im Blick hatte und sie förderte.
Als seinen Nachfolger in Pfäffikon schickte Abt Basilius Pater Dominikus Matter (Profess 1863) Am 7. Februar 1875 wurde Pater Dominikus Statthalter in Pfäffikon. Dort blieb er bis zum 30. Dezember 1922. Im darauffolgenden April verstarb er im Alter von 85 im
Kloster. Schon von Beginn seiner Regierungszeit an versuchte er den Betrieb im Kloster rationeller zu gestalten. Eine Reihe landwirtschaftlicher neuer Maschinen wurde erworben. Die Torfgewinnung wurde 1877 auf maschinellen Betrieb umgestellt.
Im Kloster wurde 1876 eine für die damalige Zeit moderne Dampfheizung errichtet, die danach 50 Jahre ihren Dienst versah. Das war zunächst gegen den Widerstand einiger Konventualen erfolgt, die Unannehmlichkeiten wegen der Bauarbeiten befürchteten.
Stiftsstatthaler war von 1869 bis 1895 Pater Raphael Kuhn (Profess 1847). Er hatte einiges unternommen, um seine Mitbrüder von den Vorzügen einer Dampfheizung zu überzeugen. Wichtigstes Argument war für ihn die Verminderung der Brandgefahr. Denn im
Kloster fielen durch die Dampfheizung “100 Feuerherde” weg. Er lobte die Vorzüge der Dampfkraft. Er plante damit den Betrieb einer Mühle, einer Säge, einer Dampfwäscherei, ja sogar einer Dampfküche und einer Badeanstalt für die Mönche. Die
Technikbegeisterung von Pater Raphael kam nicht von ungefähr. Den er in Kremsmünster ab September 1850 ein Jahr Physik studiert. Danach unterrichtete er in Einsiedel bis 1869 Physik und Astronomie. 1867 besuchte er die Weltausstellung in Paris.
1663 hatte Abt Plazidus Reimann eine neue wasserbetriebene Säge an der Alp erbauen lassen. Beim Klosterneubau leistete die Sägerei wertvolle Dienste. Allerdings war sie so baufällig geworden, dass sie 1787 durch einen Neubau ersetzt wurde.
Anfang des 19. Jahrhunderts kam es immer wieder zu Streitigkeiten mit anderen Wasserwerksbesitzern. 1878 entschieden die Waldleute, wegen Überschwemmungsgefahr die Alp tiefer zu legen. Da entschloss sich das Kloster zum Verkauf der Mühle.
Mit dem Erlös baute man auf dem Klosterareal eine neue Mühle und 1882 nahm man eine neue mit Dampf betriebene Säge in Betrieb. Lange Transportwege entfielen nun. Das Kloster konnte seine Werkstätten mit zugeschnittenem Nutzholz versorgen.
Auch der Marstall hatte die Aufmerksamkeit des Abtes. Auf dem Freiherrenberg wurde ein neuer Pferdestall erstellt. Zwei Bundeshengste wurden 1891 eingestellt. Das Kloster wurde immer wieder für seine Zuchterfolge bei Pferden, aber auch beim
Braunvieh ausgezeichnet. 1891 wurde im Konventgarten ein großes Bienenhaus erbaut. Auch in der Kirche wurden Neuerungen vorgenommen zum Beispiel ein neuer Bodenbelag oder 1866 eine neu Bestuhlung.
Auch die Benediktinerkonkregation brauchte immer mal wieder personelle Hilfe. So kam Pater Paul Schindler (Profess 1862)1876 nach Disentis. Dort war er von 1877 bis 1879 Prior. Von 1888-1890 war er Theologieprofessor am Ordenskolleg S. Anselmo in Rom.
In Monte Cassino und in Delle, wohin die Benediktiner von Mariastein ausgesiedelt waren, unterrichteten Konventualen aus Einsiedeln.
Das Missionswerk in Amerika forderte und erhielt immer wieder personelle Unterstützung. Pater Wolfgang Schlumpf hatte seine Profess 1853 abgelegt. 1862 kam er in Amerika in St. Meinrad. Abt Martin Marty sandte ihn 1878 nach Arkansas.
Dort gründete er die neue Niederlassung San Subiaco, deren Prior er wurde. Diese entwickelte sich zu einem blühenden Kloster. Es wurde 1891 zur Abtei erhoben. 1887 traf das Kloster St. Meinrad in USA ein Brandunglück. Aber man begann sofort mit
einem Neubau, auch von Einsiedeln tatkräftig unterstützt. Pater Vinzenz Wehrle (Profess 1876) kam 1882 nach St Meinrad, Von dort ging er weiter nach Neu-Subiaco. In Devils Lake gründete er eine klösterliche Niederlassung die 1899 nach Richardton verlegt wurde.
1901 wurde dort ein kanonisches Priorat errichtet. Pater Vinzenz wurde dort Prior. Papst Pius X. (1903-1914) erhob es zur 24. November 1903 zur Abtei St. Maria. Der Prior wurde Abt von Richardton. Am 9. April 1910 ernannte ihn Papst Pius zum Bischof von
Bismark. als Abt von Richardton resignierte er 1915.
Für das Kloster Fahr konnte Abt Basilius Erleichterungen erreichen. In einem Gesetz von 1865 war dem Kloster Fahr die Novizenaufnahme untersagt. 1886 konnte Abt Basilius diese Bestimmung revidieren. Allerdings blieb die Zahl der Klosterfrauen auf 30
beschränkt.
1893 konnte Abt Basilius sein 50-jähriges Professjubiläum feiern. Er war da allerdings schon krank. Ein Magenleiden ging allmählich in Krebs über, dem er am 28. November 1895 erlag.
Columban Brugger wurde am 17. April 1855 als Johann Brugger in Basel geboren. Seine Eltern Johann Brugger und Katharina Gerspach hatten seit 1871 das schweizerische Bürgerrecht. Zunächst besuchte er die von den Schulbrüdern in Basel geleitete
Schule. Er hatte eine große Begabung für Musik und in Basel hatte er schon für Musikunterricht. Ab 1868 besuchte er die Stiftschule. Dort verbrachte er viel Zeit mit praktischen und theoretischen Musikstudien. Aber bald zeigte er auch eine besondere
Vorliebe für Technik. mit 17 meldete er sich ins Kloster an. Als Frater Columban legte er am 2. September 1873 seine Profess ab. Er beendete sein Physik-und Philosophiestudium. Am 20.September 1879 wurde er zum Priester geweiht. Seine technische
Begabung förderte der Abt mit einem Studium an der Universität Karlsruhe. Vin 1881 bis 1889 unterrichtete er Mathematik am Stiftsgymnasium, 1883 und 1884 auch Physik und Chemie. Daneben war er auch Vizekapellmeister. Hier pflegte er vor allem den
gregorianischen Choral, das in einer Zeit, in der dieser alten Tradition noch nicht soviel Gewicht beigemessen wurde wie heute. Er baute das physikalische Kabinett aus. Für sein physikalisches Interesse hatte er in seinem Abt einen großzügigen
Förderer und Gönner. Im Physikzimmer wurde auch eine elektrische Anlage erstellt, die es ermöglichte, die Kirche zu beleuchten. Am 31. März 1894 wurde er Nachfolger des verstorbenen Siftsdekans Ildefons Hürlimann (Profess 1845, Stiftsdekan von 1867
bis zu seinem Tod 1894). Damit musste er seine Tätigkeit als Lehrer aufgeben. Kurz nach seiner Ernennung zum Dekan brach ein schweres Magenleiden aus, an dem er fast gestorben wäre. Er erholte sich zwar, musste aber zeitlebens strengste Diät halten.
Trotz gesundheitlicher Bedenken wurde Pater Columban am 5. Dezember 1895 zum neuen Abt gewählt. Am 21. März 1895 weihte ihn der Abt von Muri-Gries Augustin Grüninger (1887-1897). Anwesend waren die Äbte der Schweizer Benediktinerklöster,
aber auch Laurentius Wocher (1893-1895)Abt des Klosters Mehrerau. Im Zuge des Klosterstreits im Kanton Aargau mussten die Mönche ihr Kloster Wettingen am 12. Januar 1841 verlassen. Sie gründeten ihr Kloster 1854 in der alten BenedikinerAbtei Mehrerau bei
Bregenz neu. Aus Kloster Ölenberg war Abt Francois Struck (!889-1912) dabei. Ölenberg im Deparment Haut-Rhin in der Nähe von Mülhausen war 1825 von Trappisten wieder besiedelt worden. Auch zwei Bischöfe weilten der Amtseinsetzung bei,
nämlich Bischof Johannes Fidelis Battaglia (1889-1905) vom Bistum Chur und der Basler Bischof Leonhard Haas (1888-1906). Der neue Abt wurde bald zum Präses der schweizerischen Benediktiner gewählt.
Zu Beginn seiner Amtszeit widmete er sich der Orgel. Musikalisch und physikalisch bewandert besorgte er einen Teil des Umbaus in den Einsiedler Werkstätten zusammen mit seinen Brüdern selbst. Die Federführung hatte die Stuttgarter Firma Weigle,
die damals als führend auf dem Gebiet des Orgelbaus galt. Am 24. November 1898 wurde die neue Orgel eingeweiht, de damals wohl das modernste Orgelwerk ihrer Zeit war. Unter Abt Columban hielt auch die elektrische Kraft Einzug im Kloster.
Überall gab es elektrische Beleuchtung und auch eine große Dieselmotoranlage wurde erstellt. Der Abt ließ auch ein Photoatelier im Kloster errichten. Trotz seiner Technikbegeisterung vergaß er auch die Landwirtschaft nicht. Die neue Benediktscheuer
auf dem Freiherrenberg wurde errichtet. Die Stiftsstatthalterei wurde als eigene Viehzuchtgenossenschaft geführt und errang Diplome und Medaillen. Auch die gute Düngerwirtschaft und vorbildliche Weg-und trinkwasseranlagen auf der Alp Sihltal wurden geehrt.
Zur Jahrhundertwende hatte der Konvent 143 Mitglieder erreicht, soviel wie nie zuvor.
Bei der Einweihung eines Blitzableiters zog sich der Abt eine Erkältung zu. Dazu kam eine Blinddarmentzündung und weiter Komplikationen. Am 23. Mai 1905 verstarb er im Alter von nur 51 Jahren.
Am 30. Mai 1905 wurde Thomas II. Bossart zu Abt Columbans Nachfolger gewählt. Er ist am 16. September 1858 als Kaspar Bossart in Altishofen im Kanton Luzern geboren. Sein Vater Kaspar war Gerichtsschreiber. Seine Mutter
war Verena Schiffmann. Im Herbst 1872 kam er an die Stiftsschule nach Einsiedeln. 1878 meldete er sich zum Kloster an. Am 8. September 1879 legte er seine Profess ab. Er studierte Theologie und wurde am 20. April 1884 zum Priester geweiht.
Abt Basilius schickte ihn nach seiner Priesterweihe zu einer weiteren Ausbildung nach Rom. Dort erwarb er an der Gregorianischen Universität den Doktorgrad und kehrte nach Einsiedeln zurück um als Theologieprofessor an der Hauslehranstalt
des Kloster zu wirken. Abt Basilius schickte ihn dann aber als Theologieprofessor an das neuauflebende Ordenskollegium nach Rom. Doch im November 1895 musste er nach Einsiedeln zurück um an der Wahl des Nachfolgers für den verstorbenen
Abt Basilius teilzunehmen. Auch er kam neben Pater Columban als neuer Abt in Frage. Als dieser gewählt war, ernannte er bald darauf Pater Thomas zum Dekan. Bei der Wahl nach Columbans Tod wurde Thomas am 30. Mai 1905 im ersten Wahlgang zum neuen Abt
gewählt. Am 11. Juni 1905 weihte ihn sein Freund Hildebrand de Hemptinne zum Abt. Hildebrand hatta 1870 seine Profess im Kloster Beuron abgelegt. Papst Leo XIII. (1878-1903)hatte 1893 die benediktinische Konföderation gegründet, das ist die Gemeinschaft
der 20 Benediktinerkongregationen mit derzeit 341 selbstständigen Mönchsklöstern.Papst Leo XIII. ernannte Hildebrand de Hemptinne zum ersten Abtprimas.
Im Kloster wurde eine neue Kanalisation und eine eigen Wasserversorgung geschaffen. Die Klosterkirche wurde durchgreifend umgestaltet. Das Naturalienkabinett wurde vergrößert. Die Zahl der Laienbrüder wuchs stetig. Für die Laienbrüder wurde ein neues
Stockwerk aufgebaut.Die Gärtnerei erhielt ein großes Treibhaus und die Klosterküche wurde umgestaltet. An äußeren Ehren lag dem Abt nicht. Er war zum Beispiel für die Nuntiatur in Wien in Aussicht genommen worden, konnte dies aber verhindern .
Am 12. Mai 1913 wählten die versammelten Äbte in Rom Thomas zum Abtprimas. Der Gewählte wollte die Wahl auf keinen Fall annehmen und der Papst wollte ihn nicht zwingen. so konnte er ins Stift zurückkehren.
Als im August 1914 der 1.Weltkrieg ausbrach half der Abt, wo er konnte. Dem zweiten Abtprimas der Benediktiner Fidelis von Stotzingen (1913-1947) gewährte er Asyl. Auch der Generalobere der Pallotiner Karl Gissler (1909-1919) kam in Einsiedeln unter.
Deshalb kamen immer wieder Gesandte von Österreich, Bayern und Preussen vorübergehend nach Einsiedeln. Auch der frühere Reichskanzler von Bülow war unter den Besuchern. In der Presse der Entente wurde das nicht immer sehr freundlich aufgenommen.
Aber Abt Thomas hielt streng an der neutralen Haltung fest. Doch stand das Kloster allen Besuchern aus beiden Lagern offen.
Für deutsche Kriegsgefangene stellte er Pater Sigismund de Courten (Profess 1888) zur Verfügung, der sie besuchte und sich um ihre Seelsorge annahm. Er war Geistlicher Abgeordneter des Schweizer Bundesrats und des Heiligen Stuhls. Um seiner Mission eine
bessere Wirkung zu verschaffen ernannte ihn der Schweizer Bundesrat am 20. März 1917 zum Feldprediger-Hauptmann. Vor allem nach dem Krieg war der Abt in großem Umfang helfend tätig. Wie kaum ein Einsiedler Abt vor ihm war er weit über die Schweizer
Grenzen hinaus angesehen und verehrt. Im September 1919 zog er sich aufgrund einer Erkältung ein Nierenleiden zu, dass zwar durch strenge Diät und mehrere Kuraufenthalte gelindert aber nicht mehr geheilt werden konnte. Am 7. Dezember 1913
erlag er seiner Krankheit.
Auf ihn folgte Pater Ignatius Staub. Er ist am 19. Dezember als Josef Thomas Staub in Baar geboren. Seine Eltern waren Karl Josef Staub und Anna Maria Trinkler. Ab 1886 besuchte er die Stiftsschule in Einsiedeln. 1892 trat er ins Kloster ein und legte am 1. September
1895 die Profess ab. Am 16.Juli 1899 wurde er zum Priester geweiht. 1902 sandte ihn Abt Columban zum Studium der Geschichte nach Freiburg im Uechtgau, wo er mit einer Arbeit über den Konstanzer Generalvikar (1518-1523) Johann Fabri am 10. Mai 1910
zum Doktor promovierte. Im April 1916 bestellte ihn Abt Thomas zum Stiftsbibliothekar. 1922 gab er ein “Lehrbuch des Mittelalters” heraus
Am 19. Dezember 1923 wurde er zum Nachfolger des verstorbenen Abtes Thomas gewählt. Die Weihe nahm der päpstliche Nuntius Lugi Maglione (1920-1926)am 28. Januar 1924
vor.1925 wurde ein Vertrag zwischen dem Kanton Schwyz und dem Kloster Einsiedeln geschlossen. Eine landwirtschaftliche Schule wurde gegründet, vom Kloster finanziert und betrieben. Sie ist die älteste Berufsschule im Kanton Schwyz.
Im Jahr 1924 hatte der Apostolische Administrator für den Tessin Benediktiner von Einsiedeln nach Ascona gerufen. Sie übernahmen das Collegium Papio, das schon 1585 auf Initiative von Karl Borromäus gegründet wurde. Die Mönche aus Einsiedeln wirkten bis 1964
in Ascona.
Seit 1931 war er Vorstandsmitglied der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. Das war die Dachorganisation der Schweizer Historikerschaft.
Er war Abt bis 1947 und verstarb am 29. März 1947.
Auf ihn folgte Benno Gut 1947- 1959. Er wurde am 1. April 1897 als Walter Gut in Reiden im Kanton Luzern geboren. Sein Vater war der Organist und Lehrer Gottfried, seine Mutter Marie Oetterli.
Er besuchte das Gymnasium in Luzern und wechselte 1916 auf die Stiftsschule nach Einsiedeln. Ab 1916 begann er ein Musikstudium in Basel. Sein Noviziat machte er in Einsiedeln. Dann wurde er zum Theologiestudium
nach Rom geschickt. Dann wurde er zum Priester geweiht. Er setzte seine Theologiestudien an der Benediktinerhochschule St. Anselmo fort. Dort promovierte er am 29. Juni 1923 zum Doktor der Theologie. Er kehrte nach Einsiedeln zurück
und war dort 1923!924 Choralmagister. Dann war er für zwei Jahre Direktor der Studentenmusik. Er lehrte auch Exegese an der theologischen Hauslehranstalt. Außerdem war er in Einsiedeln von 1923-1930 als Lehrer an der Stiftsschule.
1930 wurde er als Professor für Apologetik nach St. Anselmo berufen. Nebenher studierte er auch am Päpstlichen Bibelinstitut in Rom. Dort erwarb er 1934 ein Lizentiat, das ist ein akademischer Grad und beinhaltet eine Lehrerlaubnis.
1935 unternahm er eine Studienreise nach Palästina und Kleinasien. Nach seiner Rückkehr war er in St. Anselmo Lehrer für neutestamentliche Exegese. Während des Krieges kehrte er nach Einsiedeln zurück. Seit August 1942 war er Präfekt am
Internat. 1947 wurde er zum Nachfolger des verstorbenen Ignatius Straub gewählt. Die Abtweihe nahm Nuntius Filippo Bernardini (1935-1953) vor.
Schon sein Vorgänger Ignatius Straub hatte von seinen Patres eine Bittschrift erhalten, mit der er gebeten wurde, sich um überseeische Missionsaufgaben zu kümmern. Im November 1939 sandte er Pater Leopold Haniman (Profess 1919 +1976) und Polykarp Buchser
(Profess 1926 + 1972) als Pioniere nach Argentinien. Dann brach aber der II. Weltkrieg aus und verzögerte das Projekt. Nach dem Krieg gab der Apostolische Nuntius Giuseppe Frietta (päpstlicher Nuntius in Argentinien 1936-1953) einen Tipp. In der Nähe des Dorfes
hatte eine Frau Maria Marenco, Witwe des Verstorbenen Cayetano Sancho Diaz auf der Farm ihres Mannes eine gemeinnützige Stiftung mit einer landwirtschaftlichen Schule eingerichtet. Diese wollte sie nun einem Orden übergeben. Das Kapitel beschloss im
Februar 1948 unter Abt Benno Gut eine klösterliche Niederlassung in Argentinien zu errichten. Am 28 März 1948 reisten 6 Einsiedler Patres und 6 Brüder nach Argentinien ab. Unter ihnen war Pater Eugen Pfiffner (Profess 1919 +1959) Er wurde der erste Prior in
Los Toldos. Pater Albert Huber (Profess 1929) war von Abt Ignatius Straub an die ETH, wo er Agronomie studierte. Er sollte die landwirtschaftliche schule, die nach dem Willen der Stifterin errichtet werden sollte, leiten. Das Schulexperiment wurde nach 3 Jahren
abgebrochen. Pater Albert trat 1954 einen Heimaturlaub an, blieb dann aber auf Dauer in Einsiedeln. Dort war er wieder an der Stiftsschule tätig, betreute aber nebenbei auch die Pferdezucht in Einsiedeln. 1963 veröffentliche er das Buch “1000 Jahre Pferdezucht
Kloster Einsiedeln.” Er verstarb am 26. April 1981 im Alter von 75 Jahren. Das Kloster Los Toldos wurde am 03.05. 1948 gegründet. Abt Benno weihte es am 07.04. 1951. Nach dem Tod des ersten Priors folgte ihm Pater Josef Felber als Prior. Auf sein Bestreben hin
wurde mit Pater Pedro Alluralde der erste aus Argentinien stammende Mönch Prior in Los Toldos. Am 31.07. 1968 sprach Rom die kanonische Errichtung eines selbstständigen Priorats aus. Damit war Los Toldos von Einsiedeln unabhängig. 1981 erhielt Los Toldos
von den Bischöfen von Paraguay eine Einladung, ein Tochterkloster in Paraguay zu errichten. Der Konvent sprach sich dafür aus und am 22.07. 1984 begannen 5 Mönche aus Los Toldos unter Leitung von Prior Pedro Alluralde mit der errichtung von tupasy Maria in
Paraguay.
In Einsiedeln wurde 1956 die Renovierung der Klosterfassade abgeschlossen.
1959 stellte sicher bisherige Abtprimas der Benediktinerkonföderation Bernhard Kälin nicht mehr zur Wahl als Abtprimas, was er von 1947-1959 war. Von 1945-1947 war er Abt in Muri-Gries. Der Äbtekongress der Benediktinerkonföderation wählte nun Abt
Benno Gut zum 4. Abtprimas. Von Amts wegen ist der Primas Abt der Primitialabtei Sant Anselmo in Rom. Abt Benno resignierte auf Einsiedeln und übersiedelte nach Sant Anselmo, wo er ja schon als Lehrer tätig war.
Seine kirchliche Karriere ging noch weiter. 1960 wurde er Mitglied des vorbereitenden Zentralkomitees des 2. Vatikanischen Konzils, an dem er als Konzilsvater teilnahm. Papst Paul VI. ((1963-1978) wurde er 1967 zum Titularerzbischof
von Tuccabora in Mauretanien ernannt. Kardinal Eugène Tisserant weihte ihn in Einsiedeln zum Bischof. Papst Paul kreierte ihn zum Kardinaldiakon. Seine Titelkirche war S. Giorgio in Velabro. Daraufhin trat er als Abtprimas zurück. In diesem amt
folgte ihm der bisherige Erzab Rembert Weakland, Erzabt von St. Vincent in Latrobe nach. Benno Gut wurde vom Papst am 8. Januar 1968 zum Präfekten der Rietenkongregation und zum Vorsitzenden des Liturgierats bestellt. Einen Monat wurde
er auch Mitglied der Kommission zur Revision des kanonischen Rechts. Benno gut starb am 8. Dezember 1970 in Rom und ist in Einsiedeln beigesetzt.
Auf ihn folgte Raymund Tschudi 1959-1969. Er ist am 7. Juli 1914 in Basel geboren. In Einsiedeln besuchte er ab 1927 das Stiftsgymnasium. Er trat dort ins Kloster ein und legte 1936 seine Profess in Einsiedeln ab. 1940 wurde er zum Priester
geweiht. In Fribourg studierte er Geschichte und Pädagogik. 1945 promovierte er. Dann unterrichte er am Stiftsgymnasium in Einsiedeln. Nach 1947 ging er als 2. Sekretär des Abtprimas Bernhard Kälin nach Rom. 1948/49 war er Lehrer am Collegio Papio
in Ascona. Dann ging er nach Einsiedeln zurück. In Einsiedeln wurde er 1956 Novizenmeister. Nach der Wahl Abt Bennos zum Abtprimas, wurde er dessen Nachfolge. Die Weihe erteilte ihm der apostolische Nuntius Nuntius Gustavo Tessa (1953-1959)
1969 legte er überraschend seine Ämter nieder und trat aus der Klostergemeinschaft aus. Bis zu seinem Tod 2011 lebte er in München.
Georg Holzherr wurde am 22. Januar 1927 in Neuendorf im Kanton Solothurn in eine Bauernfamilie geboren. er besuchte das Gymnasium in Beromünster bis 1944. Bis 1948 war er in der Stiftsschule in Einsiedeln. Dort trat er 1948 ins Kloster ein
und legte 1949 als Bruder Georg seine Profess ab. Er studierte Philosophie in Einsiedeln und 1950-1953 Theologie in Sant Anselmo in Rom. In Montecassino wurde er am 24. Juni 1953 zum Priester geweiht. Bis 1956 folgte ein Studium Kirchenrecht an
der Lateranuniversität in Rom. Dort promovierte er zum Dr.jur.cand. Ein Studium Moraltheologie und Pschyologie in München folgte. Von 1957-1969 war er Lehrer an der Stiftschule in Einsiedeln. 1967 wurde er zum Sekretär der Schweizer Benediktinerkongregation
ernannt. Nach dem Rücktritt Raymund Tschudis wurde er 1969 im dritten Wahlgang zum 57. Abt des Klosters Einsiedeln gewählt. Nach der päpstlichen Bestätigung weihte ihn sein Vorvorgänger Kardinal Benno Gut zum Abt. Sicherlich hatte der Rücktritt seines
Vorgängers auch für Unruhe im Kloster gesorgt. Daneben war eine seiner ersten Aufgaben die Umsetzung der Beschlüsse des 2. Vatikanischen Konzils im Bereich der Liturgie. Er musste eine Balance finden, die klösterliche Liturgie in der Kernsubstanz zu erhalten
und gleichzeitig den Anforderungen des Konzils gerecht zu werden. Als Territorialabt war Georg Holzherr auch Mitglied der Schweizerischen Bischofskonferenz. Da war er neben dem Ressort Liturgie eine Zeit lang auch für die Ökumene und Fragen der
Medienarbeit zuständig.
Dem Rückgang der Klostermitglieder musste begegnet werden. Abt Georg tat dies mit einer Konzentration auf die Aufgaben, die sich mit dem Gemeinschaftsleben und Gebetsleben verbinden ließen. Auch die Klosterwirtschaft musste Einschnitte hinnehmen.
Erstmals in 1000 Jahren wurde Klosterland verpachtet. Der Grundbesitz wurde reduziert. Die Theologische schule öffnete sich für auswärtige Dozenten und Schüler und konnte so erhalten werden. Die landwirtschaftliche schule in Pfäffikon wurde dem kanton
abgetreten. Die Stiftsbibliothek und die barocke Klosterkirche wurden restauriert. auch in verschiedenen Statthaltereien wurden Sanierungen durchgeführt. Kurz vor Erreichen der Altersgrenze von 75 Jahren reichte Abt Georg seinen Rücktritt ein.
Als Spiritual im Benediktinerinnenkloster St. Lazarus verbrachte er seinen Lebensabend. Er verstarb am 26. Februar 2012.
Derr jetzige Abt Martin Werlen ist am 26. März 1962 als Stefan Werlen geboren. Seine Profess legt er am 11. Juli 1987 ab. Er studierte Theologie in Einsiedeln und den USA. Am 25. Juni 1988 wurde er zum Priester geweiht. Am 10. November 2001 wurde er zum 58. Abt
gewählt. Am 16. Dezember 2001 wurde er geweiht. Am 13. Januar 2012 erlitt er infolge eines Sportunfalls eine Hirnblutung. Das Sprachzentrum war beeinträchtig. Er musste praktisch wieder Lesen und Schreiben lernen. Nach Reha und 160 Therapiesitzungen sieht er
sich wieder geheilt. (Bericht in der NZZ vom 27. Mai 2012) Sein Amt wird er 2013 abgeben.(Medienmitteilung vom 21. Januar 2013)
Der Konvent umfasst laut homepage des Klosters etwa 70 Mönche. Das Kloster besteht seit 934 und ist eines der wenigen Klöster im deutschsprachigen Raum, die ununterbrochen bestehen
22 Okt. 2013
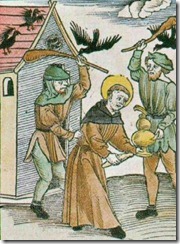
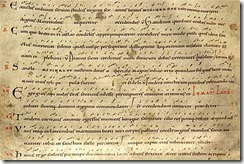
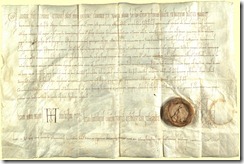

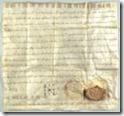
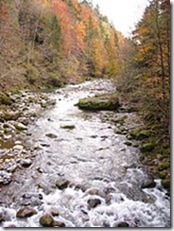
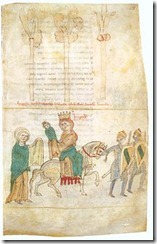

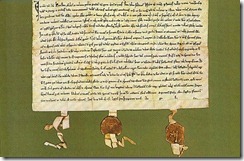

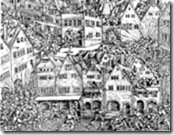



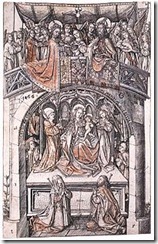
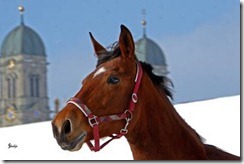






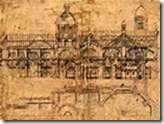






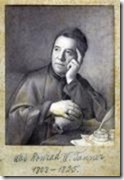
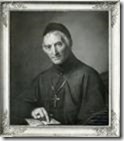


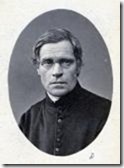



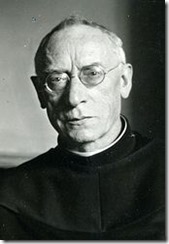
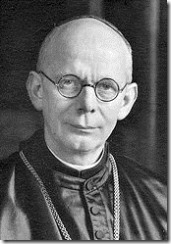
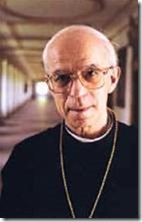



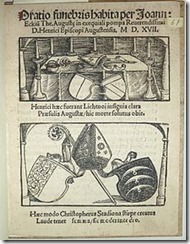
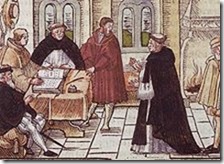





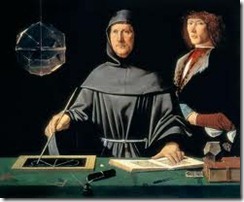

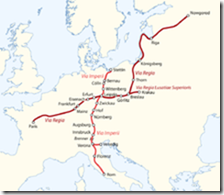
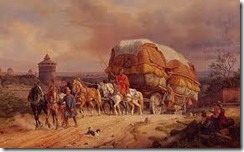



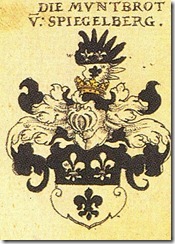
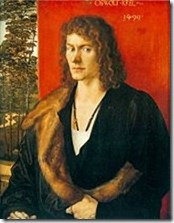
![kommerz_HG[1] kommerz_HG[1]](http://www.transtrend.de/franzkarl/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/kommerz_HG1_thumb.jpg)