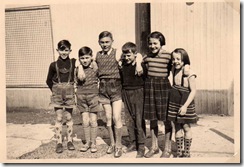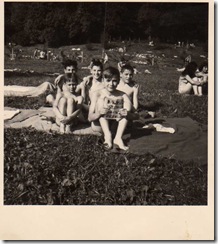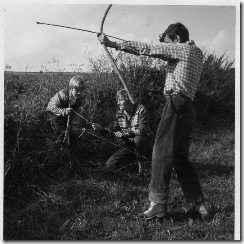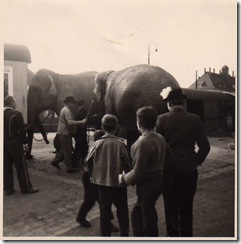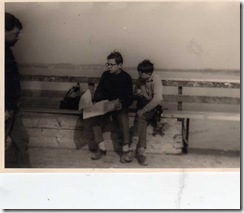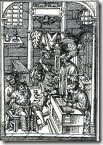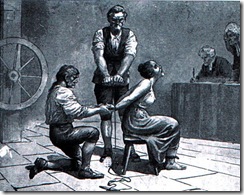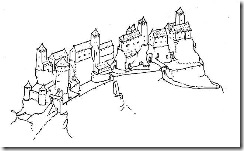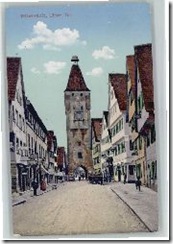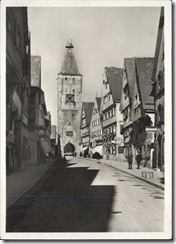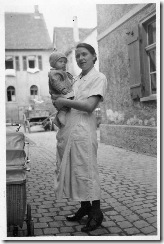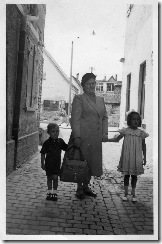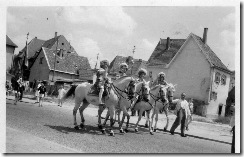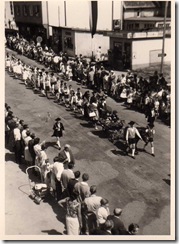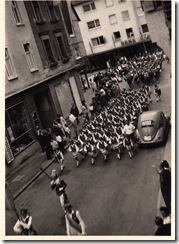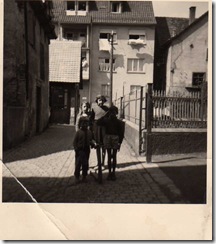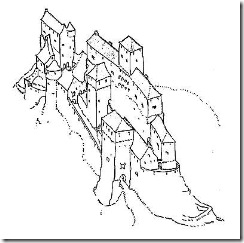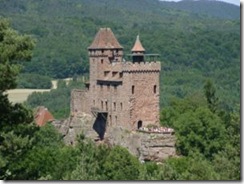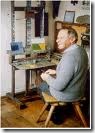Personen, die es wert sind, nicht vergessen zu werden
Autor: Franz-Karl | Kategorie: Biberach
Ein kleines Städtle wie Biberach, hatte natürlich einige Leute, die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Zählen wir einfach einige auf.
Hans Bopp, oder stadtbekannt als “Boppe Hans” war immer mit einer kleinen Aktentasche unterwegs. Er versorgte seinen Vater und holte dazu immer Mittagessen im Gasthaus Taube. Sein Hobby waren Opern und Operetten und sein größtes Vergnügen war, wenn er nach Opern und dem dazugehörigen Komponisten befragt wurde. “Von wem isch dr Schreifritz?” Typisches Witzle von Hans, er meinte natürlich den Freischütz. Stolz war er auch auf seine “Französischkenntnisse” So rief er immer “nix bonne mai” – was französisch sein sollte.
“Done” mehr als seinen Vornamen kenne ich nicht mehr und den kannte auch fast niemand in der Stadt. Er arbeitete als Stallknecht in der Viehhandlung Xeller. Leider schaute er gerne und beständig zu tief ins Glas und war auch immer angesäuselt. Da er ständig im Kuhstall arbeitete und eigentlich nie sicher auf seinen Beinen war, hatte er immer eine feuchte Kleidung und einen ziemlich heftigen Geruch. Aber eigentlich konnte er keiner Fliege etwas zu leide tun.
Emil Braunger. Er arbeitete in der Fellhandlung seine Bruders Hans. Er musste immer die Felle von der Handlung in der Ulmertorstraße auf einem Handwagen quer durch die Stadt in die Riedlinger Straße ziehen, wo ein Fellager der Firma Braunger war. Sein Hobby war Mathematik, ich glaube, er hat es sogar studiert. Außerdem hatte er kleine Federreinigung mit einer Wahnsinns Reinigungsmaschine. Als beruf gab er immer “Fedrabutzer” an. Sein Bruder Hans hatte die Fellfirma. Büro und Fellsammelstelle waren in der Ulmertorstraße. Beim Luftangriff auf Biberach hatte er sein Bein verloren. Er wurde morgens immer mit dem Taxi aus seinem Haus am Lindele geholt, in sein Büro in die Ulmertorstraße gefahren. Dort verbrachte er seinen Tag. In seinem Büro roch es immer ziemlich streng wegen der Felle. Sein Essen bezog er aus dem Gasthaus Taube, dass ich es ihm immer in sein Büro bringen musste. Der Haushalt wurde von der Schwester Frau Locher, geführt. Diese hatte ein Hutgeschäft am oberen Ende der Bürgerturmstraße. Wenn sie nicht gerade im Laden war, lief sie immer ziemlich zerlumpt herum und wer sie nicht kannte, wäre nie auf die Idee gekommen, dass sie ziemlich betucht war. Sie lebte in dem Haus in der Ulmertorstraße, in dem Hans sein Büro hatte. Ins obere Stockwerk ging es auf einer engen steilen Treppe. Das Haus am Lindele, in dem Hans schlief, wurde alle paar Jahre komplett sehr teuer neu eingerichtet. Meine Eltern mussten dann immer zur Besichtigung hoch.
Anton Kaiser war pensionierter Hauptkassier der Kreissparkasse Biberach. Er lebte mit drei Schwestern, wobei zwei mit ihm im Haus in der Ulmertorstraße wohnten, die dritte, die den Haushalt machte kam täglich aus Mittelbiberach. Zusammen mit zwei Schwestern betrieb er ein kleines Woll- und Handarbeitsgeschäft in der Ulmertorstraße. Er war immer mit einem alten Opel unterwegs, fuhr aber so langsam, dass er ein stadtbekanntes Verkehrshindernis war.
Hans Angele war ein Metzger in Bergerhausen, der immer total stolz auf sein Brät war. Er war fest davon überzeugt, dass niemand das Brät so gut machte wie er. Er war Stammgast im Gasthaus Taube und immer etwas laut. Einer seiner Lieblingssätze war: Ich zeig Dich an. Das hat mich als Kind immer ziemlich erschreckt.
Der Schneider. Mit Nachnamen hieß er Beroth. Er lebte im Bürgerheim. In seinem Berufsleben arbeitete er als einer der letzten Störschneider in der Gegend von Biberach. Meine Familie betreute ihn inoffiziell mit und so war er so ein bisschen eine Art Familienmitglied. Am Sonntag kam er immer in die Taube. Er bekam dann immer Bier und betete dafür ein Vaterunser für die Familie des Taubenwirts.
03 Jan. 2011